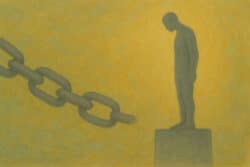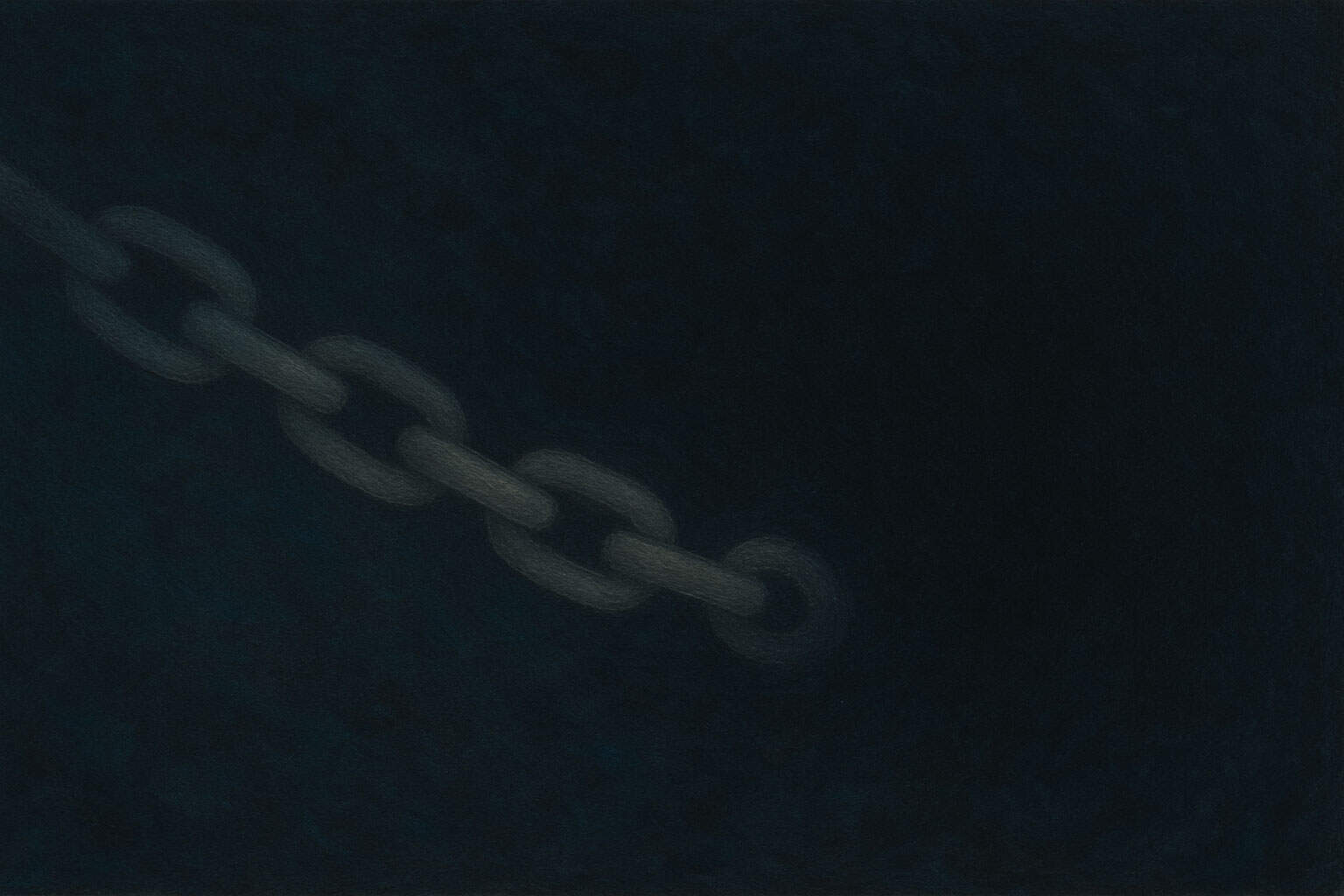
Arūpa-Rāga (Gier nach unstofflicher Existenz): Eine Einführung mit Verweisen auf den Pālikanon
Die siebte Fessel und die Anhaftung an formlose Zustände
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Arūpa-Rāga? Definition und Erklärung
- Arūpa-Rāga im Kontext: Die Zehn Fesseln (Saṃyojana)
- Schlüssel-Lehrreden aus Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN)
- Weitere wichtige Erwähnungen im Saṃyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN)
- Zusammenfassung
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung
Das Studium des Buddhismus führt unweigerlich zur Begegnung mit Begriffen aus der Pāli-Sprache, der Sprache, in der die ältesten buddhistischen Lehrreden (Suttas) aufgezeichnet wurden. Ein direktes Verständnis dieser Originalbegriffe ist von unschätzbarem Wert, da es einen nuancierteren und unmittelbareren Zugang zu den Lehren des Buddha ermöglicht, der über die möglichen Mehrdeutigkeiten von Übersetzungen hinausgeht. Dieser Bericht widmet sich der Klärung eines solchen Schlüsselbegriffs: Arūpa-Rāga.
Arūpa-Rāga bezeichnet eine subtile Form der Anhaftung oder des Begehrens, die auf dem Weg zur Befreiung eine wichtige Rolle spielt. Es repräsentiert eine spezifische Art von „Gier“ oder „Begierde“ (Rāga), die sich nicht auf materielle Objekte oder grobsinnliche Freuden richtet, sondern auf unstoffliche, formlose Daseinszustände.
Ziel dieses Berichts ist es, Arūpa-Rāga klar zu definieren, seine Stellung im buddhistischen Lehrgebäude – insbesondere im Rahmen der zehn Fesseln (Saṃyojana) – zu erläutern und spezifische Verweise auf Lehrreden aus den Sammlungen Dīgha Nikāya (DN), Majjhima Nikāya (MN), Saṃyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN) des Pālikanons zu geben. Diese Verweise, primär basierend auf der Ressource SuttaCentral.net, sollen interessierten Lesern ermöglichen, die Originalquellen aufzusuchen und ihr Verständnis zu vertiefen.
Der Bericht gliedert sich in die Definition von Arūpa-Rāga, seine Einordnung in das Konzept der zehn Fesseln, die Vorstellung relevanter Lehrreden und eine abschließende Zusammenfassung.
Was ist Arūpa-Rāga? Definition und Erklärung
Um Arūpa-Rāga zu verstehen, ist es hilfreich, die Bestandteile des Wortes zu betrachten. A-Rūpa bedeutet wörtlich „formlos“, „unstofflich“ oder „unkörperlich“. Der zweite Teil, Rāga, ist ein zentraler Begriff im Buddhismus und wird oft mit „Gier“, „Begierde“, „Lust“, „Leidenschaft“ oder „Anhaftung“ übersetzt. Rāga gilt als eine grundlegende Geistesverunreinigung (Kilesa) und ist synonym mit Begriffen wie Lobha (Gier) und Taṇhā (Durst, Verlangen). Allgemein bezeichnet Rāga die Neigung eines Lebewesens, irgendeine Form der Existenz in dieser Welt hoch zu bewerten und daran anzuhaften.
Arūpa-Rāga ist somit die spezifische Form des Begehrens (Rāga), die sich auf die Existenz in den formlosen Welten (Arūpa-Loka oder Arūpa-Dhātu) und das Erreichen der formlosen meditativen Vertiefungen (Arūpa-Jhāna oder Arūpāvacara Samāpatti) richtet. Dieses Verlangen kann selbst nach diesen höchsten, verfeinerten und glückseligen Zuständen der Konzentration entstehen, die jenseits der vier formhaften Vertiefungen (Rūpa-Jhāna) liegen. Das Objekt dieser Begierde ist „formlos“ – es bezieht sich auf Konzepte wie unendlichen Raum, unendliches Bewusstsein, Nichtsheit oder den Zustand weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung.
Es ist wichtig, Arūpa-Rāga von anderen Formen des Begehrens zu unterscheiden:
- Kāma-Rāga: Dies ist die Gier oder das Begehren nach sinnlichen Freuden, die durch die fünf physischen Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) vermittelt werden. Diese Form der Begierde ist dominant in der Sinnenwelt (Kāma-Loka) und gilt als die stärkste und gröbste Form von Rāga.
- Rūpa-Rāga: Dies ist die Gier oder das Begehren nach Existenz in den feinkörperlichen Welten (Rūpa-Loka). Sie ist verbunden mit den formhaften meditativen Vertiefungen (Rūpa-Jhāna), die auf einem Formobjekt basieren. In diesen Welten sind nach einigen Quellen nur noch Sehen und Hören als Sinnesfähigkeiten aktiv, während andere Quellen von drei aktiven Grundlagen sprechen: Geist, Auge und Ohr. Diese Begierde ist subtiler als Kāma-Rāga.
Es besteht eine klare Hierarchie in der Stärke und Subtilität dieser Begehrensformen: Kāma-Rāga ist am stärksten, gefolgt von Rūpa-Rāga und schließlich Arūpa-Rāga als die subtilste Form. Diese Abnahme der Intensität des Begehrens korrespondiert direkt mit der abnehmenden Anzahl aktiver Sinnesgrundlagen in den jeweiligen Existenzbereichen: sechs in der Sinnenwelt (Kāma-Loka), drei oder zwei in der feinkörperlichen Welt (Rūpa-Loka) und nur noch der Geist in der formlosen Welt (Arūpa-Loka).
Obwohl die formlosen Zustände und Welten als extrem verfeinert, friedvoll und glückselig gelten, stellt die Anhaftung an sie – also Arūpa-Rāga – dennoch eine Fessel (Saṃyojana) dar. Sie bindet Lebewesen weiterhin an den Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra), spezifisch an Wiedergeburten in den formlosen Bereichen. Diese formlosen Welten sind zwar von unvorstellbar langer Dauer, aber sie sind nicht ewig. Sie unterliegen ebenfalls der Vergänglichkeit (Anicca) und sind aus der Perspektive der endgültigen Befreiung (Nibbāna) letztlich unbefriedigend (Dukkha). Die vollständige Befreiung vom Leiden setzt die Auslöschung aller Formen von Rāga voraus, einschließlich dieser subtilsten Anhaftung an formlose Existenz.
Die Existenz von Arūpa-Rāga als Fessel unterstreicht die Tiefe der buddhistischen Analyse von Anhaftung: Selbst Zustände, die frei von physischer Form und groben Sinnesreizen sind und durch tiefe Meditation erreicht werden, können zu Objekten des Begehrens werden. Dies zeigt, dass Befreiung das Überwinden der Anhaftung an alle bedingten Zustände erfordert, egal wie verfeinert oder glückselig sie erscheinen mögen.
Die klare Unterscheidung zwischen Rūpa-Rāga und Arūpa-Rāga und ihre jeweilige Verbindung zu den Rūpa- und Arūpa-Jhānas sowie den entsprechenden Wiedergeburtsbereichen (Rūpa- und Arūpa-Loka) offenbart zudem ein integriertes System, in dem meditative Erfahrungen, kosmologische Vorstellungen und psychologische Hindernisse (Fesseln) eng miteinander verknüpft sind. Meditative Zustände können zu spezifischen Wiedergeburten führen, wenn die Anhaftung (Rāga) an diese Erfahrungen bestehen bleibt.
Arūpa-Rāga im Kontext: Die Zehn Fesseln (Saṃyojana)
Der Begriff Arūpa-Rāga ist Teil eines größeren Konzepts im Buddhismus: der zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni). Das Pāli-Wort Saṃyojana (Sanskrit: Saṃyojana) bedeutet wörtlich „Joch“, „Fessel“ oder „Band“. Diese Fesseln sind mentale Verunreinigungen oder Triebe (Kilesa), die Lebewesen an den leidvollen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt (Saṃsāra oder Vaṭṭa) binden. Das Ziel des buddhistischen Pfades ist es, diese Fesseln schrittweise zu schwächen und letztendlich vollständig zu durchtrennen und zu beseitigen.
Der Sutta Piṭaka, die Sammlung der Lehrreden, listet üblicherweise zehn solcher Fesseln auf. Es ist anzumerken, dass auch andere Listen existieren, beispielsweise im Abhidhamma Piṭaka oder spezifische Listen für Laienanhänger wie in MN 54, aber dieser Bericht konzentriert sich auf die im Sutta Piṭaka am häufigsten genannte Liste der zehn Fesseln.
Diese zehn Fesseln werden traditionell in zwei Gruppen unterteilt:
- Die Fünf Niederen Fesseln (Orambhāgiya-Saṃyojana)
Diese Fesseln werden als „nieder“ bezeichnet, weil sie Wesen vornehmlich an die niederen Existenzbereiche, insbesondere die Sinnenwelt (Kāma-Loka), binden. Sie umfassen:- Sakkāya-Diṭṭhi: Persönlichkeitsglaube; die falsche Ansicht, dass es ein beständiges, unabhängiges Selbst oder eine Seele in den Daseinsgruppen (Khandha) gibt.
- Vicikicchā: Skeptischer Zweifel; insbesondere Zweifel am Buddha, seiner Lehre (Dhamma), der Gemeinschaft der Praktizierenden (Saṅgha) und dem Weg zur Befreiung.
- Sīlabbata-Parāmāsa: Hängen an Regeln und Ritualen; der Glaube, dass äußere Regeln, Riten oder Zeremonien allein zur Läuterung oder Befreiung führen können, ohne innere Weisheit und Ethik.
- Kāma-Rāga: Sinnliches Begehren; die Gier nach angenehmen Erfahrungen durch die fünf Sinne.
- Byāpāda (auch Vyāpāda oder Paṭigha): Übelwollen, Widerwille, Hass; Aversion gegen unangenehme Erfahrungen oder Personen.
- Die Fünf Höheren Fesseln (Uddhambhāgiya-Saṃyojana)
Diese Fesseln werden als „höher“ bezeichnet, da sie auch jene binden, die die niederen Fesseln überwunden haben. Sie binden an die höheren, feinstofflichen (Rūpa-Loka) und formlosen (Arūpa-Loka) Existenzbereiche. Sie umfassen:- Rūpa-Rāga: Gier nach feinkörperlicher Existenz; das Begehren nach Wiedergeburt in den feinstofflichen Welten, oft verbunden mit der Anhaftung an die Erfahrungen der Rūpa-Jhānas.
- Arūpa-Rāga: Gier nach unkörperlicher/formloser Existenz; das Begehren nach Wiedergeburt in den formlosen Welten, oft verbunden mit der Anhaftung an die Erfahrungen der Arūpa-Jhānas. Dies ist der Begriff, auf den sich dieser Bericht konzentriert.
- Māna: Dünkel, Stolz, Einbildung; dies umfasst nicht nur groben Stolz, sondern auch die subtile Vorstellung „Ich bin“, selbst nachdem der Persönlichkeitsglaube (Sakkāya-Diṭṭhi) überwunden wurde.
- Uddhacca: Aufgeregtheit, Ruhelosigkeit; die Unfähigkeit des Geistes, zur Ruhe zu kommen, geistige Unruhe und Zerstreutheit.
- Avijjā: Unwissenheit, Verblendung; die fundamentale Unkenntnis der Vier Edlen Wahrheiten und der wahren Natur der Phänomene (Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbst).
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die zehn Fesseln gemäß dem Sutta Piṭaka:
Tabelle: Die Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni) nach dem Sutta Piṭaka
| Nr. | Pāli | Deutsch | Kategorie | Kurze Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakkāya-Diṭṭhi | Persönlichkeitsglaube | Nieder | Glaube an ein permanentes Selbst/Ich. |
| 2 | Vicikicchā | Skeptischer Zweifel | Nieder | Zweifel an Buddha, Dhamma, Saṅgha, dem Weg. |
| 3 | Sīlabbata-Parāmāsa | Hängen an Regeln und Ritualen | Nieder | Glaube, dass äußere Praktiken allein befreien. |
| 4 | Kāma-Rāga | Sinnliches Begehren | Nieder | Gier nach Sinnesfreuden. |
| 5 | Byāpāda | Übelwollen, Hass | Nieder | Aversion, Widerwille gegen Unangenehmes. |
| 6 | Rūpa-Rāga | Gier nach feinkörperlicher Existenz | Höher | Begehren nach Wiedergeburt in Formwelten (oft durch Rūpa-Jhāna bedingt). |
| 7 | Arūpa-Rāga | Gier nach unkörperlicher Existenz | Höher | Begehren nach Wiedergeburt in formlosen Welten (oft durch Arūpa-Jhāna bedingt). |
| 8 | Māna | Dünkel, Stolz | Höher | Subtiles Ich-Gefühl, Überlegenheits-/Unterlegenheits-/Gleichheitsdünkel. |
| 9 | Uddhacca | Aufgeregtheit, Ruhelosigkeit | Höher | Geistige Unruhe, Zerstreutheit. |
| 10 | Avijjā | Unwissenheit, Verblendung | Höher | Fundamentales Nichtwissen der Vier Edlen Wahrheiten, der Realität. |
Die Überwindung dieser Fesseln ist direkt mit dem Erreichen der Stufen der Heiligkeit (Ariya-Puggala) verbunden:
- Der Stromeingetretene (Sotāpanna) hat die ersten drei Fesseln (Persönlichkeitsglaube, Zweifel, Hängen an Regeln und Ritualen) vollständig zerstört. Er ist sicher vor Wiedergeburt in niederen Bereichen und wird höchstens noch siebenmal in der Menschen- oder Götterwelt wiedergeboren, bevor er Nibbāna erreicht.
- Der Einmalwiederkehrer (Sakadāgāmī) hat ebenfalls die ersten drei Fesseln zerstört und die nächsten beiden (Sinnliches Begehren, Übelwollen) stark abgeschwächt. Er kehrt nur noch einmal in die Sinnenwelt zurück.
- Der Nichtwiederkehrer (Anāgāmī) hat die ersten fünf Fesseln – alle niederen Fesseln – vollständig zerstört. Er wird nicht mehr in der Sinnenwelt wiedergeboren, sondern erscheint nach dem Tod in einer der reinen Aufenthaltsorte (Suddhāvāsa) der feinkörperlichen Welt, um von dort aus Nibbāna zu erreichen.
- Der Heilige (Arahant) hat alle zehn Fesseln, einschließlich Arūpa-Rāga und der anderen vier höheren Fesseln, vollständig zerstört. Er hat Nibbāna noch zu Lebzeiten verwirklicht und wird nach dem Tod nicht wiedergeboren.
Arūpa-Rāga gehört somit zu den letzten Fesseln, die auf dem Weg zur vollständigen Befreiung überwunden werden müssen. Dies unterstreicht ihre subtile Natur und ihre Verbindung zu den fortgeschrittensten Stufen des Pfades. Die Einteilung in „niedere“ und „höhere“ Fesseln fungiert wie eine Landkarte der spirituellen Entwicklung. Die Überwindung der niederen Fesseln befreit von der Wiedergeburt in der Sinnenwelt (Status des Anāgāmī). Die Befreiung von aller bedingten Existenz erfordert jedoch die Auseinandersetzung mit den subtilen Anhaftungen an verfeinerte Geisteszustände (Rūpa-Rāga, Arūpa-Rāga), die subtilen Formen der Selbstwahrnehmung (Māna), geistige Instabilität (Uddhacca) und das fundamentale Missverständnis der Realität (Avijjā).
Die Tatsache, dass Avijjā (Unwissenheit) als letzte der höheren Fesseln genannt wird – neben subtilen Begierden (Rūpa-/Arūpa-Rāga) und Dünkel/Ruhelosigkeit (Māna/Uddhacca) – deutet darauf hin, dass die endgültige Befreiung nicht nur die Überwindung von Anhaftungen beinhaltet, sondern auch eine grundlegende Transformation des Verständnisses der Wirklichkeit erfordert, nämlich die Ausrottung der Unwissenheit bezüglich der Vier Edlen Wahrheiten. Arūpa-Rāga und die anderen subtilen höheren Fesseln bestehen fort, solange ein Rest von Unwissenheit und Ich-Dünkel vorhanden ist, und werden erst mit deren vollständiger Beseitigung im Arahant überwunden.
Schlüssel-Lehrreden aus Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN)
Obwohl Arūpa-Rāga als spezifisches Thema – als eine der höheren Fesseln, die erst auf fortgeschrittenen Stufen des Pfades relevant werden – nicht der alleinige Fokus vieler einzelner Lehrreden im Dīgha Nikāya oder Majjhima Nikāya ist, gibt es dennoch wichtige Suttas in diesen Sammlungen, die den grundlegenden Rahmen der Fesseln behandeln und somit wesentlichen Kontext liefern.
1. DN 33 – Saṅgīti Sutta (Das Saṅgīti-Sutta)
- Inhalt: Diese Lehrrede ist insofern einzigartig, als sie nicht vom Buddha selbst, sondern von seinem Hauptschüler Sāriputta gehalten wurde. Sie stellt eine umfassende Zusammenstellung von Dhamma-Lehrpunkten dar, die numerisch geordnet sind – von Einheiten bis zu Zehner-Gruppen. Das Sutta diente vermutlich als eine Art Lehrbuch oder Gedächtnisstütze für die Mönche.
- Relevanz für Arūpa-Rāga: Im Abschnitt über die „Zehner-Gruppen“ listet DN 33 explizit die zehn Fesseln auf und unterteilt sie klar in die fünf niederen (Orambhāgiya) und die fünf höheren (Uddhambhāgiya) Fesseln. Arūpa-Rāga wird hier als siebte Fessel (die zweite der höheren Fesseln) genannt. Diese Lehrrede liefert somit eine wichtige kanonische Aufzählung des gesamten Konzepts der zehn Fesseln und verortet Arūpa-Rāga eindeutig innerhalb dieses Rahmens.
- Quelle: Dīgha Nikāya 33: Saṅgīti Sutta. DN 33 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
2. MN 64 – Mahāmālukya Sutta (Die längere Lehrrede an Māluṅkyāputta)
- Inhalt: Diese Lehrrede konzentriert sich primär auf die Erklärung der fünf niederen Fesseln (Orambhāgiya-Saṃyojana). Der Buddha erläutert dem Mönch Māluṅkyāputta detailliert, was diese Fesseln sind (Persönlichkeitsglaube, Zweifel, Hängen an Regeln/Ritualen, sinnliches Begehren, Übelwollen) und wie ihre Überwindung zum Zustand des Nichtwiederkehrers (Anāgāmī) führt. Das Sutta warnt auch vor unfruchtbaren Spekulationen über metaphysische Fragen, die nicht zur Befreiung führen.
- Relevanz für Arūpa-Rāga: Obwohl MN 64 Arūpa-Rāga nicht direkt behandelt, ist die Lehrrede von großer Bedeutung. Indem sie die niederen Fesseln klar definiert, schafft sie die notwendige Grundlage und den Kontrast zum Verständnis der höheren Fesseln. Sie zeigt auf, was einen an die Sinnenwelt bindet und was überwunden werden muss, um die Stufe des Nichtwiederkehrers zu erreichen – jene Stufe, auf der die höheren Fesseln wie Arūpa-Rāga noch bestehen und erst auf dem Weg zur Arahantschaft beseitigt werden. Das Sutta verdeutlicht somit die progressive Natur des Pfades, auf dem erst die gröberen und dann die subtileren Bindungen gelöst werden. Einige Interpretationen stellen auch eine Verbindung her zwischen der in MN 64 erwähnten Meditationspraxis (Jhāna) und der anschließenden Kontemplation von Leerheit zur Zerstörung der Verunreinigungen, was implizit auch die höheren Fesseln einschließt.
- Quelle: Majjhima Nikāya 64: Mahāmālukya Sutta. MN 64 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Die relative Seltenheit ausführlicher Diskussionen speziell über Arūpa-Rāga in DN und MN im Vergleich zu den niederen Fesseln könnte das primäre Publikum und den Fokus vieler Lehrreden widerspiegeln. Die niederen Fesseln sind für ein breiteres Spektrum von Praktizierenden relevant, die den Stromeintritt oder die Nichtwiederkehr anstreben. Die höheren Fesseln betreffen hingegen die letzten Etappen auf dem Weg zur Arahantschaft, eine fortgeschrittenere Stufe, die möglicherweise seltener direkt adressiert wurde. Dies legt eine pädagogische Schwerpunktsetzung nahe, die auf die Stufen des Pfades zugeschnitten ist, an denen die meisten Praktizierenden arbeiten.
Weitere wichtige Erwähnungen im Saṃyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN)
Über DN und MN hinaus bieten der Saṃyutta Nikāya (SN), der die Lehrreden thematisch gruppiert, und der Aṅguttara Nikāya (AN), der sie numerisch anordnet, weitere wichtige Einblicke in das Konzept der Fesseln, einschließlich Arūpa-Rāga.
Saṃyutta Nikāya (SN) Referenzen:
- Kein eigenes Saṃyutta: Es gibt kein spezifisches Kapitel (Saṃyutta) im SN, das ausschließlich dem Thema Arūpa-Rāga oder auch nur den höheren Fesseln als Ganzes gewidmet ist. Die Diskussionen finden sich innerhalb anderer thematischer Sammlungen.
- SN 45.180 – Uddhambhāgiya Sutta (Die höheren Fesseln):
- Relevanz: Diese kurze Lehrrede innerhalb des Magga Saṃyutta (Kapitel über den Edlen Achtfachen Pfad) ist sehr bedeutsam. Sie listet explizit die fünf höheren Fesseln auf: Rūpa-Rāga (Gier nach Form), Arūpa-Rāga (Gier nach Formlosem), Māna (Dünkel), Uddhacca (Aufgeregtheit) und Avijjā (Unwissenheit). Entscheidend ist, dass das Sutta feststellt, dass der Edle Achtfache Pfad entfaltet werden soll zum direkten Wissen, zum vollständigen Verstehen, zur völligen Zerstörung und zum Aufgeben eben dieser fünf höheren Fesseln. Dies verbindet die Überwindung von Arūpa-Rāga direkt mit der Kultivierung des gesamten Pfades. Die Platzierung dieser Diskussion im Magga Saṃyutta unterstreicht, dass die Bewältigung dieser subtilen Verunreinigungen ein integraler Bestandteil der Praxis und Vollendung des Edlen Achtfachen Pfades ist. Es verankert die Beseitigung von Arūpa-Rāga nicht als abstrakten Lehrpunkt, sondern als direktes Ergebnis und Ziel der Pfadentwicklung.
- SN 41.1 – Saṃyojana Sutta (Fesseln):
- Relevanz: Diese Lehrrede, Teil des Citta Saṃyutta (Kapitel über den Hausbesitzer Citta), enthält eine grundlegende Klärung durch Citta, der als Nichtwiederkehrer (Anāgāmī) gilt. Er erklärt, dass die Fesseln nicht innewohnend in den Sinnesorganen (wie dem Auge) oder den Sinnesobjekten (wie Formen) liegen. Vielmehr entstehen sie aufgrund von Chandarāga – dem Wunsch und der Gier bzw. dem Begehren –, das abhängig vom Kontakt zwischen Sinnesorgan und Sinnesobjekt aufkommt. Diese Erklärung verdeutlicht die psychologische Natur der Fesseln. Sie sind keine äußeren Gegebenheiten, sondern entstehen durch unsere Reaktion auf die Erfahrung. Dieses Prinzip ist entscheidend für das Verständnis aller Fesseln, auch von Arūpa-Rāga. Arūpa-Rāga entsteht nicht durch die formlosen Zustände selbst, sondern durch das Begehren (Chandarāga), das durch den geistigen Kontakt mit diesen Zuständen ausgelöst wird. Befreiung beinhaltet somit die Transformation der Reaktion (des Begehrens) auf die Erfahrung, nicht die Eliminierung der Erfahrung selbst.
Aṅguttara Nikāya (AN) Referenz:
- AN 10.13 – Saṃyojana Sutta (Fesseln):
- Relevanz: Dies ist eine besonders wichtige und häufig zitierte Lehrrede. Sie bietet eine sehr prägnante und klare Aufzählung der zehn Fesseln und teilt sie explizit in die fünf niederen (Orambhāgiya) und die fünf höheren (Uddhambhāgiya) ein. Arūpa-Rāga wird hier korrekt als die zweite der fünf höheren Fesseln (insgesamt die siebte Fessel) gelistet. Aufgrund ihrer Klarheit und Direktheit dient diese Lehrrede oft als Standardreferenz für die Lehre von den zehn Fesseln.
Zusammenfassung
Arūpa-Rāga, die Gier oder das Begehren nach formloser Existenz und formlosen meditativen Zuständen, stellt eine der subtilsten Formen der Anhaftung im Buddhismus dar. Es ist die siebte der zehn Fesseln (Saṃyojana) und gehört zu den fünf höheren Fesseln (Uddhambhāgiya-Saṃyojana), die erst auf der letzten Stufe des Weges, durch den Arahant, vollständig überwunden werden.
Die Bedeutung von Arūpa-Rāga liegt darin, dass es die Tiefe der buddhistischen Analyse von Anhaftung verdeutlicht. Selbst die höchsten und reinsten Geisteszustände, die durch tiefe Meditation erreicht werden können und frei von grober Sinnlichkeit sind, können zu Objekten des Begehrens werden und somit ein Hindernis für die endgültige Befreiung (Nibbāna) darstellen.
Die Überwindung von Arūpa-Rāga ist Teil der Beseitigung der letzten subtilen Bindungen an den Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra), zusammen mit der Gier nach feinkörperlicher Existenz (Rūpa-Rāga), Dünkel (Māna), Ruhelosigkeit (Uddhacca) und der fundamentalen Unwissenheit (Avijjā).
Die hier vorgestellten Lehrreden aus den vier Haupt-Nikāyas des Pālikanons bieten einen Einstiegspunkt für die Auseinandersetzung mit diesem Konzept. Sie zeigen Arūpa-Rāga im Kontext der zehn Fesseln und des gesamten buddhistischen Befreiungsweges. Es ist eine Einladung an die Leserinnen und Leser, dem buddhistischen Prinzip des Ehipassiko – „komm und sieh selbst“ – zu folgen und durch das Studium der Originaltexte ein tieferes Verständnis der Lehren des Buddha über die Fesseln des Geistes und den Weg zu ihrer Überwindung zu gewinnen.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.
- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.
- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.
- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.
- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.
- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Eitelkeit / Dünkel (Māna)
Erforsche den subtilen Stolz und die Einbildung (Māna), die selbst dann noch bestehen können, wenn der grobe Persönlichkeitsglaube schon gefallen ist. Lerne die verschiedenen Formen des Dünkels kennen – das Vergleichen mit anderen (besser, schlechter, gleich) – und wie sie auf einer feinen „Ich-bin“-Annahme beruhen.