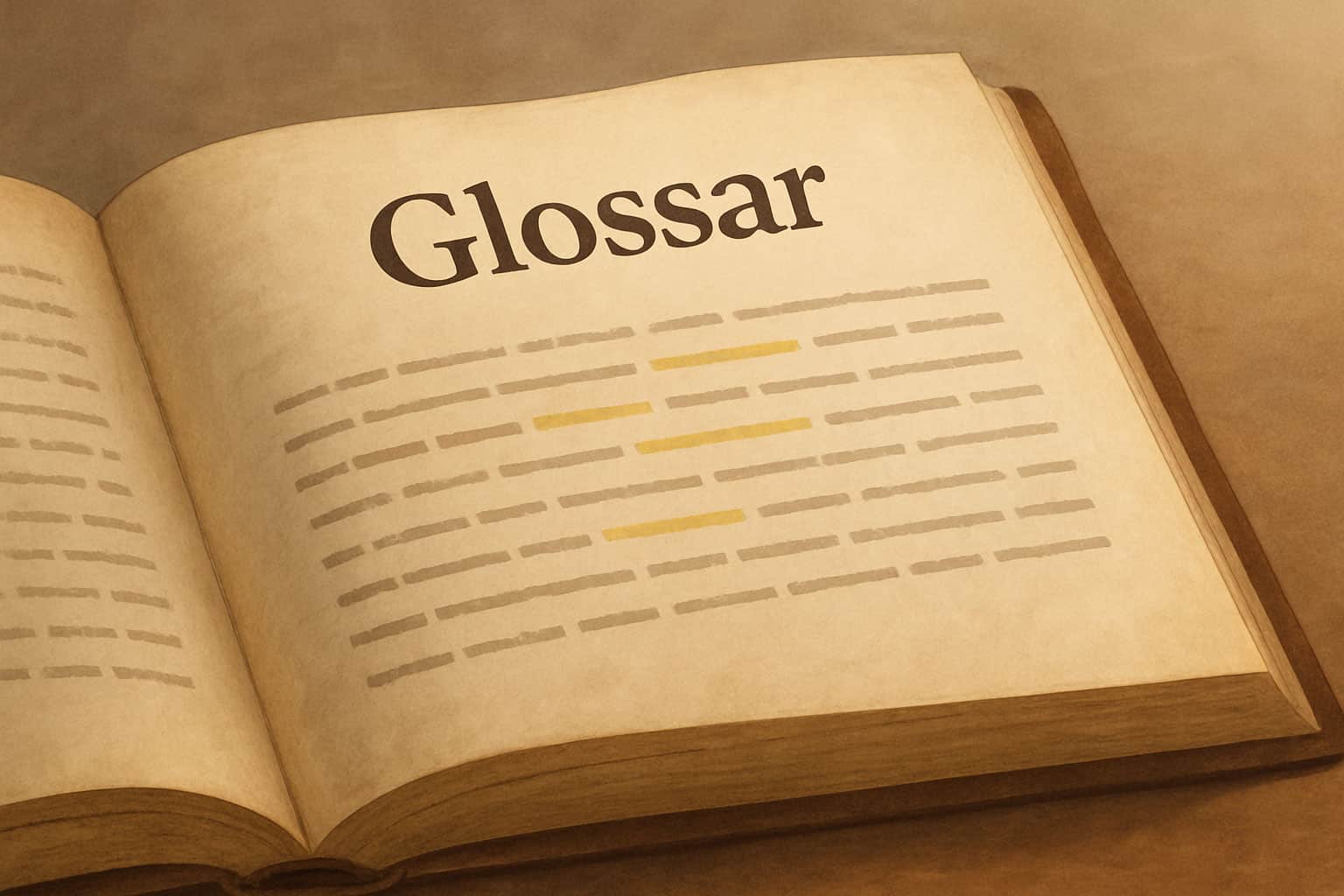
Gesamt-Glossar / Index der Schlüsselbegriffe
Ein Wegweiser durch die zentrale Terminologie des frühen Buddhismus
Herzlich willkommen zum Glossar dieser Webseite! Die Lehren des frühen Buddhismus, wie sie im Palikanon überliefert sind, verwenden eine Reihe spezifischer Begriffe in der Pali-Sprache. Diese Begriffe beschreiben oft tiefgreifende psychologische und philosophische Konzepte, deren Verständnis für ein klares Erfassen des Dhamma unerlässlich ist.
Da die Inhalte dieser Webseite stark in die Tiefe gehen, dient dieses Glossar als Index und Wegweiser. Es soll dir helfen, dich in der Terminologie zurechtzufinden und schnell zu den ausführlichen Erklärungen der einzelnen Konzepte auf den entsprechenden Hauptseiten zu gelangen.
Da die Inhalte dieser Webseite stark in die Tiefe gehen, dient dieses Glossar als Index und Wegweiser. Es soll dir helfen, dich in der Terminologie zurechtzufinden und schnell zu den ausführlichen Erklärungen der einzelnen Konzepte auf den entsprechenden Hauptseiten zu gelangen.
Jeder Eintrag enthält:
- Den Pali-Begriff als Hauptstichwort (mit diakritischen Zeichen).
- Eine Aussprache-Hilfe (kursiv dahinter), die dir zeigt, wie das Wort phonetisch für deutsche Leser klingt.
- Die gängige deutsche Übersetzung oder Entsprechung in Klammern.
- Eine sehr kurze Identifikation (1-2 Sätze) zur groben Einordnung des Begriffs.
- Einen Link-Hinweis
[Link zur Hauptseite zu...], der anzeigt, wo du zur detaillierten Erklärung des jeweiligen Themas auf dieser Webseite gelangst (wenn für den Begriff eine spezielle/eigene Seite vorhanden ist).
Nutze dieses Glossar als Nachschlagewerk und Sprungbrett, um die vielschichtigen Lehren des Buddha in ihrer ganzen Tiefe zu erforschen.
💡 Kurze Lesehilfe für Pāli
Pāli ist eine reine Lautsprache. Das Schöne daran ist: Man spricht sie fast genau so, wie man sie schreibt. Für deutschsprachige Leser gibt es nur wenige Besonderheiten zu beachten, die in der Aussprache-Hilfe dieses Glossars bereits berücksichtigt sind:
- c wird immer wie „tsch“ gesprochen (z. B. Citta klingt wie Tschitta).
- y wird immer wie ein deutsches „j“ gesprochen (z. B. Māyā wie Maja).
- v ist weich wie ein deutsches „w“ (nicht wie Vogel).
- ṃ (oder ṁ) ist ein nasaler Laut und wird wie das „ng“ in „Junge“ oder „Sing-sang“ gesprochen.
- h nach Konsonanten (th, dh, kh, bh) ist immer ein hörbarer Lufthauch (aspiriert). Ein „th“ ist also ein „t“ mit Hauch, kein englisches „th“.
- Strich über Vokal (ā, ī, ū) bedeutet: Dieser Laut wird lang gezogen (wie in Bahn, Lied oder Mut). In der Aussprache-Hilfe ist dies durch Doppelvokale (aa, ii, uu) dargestellt.
- Doppelkonsonanten (wie tt, dd, mm, pp) sorgen für einen kurzen rhythmischen Stopp oder eine kleine Pause mitten im Wort.
Hinweis zur Praxis: Sprache ist lebendig. Einige Begriffe (wie Saṃsāra) sind im Deutschen längst eingebürgert und werden oft eher so ausgesprochen, wie man sie liest (also mit „m“ statt „ng“). Betrachte diese Regeln daher als Orientierung für die ursprüngliche Lautung, wohlwissend, dass im gelebten Alltag oft mehrere Varianten koexistieren und ihre Berechtigung haben.
Tiefer in die Lehren eintauchen
Lehrreden-Verzeichnis
Während dieses Glossar dir hilft, einzelne Begriffe zu verstehen, sind die Lehrreden des Pali-Kanons die eigentliche Quelle dieser Weisheit. Möchtest du die Originaltexte des Buddha selbst erkunden? Dann nutze unsere Übersicht der Lehrreden, um die Suttas (Lehrreden) in ihrem ursprünglichen Kontext zu studieren und die Zusammenhänge der Lehre noch tiefer zu verstehen
Glossar A-Z Inhaltsverzeichnis
A | B | C | D | F |I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
A
Adhiṭṭhāna (Entschlossenheit) – Aussprache: A-dhit-thaa-na
Die unerschütterliche Entschlossenheit, sich an die Praxis zu halten und das Ziel der Erleuchtung zu erreichen. Sie ist eine der zehn Vollkommenheiten.
[Link zur Hauptseite zu Entschlossenheit (Adhiṭṭhāna)]
Akusala-Mūla (Unheilsame Wurzeln) – Aussprache: A-ku-sa-la Muu-la
Die drei Wurzeln allen Übels und Leidens: Gier (Lobha), Hass (Dosa) und Verblendung (Moha). Sie sind die Triebfedern für unheilsames Karma.
[Link zur Hauptseite zu Unheilsame Wurzeln (Akusala-Mūla)]
Ānāpānasati (Atemachtsamkeit) – Aussprache: Aa-naa-paa-na-sa-ti
Die Übung der Achtsamkeit auf den Ein- und Ausatem. Sie dient der Beruhigung des Körpers und Geistes und ist eine grundlegende Methode zur Entwicklung von Sammlung (Samādhi) und Einsicht.
[Link zur Hauptseite zu Spezifische Meditationen]
Anattā (Nicht-Selbst) – Aussprache: A-nat-taa
Eines der drei Daseinsmerkmale, das die Vorstellung eines permanenten, unveränderlichen „Ichs“ oder einer Seele widerlegt. Es besagt, dass alle Phänomene ohne einen dauerhaften, substanziellen Kern sind.
[Link zur Hauptseite zu Nicht-Selbst (Anattā)]
Anicca (Vergänglichkeit) – Aussprache: A-nit-tscha
Eines der drei Daseinsmerkmale, das besagt, dass alles Existierende, alle Phänomene, ob materiell oder geistig, ständig im Wandel sind und einer Veränderung unterliegen. Nichts ist permanent oder unveränderlich.
[Link zur Hauptseite zu Vergänglichkeit (Anicca)]
Anussati (Besinnung / Vergegenwärtigung) – Aussprache: A-nus-sa-ti
Eine Meditationsform, bei der man den Geist immer wieder auf ein bestimmtes heilsames Objekt richtet, z. B. auf die Qualitäten des Buddha (Buddhānussati), um Vertrauen, Freude und Konzentration zu entwickeln.
[Link zur Hauptseite zu Drei Juwelen (Tiratana)]
Anusaya (Latente Neigungen) – Aussprache: A-nu-sa-ja
Die tief sitzenden, „schlafenden“ Tendenzen im Geist, die noch nicht aktiv als Gedanken oder Gefühle manifest sind, aber das Potenzial für deren Entstehung bergen. Sie lauern im Untergrund und reagieren impulsiv auf Sinnesreize.
[Link zur Hauptseite zu Latente Neigungen (Anusaya)]
Ariya (Edel / Heilig) – Aussprache: A-ri-ja
Bezeichnet im Buddhismus alles, was fern von den Befleckungen (Kilesa) und auf die Befreiung ausgerichtet ist. Es bezieht sich auf die Personen, die den Pfad verwirklicht haben (Ariya-Saṅgha), sowie auf die Wahrheit und den Pfad selbst.
[Link zur Hauptseite zu Achtfacher Pfad (Ariya Aṭṭhaṅgika Magga)]
Ariya Aṭṭhaṅgika Magga (Edler Achtfacher Pfad) – Aussprache: A-ri-ja At-thang-gi-ka Mag-ga
Der vom Buddha verkündete Weg, der zur Beendigung des Leidens führt (die vierte Edle Wahrheit). Er umfasst die Übung in Weisheit, Sittlichkeit und Sammlung.
[Link zur Hauptseite zu Achtfacher Pfad (Ariya Aṭṭhaṅgika Magga)]
Ariya-Puggala (Edle Personen / Heilige) – Aussprache: A-ri-ja Pug-ga-la
Sammelbegriff für jene Praktizierenden, die eine der vier Stufen der Erleuchtung (vom Stromeingetretenen bis zum Arahant) erreicht haben und somit sicher dem Pfad zur Befreiung folgen.
[Link zur Hauptseite zu Stufen des Erwachens]
Arūpa-rāga (Formloses Begehren) – Aussprache: A-ruu-pa Raa-ga
Das Begehren nach Existenz in formlosen Daseinsebenen oder die Anhaftung an Zustände formloser Jhanas. Es ist die siebte der zehn Fesseln.
[Link zur Hauptseite zu 10 Fesseln (Dasa Saṃyojanāni)]
Āsavā (Triebe) – Aussprache: Aa-sa-waa
Vier Arten von „Fermenten“, „Einflüssen“ oder „Trieben“, die den Geist verunreinigen und zur weiteren Existenz im Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) führen: Sinnestrieb, Daseinstrieb, Ansichtentrieb und Unwissenheitstrieb.
[Link zur Hauptseite zu Triebe (Āsavas)]
Atakkāvacara (Jenseits logischen Denkens) – Aussprache: A-tak-kaa-wa-tscha-ra
Ein Begriff, der beschreibt, dass die tiefe Wahrheit des Dhamma (insbesondere Nibbāna) nicht allein durch intellektuelles Nachdenken oder Logik (Takka) erfasst werden kann, sondern direkte meditative Erfahrung erfordert.
[Link zur Hauptseite zu Jenseits von Worten]
Avijjā (Unwissenheit) – Aussprache: A-wid-dschaa
Das grundlegende Nichtwissen der Vier Edlen Wahrheiten und des Bedingten Entstehens. Sie ist das erste Glied der Kette des Bedingten Entstehens und eine unheilsame Wurzel, die Leid verursacht. Auch die zehnte der zehn Fesseln und der Unwissenheitstrieb.
[Link zur Hauptseite zu Unwissenheit (Avijjā)]
Avijjāsava (Unwissenheitstrieb) – Aussprache: A-wid-dschaa-sa-wa
Einer der vier Triebe (Āsavas), der das Nichtwissen der Vier Edlen Wahrheiten und des Bedingten Entstehens umfasst.
[Link zur Hauptseite zu Triebe (Āsavas)]
B
Bala (Kräfte / Spirituelle Kräfte) – Aussprache: Ba-la
Die fünf spirituellen Kräfte (Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit). Sie sind die unerschütterliche Weiterentwicklung der fünf Fähigkeiten (Indriya) und widerstehen den entgegenwirkenden Hindernissen.
[Link zur Hauptseite zu Fähigkeiten (Indriyāni) und Kräfte (Balāni)]
Bhava (Werden) – Aussprache: Bha-wa
Der Prozess des Seins, der Existenz oder der weiteren Geburt, angetrieben durch Anhaften (Upādāna). Es ist das zehnte Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Werden (Bhava)]
Bhavacakra (Rad des Lebens) – Aussprache: Bha-wa-tschak-ra
Eine symbolische Darstellung des Daseinskreislaufs (Saṃsāra), die die sechs Daseinsbereiche und die treibenden Kräfte von Unwissenheit, Karma und Wiedergeburt verbildlicht.
[Link zur Hauptseite zu Rad des Lebens (Bhavacakra)]
Bhāvanā (Meditation / Geistesschulung) – Aussprache: Bhaa-wa-naa
Wörtlich „Entfaltung“ oder „Werdenlassen“. Der Begriff umfasst im Buddhismus jede Form der geistigen Schulung und Meditation (wie Ruhe- und Einsichtsmeditation), um heilsame Zustände zu entwickeln.
[Link zur Hauptseite zu Bhāvanā = Meditation]
Bhavāsava (Daseinstrieb) – Aussprache: Bha-waa-sa-wa
Einer der vier Triebe (Āsavas), der das Verlangen nach weiterer Existenz und Wiedergeburt in den verschiedenen Daseinsbereichen umfasst.
[Link zur Hauptseite zu Triebe (Āsavas)]
Bodhipakkhiyādhammā (37 Faktoren) – Aussprache: Bo-dhi-pak-khi-jaa-dham-maa
Die 37 Faktoren, die zur Erleuchtung führen und in sieben Gruppen unterteilt sind: die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die vier rechten Anstrengungen, die vier Wege zur Geistigen Kraft, die fünf Fähigkeiten, die fünf Kräfte, die sieben Erleuchtungsglieder und der Edle Achtfache Pfad.
[Link zur Hauptseite zu 37 Faktoren (Bodhipakkhiyādhammā)]
Brahmavihārā (4 Unermessliche) – Aussprache: Brah-ma-wi-haa-raa
Vier erhabene Geisteszustände oder „Göttliche Verweilungen“: liebende Güte (Mettā), Mitgefühl (Karuṇā), Mitfreude (Muditā) und Gleichmut (Upekkhā). Sie sind wichtige Meditationsobjekte zur Entwicklung eines reinen Herzens.
[Link zur Hauptseite zu 4 Unermessliche (Brahmavihārā)]
Buddha – Aussprache: Bud-dha
Der Erwachte, der die Vier Edlen Wahrheiten erkannt und das Nibbāna erreicht hat. Er ist das erste der Drei Juwelen.
[Link zur Hauptseite zu Drei Juwelen (Ti-Ratana)]
Byāpāda (Übelwollen) – Aussprache: Bjaa-paa-da
Eines der fünf Hindernisse, das sich als Bosheit, Feindseligkeit, Groll und Abneigung gegenüber anderen oder sich selbst äußert.
[Link zur Hauptseite zu Übelwollen (Byāpāda)]
C
Caṅkama (Gehmeditation) – Aussprache: Tschang-ka-ma
Eine Form der Meditation, bei der man bewusst geht, um Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht zu entwickeln.
[Link zur Hauptseite zu Anl. Gehmeditation (Caṅkama)]
Carita (Praxis nach Typ) – Aussprache: Tscha-ri-ta
Die Neigung oder der Temperamentstyp eines Meditierenden, der bestimmt, welche Meditationsübungen am effektivsten sind (z.B. der zum Hass neigende Typ profitiert von Mettā-Meditation).
[Link zur Hauptseite zu Praxis nach Typ (Carita)]
Cattāri Ariyasaccāni (4 Edle Wahrheiten) – Aussprache: Tschat-taa-ri A-ri-ja Sat-tschaa-ni
Die vier grundlegenden Wahrheiten des Buddhismus, die vom Buddha gelehrt wurden: das Leiden (Dukkha), die Ursache des Leidens (Samudaya), die Aufhebung des Leidens (Nirodha) und der Pfad zur Aufhebung des Leidens (Magga).
[Link zur Hauptseite zu 4 Edle Wahrheiten (Cattāri Ariyasaccāni)]
Cetasika (Geistesfaktoren) – Aussprache: Tsche-ta-si-ka
Mentale Begleiter des Bewusstseins, die mit jedem Bewusstseinsmoment entstehen und vergehen und dessen spezifische Qualitäten bestimmen. Sie werden in heilsame, unheilsame und neutrale Faktoren unterteilt.
[Link zur Hauptseite zu Cetasikas (Geistesfaktoren)]
Chanda (Wunsch, Neigung) – Aussprache: Tschan-da
Ein neutraler oder heilsamer Wunsch bzw. eine positive Neigung, die als Basis für Anstrengung und Entschlossenheit auf dem Pfad dienen kann, im Gegensatz zu negativem Begehren (Taṇhā).
[Link zur Hauptseite zu Wunsch, Neigung (Chanda)]
Citta (Herz-Geist / Gemüt) – Aussprache: Tschit-ta
Der zentrale Begriff für den Geisteszustand oder das Gemüt. Citta ist der Schauplatz, auf dem sich Befreiung oder Leiden abspielen. Es bezeichnet weniger den Intellekt (Mano) als vielmehr die qualitative Verfassung oder „Stimmung“ des Geistes (z.B. gierig, hasserfüllt oder befreit, strahlend).
[Link zur Hauptseite zu Herz-Geist (Citta)]
Cittānupassanā (Geist) – Aussprache: Tschit-taa-nu-pas-sa-naa
Die achtsame Betrachtung des Geistes, seiner Zustände, Qualitäten und Veränderungen, als eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
[Link zur Hauptseite zu Geist (Cittānupassanā)]
D
Dāna (Geben) – Aussprache: Daa-na
Die Praxis des Gebens, der Freigebigkeit und des Teilens. Sie ist die erste der zehn Vollkommenheiten und eine grundlegende heilsame Handlung im Buddhismus.
[Link zur Hauptseite zu Geben (Dāna)]
Dasa Saṃyojanāni (10 Fesseln) – Aussprache: Da-sa San-jo-dscha-naa-ni
Zehn mentale Fesseln, die Wesen an den Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) binden und in vier Stufen der Erleuchtung schrittweise überwunden werden.
[Link zur Hauptseite zu 10 Fesseln (Dasa Saṃyojanāni)]
Dhamma (Lehre) – Aussprache: Dham-ma
Die Lehre des Buddha, die universellen Gesetze der Natur und die Wahrheit. Es ist das zweite der Drei Juwelen.
[Link zur Hauptseite zu Lehre (Dhamma)]
Dhammānupassanā (Objekte) – Aussprache: Dham-maa-nu-pas-sa-naa
Die achtsame Betrachtung der Geistobjekte oder Phänomene, wie die fünf Hindernisse, die fünf Aggregate oder die sieben Erleuchtungsglieder, als eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
[Link zur Hauptseite zu Objekte (Dhammānupassanā)]
Dhammavicaya (Dhamma-Untersuchung) – Aussprache: Dham-ma-wi-tscha-ja
Die Erforschung und Analyse der Lehre, um ihre Wahrheit und Bedeutung zu verstehen. Es ist das zweite der sieben Erleuchtungsglieder.
[Link zur Hauptseite zu Dhamma-Untersuchung (Dhammavicaya)]
Dhātumanasikāra (Elemente-Betrachtung) – Aussprache: Dhaa-tu-ma-na-si-kaa-ra
Die analytische Betrachtung des Körpers anhand der vier grundlegenden physikalischen Eigenschaften oder Elemente: Erde (Festigkeit), Wasser (Kohäsion), Feuer (Temperatur) und Luft (Bewegung).
[Link zur Hauptseite zu Spezifische Meditationen]
Diṭṭhi (Ansichten) – Aussprache: Dit-thi
Starre Meinungen, Ansichten oder Überzeugungen, die oft zu Anhaftung und Leid führen können, insbesondere wenn sie nicht auf direkter Einsicht basieren. Sie können heilsam oder unheilsam sein.
[Link zur Hauptseite zu Ansichten (Diṭṭhi)]
Diṭṭhāsava (Ansichtentrieb) – Aussprache: Dit-thaa-sa-wa
Einer der vier Triebe (Āsavas), der sich auf das Anhaften an falsche Ansichten oder dogmatische Meinungen bezieht, die den Fortschritt auf dem Pfad zur Befreiung behindern.
[Link zur Hauptseite zu Triebe (Āsavas)]
Dosa (Hass) – Aussprache: Do-sa
Eine der drei unheilsamen Wurzeln (Akusala-Mūla), die sich als Hass, Abneigung, Zorn oder Bosheit manifestiert. Sie ist ein Haupthindernis für die geistige Entwicklung.
[Link zur Hauptseite zu Hass (Dosa)]
Dukkha (Leiden) – Aussprache: Duk-kha
Das zentrale Konzept der ersten Edlen Wahrheit, das die Unzufriedenheit, den Schmerz, das Unbehagen und die grundlegende Unvollkommenheit aller bedingten Existenz beschreibt.
[Link zur Hauptseite zu Leiden (Dukkha)]
H
Hiri & Ottappa (Scham & Scheu) – Aussprache: Hi-ri & Ot-tap-pa
Zwei untrennbare moralische Qualitäten, oft als „Wächter der Welt“ bezeichnet. Hiri ist das innere Schamgefühl vor unheilsamem Tun, Ottappa die gesunde Scheu vor den karmischen Konsequenzen.
[Link zur Hauptseite zu Scham & Scheu (Hiri/Ottappa)]
I
Iddhipādā (Wege zur Geistigen Kraft) – Aussprache: Id-dhi-paa-daa
Die vier Wege zur übernatürlichen Kraft, die durch die Entwicklung von Konzentration und die Beherrschung des Geistes entstehen: Wunsch, Energie, Geist und Untersuchung. Sie sind Teil der 37 Faktoren zur Erleuchtung.
[Link zur Hauptseite zu 37 Faktoren (Bodhipakkhiyādhammā)]
Indriyāni & Balāni (Fähigkeiten & Kräfte) – Aussprache: In-dri-jaa-ni & Ba-laa-ni
Fünf spirituelle Fähigkeiten (Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit) und ihre entsprechenden Kräfte, die entwickelt werden müssen, um den Pfad zur Erleuchtung zu beschreiten.
[Link zur Hauptseite zu 37 Faktoren (Bodhipakkhiyādhammā)]
J
Jarāmaraṇa (Altern/Tod) – Aussprache: Dscha-raa-ma-ra-na
Der natürliche Prozess des Alterns und Sterbens, das letzte Glied in der Kette des Bedingten Entstehens, das als Folge von Geburt (Jāti) auftritt.
[Link zur Hauptseite zu Altern/Tod (Jarāmaraṇa)]
Jāti (Geburt) – Aussprache: Dschaa-ti
Das Erscheinen eines neuen Daseins im Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra), angetrieben durch Werden (Bhava). Es ist das elfte Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Geburt (Jāti)]
Jhāna (Meditative Vertiefungen) – Aussprache: Dschaa-na
Stufen tiefer meditativer Konzentration und Absorption, die durch die Überwindung der fünf Hindernisse und die Entwicklung von Geistessammlung erreicht werden.
[Link zur Hauptseite zu Meditative Vertiefungen (Jhāna)]
K
Kalyāṇamitta (Edle Freundschaft) – Aussprache: Kal-jaa-na-mit-ta
Bezeichnet die spirituelle Freundschaft mit tugendhaften und weisen Personen. Eine solche Freundschaft gilt als wesentliche Unterstützung und Voraussetzung für den Fortschritt auf dem Pfad.
[Link zur Hauptseite zu Edle Freundschaft (Kalyāṇamitta)]
Kāmacchanda (Sinnesverlangen) – Aussprache: Kaa-mat-tschan-da
Eines der fünf Hindernisse, das sich als starkes Verlangen nach Sinnesfreuden manifestiert und den Geist von der Konzentration ablenkt.
[Link zur Hauptseite zu Sinnesverlangen (Kāmacchanda)]
Kāma-rāga (Sinnesbegehren) – Aussprache: Kaa-ma Raa-ga
Das Begehren nach sinnlichen Freuden und Objekten. Es ist die vierte der zehn Fesseln.
[Link zur Hauptseite zu Sinnesbegehren (Kāma-rāga)]
Kāmāsava (Sinnestrieb) – Aussprache: Kaa-maa-sa-wa
Einer der vier Triebe (Āsavas), der das Verlangen nach Sinnesfreuden und -objekten umfasst.
[Link zur Hauptseite zu Triebe (Āsavas)]
Kamma (Handlung) – Aussprache: Kam-ma
Absichtsvolle Handlungen (körperlich, sprachlich, geistig), die entsprechende karmische Folgen im gegenwärtigen oder zukünftigen Leben nach sich ziehen.
[Link zur Hauptseite zu Handlung (Kamma)]
Karuṇā (Mitgefühl) – Aussprache: Ka-ru-naa
Der Wunsch, dass alle Wesen von Leid befreit sein mögen. Es ist eines der vier Unermesslichen.
[Link zur Hauptseite zu Mitgefühl (Karuṇā)]
Kāyānupassanā (Körper) – Aussprache: Kaa-jaa-nu-pas-sa-naa
Die achtsame Betrachtung des Körpers, seiner Haltungen, Aktivitäten und Bestandteile, als eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
[Link zur Hauptseite zu Körper (Kāyānupassanā)]
Khanti (Geduld) – Aussprache: Khan-ti
Die Fähigkeit, Widrigkeiten, Herausforderungen und Unannehmlichkeiten mit Ausdauer und ohne Zorn zu ertragen. Sie ist eine der zehn Vollkommenheiten.
[Link zur Hauptseite zu Geduld (Khanti)]
Kilesa (Geistige Befleckungen) – Aussprache: Ki-le-sa
Mentale Verunreinigungen oder Leiden, wie Gier, Hass, Verblendung, Stolz, Eifersucht, die den Geist trüben und Leid verursachen.
[Link zur Hauptseite zu Geistestrübungen (Kilesa)]
L
Lobha (Gier) – Aussprache: Lo-bha
Eine der drei unheilsamen Wurzeln (Akusala-Mūla), die sich als Verlangen, Anhaftung, Gier oder Begierde manifestiert. Sie ist ein Haupthindernis für die geistige Entwicklung.
[Link zur Hauptseite zu Gier (Lobha)]
Lokadhammā (Acht Weltgesetze) – Aussprache: Lo-ka-dham-maa
Die acht weltlichen Gegebenheiten, denen alle Menschen ausgesetzt sind: Gewinn und Verlust, Ehre und Schande, Lob und Tadel, Glück und Leid. Sie sind Teil der Realität, die ein Praktizierender zu akzeptieren und mit Gleichmut zu begegnen lernt.
[Link zur Hauptseite zu Acht Weltgesetze (Lokadhammā)]
M
Majjhimā Paṭipadā (Mittlerer Weg) – Aussprache: Mad-dschi-maa Pa-ti-pa-daa
Die Praxis, die die beiden Extreme von sinnlicher Gier (Kāmasukhallikānuyoga) und schmerzhafter Selbstkasteiung (Attakilamathānuyoga) vermeidet. Sie führt zu Ruhe, höherer Einsicht und Nibbāna und ist identisch mit dem Edlen Achtfachen Pfad.
[Link zur Hauptseite zu Achtfacher Pfad (Ariya Aṭṭhaṅgika Magga)]
Māna (Dünkel) – Aussprache: Maa-na
Stolz, Arroganz oder das Gefühl der Überlegenheit oder Unterlegenheit im Vergleich zu anderen. Es ist die achte der zehn Fesseln.
[Link zur Hauptseite zu Dünkel (Māna)]
Mettā (Liebende Güte) – Aussprache: Met-taa
Der Wunsch nach dem Wohl und Glück aller Wesen, ohne Ausnahme oder Bedingungen. Es ist eines der vier Unermesslichen.
[Link zur Hauptseite zu Liebende Güte (Mettā)]
Micchā Magga (Falscher Pfad) – Aussprache: Mit-tschaa Mag-ga
Der acht- oder zehnfache Pfad in seiner unheilsamen Ausprägung (z. B. Falsche Ansicht, Falsche Rede). Er führt zu weiterem Leiden und tieferer Verstrickung im Daseinskreislauf, im Gegensatz zum Rechten Pfad (Sammā Magga).
[Link zur Hauptseite zu Achtfacher Pfad (Ariya Aṭṭhaṅgika Magga)]
Middha (Mattheit) – Aussprache: Mid-dha
Teil des Hindernisses Trägheit/Mattheit (Thīna-Middha), das sich als geistige Schwerfälligkeit, Benommenheit und mangelnde Klarheit manifestiert.
[Link zur Hauptseite zu Trägheit/Mattheit (Thīna-Middha)]
Moha (Verblendung) – Aussprache: Mo-ha
Eine der drei unheilsamen Wurzeln (Akusala-Mūla), die sich als Unwissenheit, Täuschung oder geistige Blindheit manifestiert. Sie ist die tiefste Ursache des Leidens.
[Link zur Hauptseite zu Verblendung (Moha)]
Muditā (Mitfreude) – Aussprache: Mu-di-taa
Die Freude am Glück und Erfolg anderer, ohne Neid oder Missgunst. Es ist eines der vier Unermesslichen.
[Link zur Hauptseite zu Mitfreude (Muditā)]
N
Nāma-rūpa (Geist-Körper) – Aussprache: Naa-ma Ruu-pa
Die Einheit von mentalen (Nāma) und physischen (Rūpa) Phänomenen, die untrennbar miteinander verbunden sind und das Individuum bilden. Es ist das vierte Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Geist-Körper (Nāma-rūpa)]
Nekkhamma (Entsagung) – Aussprache: Nek-kham-ma
Der Verzicht auf Sinnesfreuden und weltliche Dinge. Sie ist eine der zehn Vollkommenheiten und unterstützt die Entwicklung des Geistes.
[Link zur Hauptseite zu Entsagung (Nekkhamma)]
Nibbidā (Ernüchterung / Überdruss) – Aussprache: Nib-bi-daa
Ein heilsamer Zustand der Ernüchterung oder des „Satt-Seins“ gegenüber weltlichen Dingen. Er entsteht nicht aus Depression, sondern wenn man durch Weisheit die Vergänglichkeit und Leidhaftigkeit der Phänomene tief erkennt.
[Link zur Hauptseite zu Kette der Befreiung]
Nibbāna (Erlöschung) – Aussprache: Nib-baa-na
Das höchste Ziel im Buddhismus: die völlige Auslöschung von Gier, Hass und Verblendung, das Ende des Leidens und des Kreislaufs der Wiedergeburten.
[Link zur Hauptseite zu Erlöschung (Nibbāna)]
Nirodha (Aufhebung) – Aussprache: Ni-ro-dha
Die dritte der Vier Edlen Wahrheiten, die das Ende oder die Aufhebung des Leidens durch das vollständige Auslöschen von Begehren (Taṇhā) beschreibt.
[Link zur Hauptseite zu Aufhebung (Nirodha)]
Nīvaraṇa (Hindernis / Hemmnis) – Aussprache: Nii-wa-ra-na
Wörtlich „Bedeckung“ oder „Schleier“. Mentale Störfaktoren, die die Klarheit des Geistes trüben, die Weisheit schwächen und das Erreichen von Konzentration (Samādhi) und Einsicht behindern. Meist bezieht sich der Begriff auf die fünf Hindernisse (Pañca Nīvaraṇāni).
[Link zur Hauptseite zu Hindernisse (Pañca Nīvaraṇāni)]
O
Ogha (Flut/Fluten) – Aussprache: O-gha
Vier Fluten, die Wesen in den Saṃsāra ziehen und am Erreichen der Befreiung hindern: die Flut der Sinnlichkeit (kāmogha), der Existenz (bhavogha), der Ansichten (diṭṭhogha) und der Unwissenheit (avijjogha).
[Link zur Hauptseite zu Flut/Fluten (Ogha)]
P
Pañca Khandhā (5 Aggregate) – Aussprache: Pan-tscha Khan-dhaa
Die fünf Daseinsgruppen, aus denen sich die gesamte bedingte Existenz zusammensetzt: Form (Rūpa), Gefühl (Vedanā), Wahrnehmung (Saññā), geistige Formationen (Saṅkhāra) und Bewusstsein (Viññāṇa). Sie sind das Objekt der Einsicht, da sie vergänglich, leidvoll und ohne Selbst sind.
[Link zur Hauptseite zu 5 Aggregate (Pañca Khandhā)]
Pañca Nīvaraṇāni (5 Hindernisse) – Aussprache: Pan-tscha Nii-wa-ra-naa-ni
Fünf mentale Hindernisse, die den Geist trüben und die Entwicklung von Konzentration und Einsicht behindern: Sinnesverlangen, Übelwollen, Trägheit/Mattheit, Unruhe/Sorge und Zweifel.
[Link zur Hauptseite zu Hindernisse (Pañca Nīvaraṇāni)]
Pañca Sīlāni (Fünf Übungsregeln) – Aussprache: Pan-tscha Sii-laa-ni
Die fünf ethischen Richtlinien, die Laienbuddhisten beachten, um heilsames Verhalten zu fördern: Nicht-Töten, Nicht-Stehlen, Vermeiden von sexuellem Fehlverhalten, Nicht-Lügen, Verzicht auf berauschende Mittel.
[Link zur Hauptseite zu Fünf Übungsregeln (Pañca Sīlāni)]
Paññā (Weisheit) – Aussprache: Pan-njaa
Das direkte, intuitive Verstehen der Realität, insbesondere der Vier Edlen Wahrheiten und der drei Daseinsmerkmale. Sie ist eine der zehn Vollkommenheiten und ein zentraler Aspekt des Achtfachen Pfades.
[Link zur Hauptseite zu Weisheit (Paññā)]
Papañca (Gedankenwuchern) – Aussprache: Pa-pan-tscha
Das Überwuchern von Gedanken, mentalen Ausbreitungen oder konzeptueller Ausbreitung, die zu Anhaftung, Verwirrung und Leid führen.
[Link zur Hauptseite zu Gedankenwuchern (Papañca)]
Paṭikkūlamanasikāra (Betrachtung des Widerwärtigen) – Aussprache: Pa-tik-kuu-la-ma-na-si-kaa-ra
Die analytische Zerlegung des Körpers in seine 32 Bestandteile (wie Haare, Fleisch, Knochen etc.), um die Wahrnehmung von Schönheit zu dekonstruieren und sinnliches Begehren zu überwinden.
[Link zur Hauptseite zu Spezifische Meditationen]
Phala (Frucht) – Aussprache: Pha-la
Der Moment der „Frucht“ oder Verwirklichung, der unmittelbar auf den Pfad-Moment (Magga) einer Erleuchtungsstufe folgt. Es ist das Resultat des Durchbrechens von Fesseln.
[Link zur Hauptseite zu Frucht des Pfades]
Phassa (Kontakt / Berührung) – Aussprache: Phas-sa
Das Zusammentreffen von drei Faktoren: Sinnesorgan, Sinnesobjekt und Bewusstsein. Phassa ist die notwendige Bedingung für das Entstehen von Gefühl (Vedanā) und Wahrnehmung (Saññā).
[Link zur Hauptseite zu Kontakt (Phassa)]
Pāramī (10 Vollkommenheiten) – Aussprache: Paa-ra-mii
Zehn Eigenschaften oder Qualitäten, die über viele Leben hinweg entwickelt werden müssen, um ein Buddha zu werden: Geben, Tugend, Entsagung, Weisheit, Energie, Geduld, Wahrhaftigkeit, Entschlossenheit, liebende Güte und Gleichmut.
[Link zur Hauptseite zu 10 Vollkommenheiten (Pāramī)]
Pariyatti (Theorie) – Aussprache: Pa-ri-jat-ti
Der theoretische Aspekt der buddhistischen Lehre, das Studium der Schriften und das intellektuelle Verständnis der Konzepte.
[Link zur Hauptseite zu Theorie, Praxis, Ziel (Pariyatti, Paṭipatti, Paṭivedha)]
Passaddhi (Ruhe) – Aussprache: Pas-sad-dhi
Die körperliche und geistige Ruhe und Entspannung, die in meditativen Zuständen auftritt. Es ist das fünfte der sieben Erleuchtungsglieder.
[Link zur Hauptseite zu Ruhe (Passaddhi)]
Paṭiccasamuppāda (Bedingtes Entstehen) – Aussprache: Pa-tit-tscha-sa-mup-paa-da
Die buddhistische Lehre über die Entstehung des Leidens und seine Aufhebung, die zwölf miteinander verknüpfte Glieder umfasst. Sie erklärt, wie alle Phänomene voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.
[Link zur Hauptseite zu Bedingtes Entstehen (Paṭiccasamuppāda)]
Paṭipatti (Praxis) – Aussprache: Pa-ti-pat-ti
Der praktische Aspekt der buddhistischen Lehre, das Befolgen der moralischen Regeln und die Kultivierung der Meditation.
[Link zur Hauptseite zu Theorie, Praxis, Ziel (Pariyatti, Paṭipatti, Paṭivedha)]
Paṭivedha (Ziel) – Aussprache: Pa-ti-wee-dha
Das Ziel oder die Verwirklichung der Lehre, d.h. die direkte Erfahrung und das Erreichen der Erleuchtung (Nibbāna).
[Link zur Hauptseite zu Theorie, Praxis, Ziel (Pariyatti, Paṭipatti, Paṭivedha)]
Phassa (Kontakt) – Aussprache: Phas-sa
Das Zusammentreffen von Sinnesorgan, Sinnesobjekt und Bewusstsein, das die Grundlage für die Entstehung von Gefühl (Vedanā) bildet. Es ist das sechste Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Kontakt (Phassa)]
Pīti (Freude) – Aussprache: Pii-ti
Ekstatische Freude oder Wonne, die als Faktor in meditativen Vertiefungen (Jhāna) auftreten kann. Es ist das vierte der sieben Erleuchtungsglieder.
[Link zur Hauptseite zu Freude (Pīti)]
Puñña (Verdienst) – Aussprache: Pun-nja
Die karmische „Frucht“ oder Energie, die aus heilsamen Taten (wie Geben, Tugend, Meditation) entsteht. Puñña reinigt den Geist und führt zu glücklichen Daseinszuständen und günstigen Umständen für die Praxis.
[Link zur Hauptseite zu Praxis des Gebens (Dāna)]
Punabbhava (Wiedergeburt) – Aussprache: Pu-nab-bha-wa
Der kontinuierliche Prozess des Werdens und Wieder-Werdens in verschiedenen Daseinsbereichen, angetrieben durch Karma und Anhaftung.
[Link zur Hauptseite zu Wiedergeburt (Punabbhava)]
R
Rūpa (Form) – Aussprache: Ruu-pa
Das materielle Element, das den Körper und äußere Phänomene umfasst. Es ist das erste der fünf Aggregate.
[Link zur Hauptseite zu Form (Rūpa)]
Rūpa-rāga (Form-Begehren) – Aussprache: Ruu-pa Raa-ga
Das Begehren nach Existenz in feinstofflichen Daseinsebenen oder die Anhaftung an Zustände der materiellen Jhānas. Es ist die sechste der zehn Fesseln.
[Link zur Hauptseite zu Form-Begehren (Rūpa-rāga)]
S
Sacca (Wahrhaftigkeit) – Aussprache: Sat-tscha
Die Praxis der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Integrität in Gedanken, Worten und Taten. Sie ist eine der zehn Vollkommenheiten.
[Link zur Hauptseite zu Wahrhaftigkeit (Sacca)]
Saddhā (Vertrauen) – Aussprache: Sad-dhaa
Das vertrauensvolle Zutrauen in den Buddha, seine Lehre (Dhamma) und seine Gemeinschaft (Saṅgha), das als Grundlage für die Praxis dient.
[Link zur Hauptseite zu Vertrauen (Saddhā)]
Sakkāya (Persönlichkeit / Daseinsgruppe) – Aussprache: Sak-kaa-ja
Bezeichnung für die fünf Daseinsgruppen des Anhaftens (Upādānakkhandhā), die vom ungeschulten Geist fälschlicherweise als „Selbst“ oder „Person“ identifiziert werden. Die Überwindung dieser Sichtweise ist der erste Schritt zur Erleuchtung.
[Link zur Hauptseite zu Ich-Glaube (Sakkāya-diṭṭhi)]
Sakkāya-diṭṭhi (Ich-Glaube) – Aussprache: Sak-kaa-ja Dit-thi
Der Glaube an ein permanentes, unveränderliches „Ich“ oder eine Seele. Es ist die erste und grundlegendste der zehn Fesseln, deren Überwindung am Beginn des Pfades steht.
[Link zur Hauptseite zu Ich-Glaube (Sakkāya-diṭṭhi)]
Saḷāyatana (6 Sinne) – Aussprache: Sa-laa-ja-ta-na
Die sechs Sinnesgrundlagen: Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist, die den Kontakt mit den entsprechenden Sinnesobjekten herstellen. Es ist das fünfte Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu 6 Sinne (Saḷāyatana)]
Samādhi (Sammlung) – Aussprache: Sa-maa-dhi
Geistige Konzentration und Sammlung, die zur Entwicklung von meditativen Vertiefungen (Jhāna) führt. Es ist das sechste der sieben Erleuchtungsglieder und ein zentraler Aspekt des Achtfachen Pfades.
[Link zur Hauptseite zu Sammlung (Samādhi)]
Sammā Ājīva (Rechter Lebenserwerb) – Aussprache: Sam-maa Aa-dschii-wa
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf das Verdienen des Lebensunterhalts auf ethische Weise bezieht, ohne anderen zu schaden.
[Link zur Hauptseite zu Rechter Lebenserwerb (Sammā Ājīva)]
Samatha-Bhāvanā (Ruhe-Meditation) – Aussprache: Sa-ma-tha Bhaa-wa-naa
Eine Art der Meditation, die darauf abzielt, den Geist zu beruhigen und Konzentration zu entwickeln, oft durch Atemachtsamkeit.
[Link zur Hauptseite zu Ruhe-Meditation (Samatha-Bhāvanā)]
Sammā Diṭṭhi (Rechte Ansicht) – Aussprache: Sam-maa Dit-thi
Der erste Faktor des Achtfachen Pfades. Sie beinhaltet das korrekte Verständnis der Vier Edlen Wahrheiten, des Gesetzes von Kamma und der Unbeständigkeit aller Phänomene.
[Link zur Hauptseite zu Rechte Ansicht (Sammā Diṭṭhi)]
Sammā Kammanta (Rechtes Handeln) – Aussprache: Sam-maa Kam-man-ta
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf ethisches körperliches Handeln bezieht, insbesondere das Vermeiden von Töten, Stehlen und sexuellem Fehlverhalten.
[Link zur Hauptseite zu Rechtes Handeln (Sammā Kammanta)]
Sammā Saṅkappa (Rechter Entschluss) – Aussprache: Sam-maa Sang-kap-pa
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf reine Absichten, den Entschluss zu Entsagung, Wohlwollen und Gewaltlosigkeit bezieht.
[Link zur Hauptseite zu Rechter Entschluss (Sammā Saṅkappa)]
Sammā Sati (Rechte Achtsamkeit) – Aussprache: Sam-maa Sa-ti
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf die Entwicklung von Achtsamkeit auf Körper, Gefühle, Geist und Geistobjekte bezieht.
[Link zur Hauptseite zu Rechte Achtsamkeit (Sammā Sati)]
Sammā Samādhi (Rechte Sammlung) – Aussprache: Sam-maa Sa-maa-dhi
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf die Entwicklung tiefer meditativer Konzentration (Jhāna) bezieht.
[Link zur Hauptseite zu Rechte Sammlung (Sammā Samādhi)]
Sammā Vācā (Rechte Rede) – Aussprache: Sam-maa Waa-tschaa
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf ethisches Sprechen bezieht, insbesondere das Vermeiden von Lügen, Verleumdung, grober Rede und leerem Geschwätz.
[Link zur Hauptseite zu Rechte Rede (Sammā Vācā)]
Sammā Vāyāma (Rechte Anstrengung) – Aussprache: Sam-maa Waa-jaa-ma
Einer der Aspekte des Achtfachen Pfades, der sich auf die vier rechten Anstrengungen bezieht: das Entstehen von Unheilsamem verhindern, bestehendes Unheilsames überwinden, Entstehen von Heilsamem fördern und bestehendes Heilsames aufrechterhalten.
[Link zur Hauptseite zu Rechte Anstrengung (Sammā Vāyāma)]
Sammappadhānā (Anstrengungen) – Aussprache: Sam-map-pa-dhaa-naa
Die vier Rechten Anstrengungen, die als Faktoren zur Erleuchtung gehören: das Entstehen von Unheilsamem verhindern, bestehendes Unheilsames überwinden, Entstehen von Heilsamem fördern und bestehendes Heilsames aufrechterhalten.
[Link zur Hauptseite zu 37 Faktoren (Bodhipakkhiyādhammā)]
Sampajañña (Klares Verstehen / Wissensklarheit) – Aussprache: Sam-pa-dschan-nja
Die klare, verstehende Bewusstheit, die stets mit Achtsamkeit (Sati) einhergehen sollte. Sie prüft den Zweck, die Eignung und die Realität einer Handlung oder Situation.
[Link zur Hauptseite zu Klares Verstehen (Sampajañña)]
Sammuti & Paramattha Sacca (Wirklichkeiten) – Aussprache: Sam-mu-ti & Pa-ra-mat-tha Sat-tscha
Die Unterscheidung zwischen der konventionellen Wahrheit (Sammuti Sacca), die sich auf alltägliche Konzepte und Bezeichnungen bezieht, und der absoluten oder höchsten Wahrheit (Paramattha Sacca), die die Realität jenseits von Konzepten beschreibt.
[Link zur Hauptseite zu Wirklichkeiten (Sammuti & Paramattha Sacca)]
Saṃsāra (Kreislauf) – Aussprache: San-saa-ra
Der endlose Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt, der durch Gier, Hass und Verblendung aufrechterhalten wird, bis Nibbāna erreicht ist.
[Link zur Hauptseite zu Kreislauf (Saṃsāra)]
Saṁvega (Spirituelle Dringlichkeit) – Aussprache: San-we-ga
Ein motivierendes Gefühl der Erschütterung oder ernüchternden Dringlichkeit, das entsteht, wenn man die Gefahren und die Sinnlosigkeit des endlosen Daseinskreislaufs (Saṃsāra) tief erkennt. Es ist kein Pessimismus, sondern der energetische Impuls, der zur ernsthaften Praxis und zur Suche nach einem Ausweg antreibt.
[Link zur Hauptseite zu Spirituelle Dringlichkeit (Saṁvega)]
Samudaya (Ursache) – Aussprache: Sa-mu-da-ja
Die zweite der Vier Edlen Wahrheiten, die die Ursache des Leidens beschreibt: das Begehren (Taṇhā).
[Link zur Hauptseite zu Ursache (Samudaya)]
Saṅgha (Gemeinschaft) – Aussprache: Sang-gha
Die Gemeinschaft der Praktizierenden, die den Pfad des Buddha beschreiten. Es ist das dritte der Drei Juwelen.
[Link zur Hauptseite zu Gemeinschaft (Saṅgha)]
Saṅkhāra (Formationen) – Aussprache: Sang-khaa-ra
Alle willentlichen, karmischen Formationen oder Konditionierungen, die aus Unwissenheit entstehen und zu weiterem Werden führen. Es ist das vierte der fünf Aggregate und das zweite Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Formationen (Saṅkhāra)]
Saññā (Wahrnehmung) – Aussprache: San-njaa
Die Fähigkeit des Geistes, Objekte zu identifizieren, zu erkennen und zu kategorisieren. Es ist das dritte der fünf Aggregate.
[Link zur Hauptseite zu Wahrnehmung (Saññā)]
Sati (Achtsamkeit) – Aussprache: Sa-ti
Das klare, aufmerksame und nicht-wertende Gewahrsein des gegenwärtigen Moments, der eigenen Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und externen Phänomene. Sie ist ein zentrales Glied des Achtfachen Pfades und der Erleuchtungsglieder.
[Link zur Hauptseite zu Achtsamkeit (Sati)]
Satipaṭṭhāna (Achtsamkeitsgrundlagen) – Aussprache: Sa-ti-pat-thaa-na
Die vier Bereiche, auf die sich die Achtsamkeitspraxis konzentriert: Körper, Gefühle, Geist und Geistobjekte. Die konsequente Übung der Achtsamkeitsgrundlagen führt zur Entwicklung von Einsicht und Befreiung.
[Link zur Hauptseite zu Achtsamkeitsgrundlagen (Satipaṭṭhāna)]
Satta Bojjhaṅgā (7 Erleuchtungsglieder) – Aussprache: Sat-ta Bod-dschang-gaa
Sieben Faktoren, die zur Erleuchtung führen: Achtsamkeit, Dhamma-Untersuchung, Energie, Freude, Ruhe, Sammlung und Gleichmut.
[Link zur Hauptseite zu 7 Erleuchtungsglieder (Satta Bojjhaṅgā)]
Sīla (Tugend) – Aussprache: Sii-la
Ethische und moralische Reinheit, die sich in rechtem körperlichen, sprachlichen und geistigen Handeln manifestiert. Sie ist eine der zehn Vollkommenheiten und die Grundlage für die Entwicklung von Konzentration und Weisheit.
[Link zur Hauptseite zu Tugend (Sīla)]
Sīlabbata-parāmāsa (Riten-Anhaftung) – Aussprache: Sii-lab-ba-ta Pa-raa-maa-sa
Die Anhaftung an bloße Riten und Rituale oder das Festhalten an moralischen Regeln als Selbstzweck, ohne das tiefere Verständnis ihrer spirituellen Bedeutung. Es ist die dritte der zehn Fesseln.
[Link zur Hauptseite zu Riten-Anhaftung (Sīlabbata-parāmāsa)]
Sīvathikā (Leichenfeld-Betrachtung) – Aussprache: Sii-wa-thi-kaa
Die Kontemplation über verschiedene Stadien der Verwesung eines Leichnams. Diese Übung dient der tiefen Verinnerlichung der Vergänglichkeit und der unausweichlichen Natur des eigenen Körpers.
[Link zur Hauptseite zu Spezifische Meditationen]
Sotāpanna (Stromeingetretener) – Aussprache: So-taa-pan-na
Ein Edler Schüler, der die erste Stufe der Erleuchtung erreicht hat. Er hat die ersten drei Fesseln überwunden, besitzt unerschütterliches Vertrauen in die Drei Juwelen und wird höchstens noch siebenmal wiedergeboren.
[Link zur Hauptseite zu Pfad zum Stromeintritt]
Suññatā (Leerheit) – Aussprache: Sun-nja-taa
Das Konzept, dass alle Phänomene ohne inhärentes, dauerhaftes Selbst oder Substanz sind. Es betont die bedingte Natur aller Existenz.
[Link zur Hauptseite zu Leerheit (Suññatā)]
T
Taṇhā (Begehren) – Aussprache: Tan-haa
Ein starkes Verlangen oder Durst, das in drei Formen auftritt: Verlangen nach Sinnesfreuden (kāma-taṇhā), Verlangen nach Existenz (bhava-taṇhā) und Verlangen nach Nicht-Existenz (vibhava-taṇhā). Es ist die Ursache des Leidens (Dukkha) und das achte Glied in der Kette des Bedingten Entstehens.
[Link zur Hauptseite zu Begehren (Taṇhā)]
Thīna-Middha (Trägheit/Mattheit) – Aussprache: Thii-na Mid-dha
Eines der fünf Hindernisse, das sich als geistige Trägheit, Stumpfheit, Schläfrigkeit und ein Mangel an Energie manifestiert.
[Link zur Hauptseite zu Trägheit/Mattheit (Thīna-Middha)]
Ti-Ratana (Drei Juwelen) – Aussprache: Ti Ra-ta-na
Die drei Zufluchten im Buddhismus: der Buddha (der Erwachte), der Dhamma (seine Lehre) und der Saṅgha (die Gemeinschaft der Praktizierenden).
[Link zur Hauptseite zu Drei Juwelen (Ti-Ratana)]
Ti-sikkhā (Drei Schulungen) – Aussprache: Ti Sik-khaa
Die drei Hauptbereiche der buddhistischen Praxis: die Schulung in Moral (Sīla), die Schulung in Konzentration (Samādhi) und die Schulung in Weisheit (Paññā).
[Link zur Hauptseite zu Drei Schulungen (Ti-sikkhā)]
Tisso Sikkhā (Drei Schulungen) – Aussprache: Tis-so Sik-khaa
Die drei Hauptbereiche der buddhistischen Praxis: Höhere Sittlichkeit (Adhisīla), Höhere Geisteskonzentration (Adhicitta) und Höhere Weisheit (Adhipaññā). Sie fassen den Achtfachen Pfad zusammen.
[Link zur Hauptseite zu Drei Schulungen (Ti-sikkhā)]
Tilakkhaṇa (3 Daseinsmerkmale) – Aussprache: Ti-lak-kha-na
Die drei universellen Merkmale aller bedingten Existenz: Vergänglichkeit (Anicca), Leiden (Dukkha) und Nicht-Selbst (Anattā). Das tiefe Verständnis dieser Merkmale führt zur Befreiung.
[Link zur Hauptseite zu 3 Daseinsmerkmale (Tilakkhaṇa)]
U
Uddhacca (Ruhelosigkeit) – Aussprache: Ud-dhat-tscha
Eines der zehn Fesseln und Bestandteil des vierten der fünf Hindernisse (Unruhe/Sorge), das sich als geistige Unruhe, Aufregung oder Zerstreuung manifestiert.
[Link zur Hauptseite zu Ruhelosigkeit (Uddhacca)]
Uddhacca-Kukkucca (Unruhe/Sorge) – Aussprache: Ud-dhat-tscha Kuk-kut-tscha
Eines der fünf Hindernisse, bestehend aus Ruhelosigkeit (Uddhacca) und Gewissensbissen/Reue (Kukkucca), das den Geist daran hindert, ruhig und gesammelt zu sein.
[Link zur Hauptseite zu Unruhe/Sorge (Uddhacca-Kukkucca)]
Upādāna (Anhaften) – Aussprache: U-paa-daa-na
Ein intensives Festhalten an Begehren, Ansichten, Riten und Ritualen oder dem Konzept des Selbst. Es ist das neunte Glied im Bedingten Entstehen und führt zum Werden (Bhava).
[Link zur Hauptseite zu Anhaften (Upādāna)]
Upāya (Geschickte Mittel) – Aussprache: U-paa-ja
Der Einsatz von Fähigkeiten und Methoden, um die Lehre an die Bedürfnisse und das Verständnis verschiedener Individuen anzupassen und sie auf dem Pfad zu unterstützen.
[Link zur Hauptseite zu Geschickte Mittel (Upāya)]
Upekkhā (Gleichmut) – Aussprache: U-pek-khaa
Die Geisteshaltung der Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Neutralität gegenüber allen Erfahrungen, ohne Anhaftung oder Abneigung. Es ist eines der vier Unermesslichen und das siebte der sieben Erleuchtungsglieder.
[Link zur Hauptseite zu Gleichmut (Upekkhā)]
Uposatha (Uposatha-Tag) – Aussprache: U-po-sa-tha
Ein besonderer Tag im buddhistischen Kalender (oft an Vollmond und Neumond), an dem Laien und Mönche sich stärker der Dharma-Praxis widmen, die Übungsregeln befolgen und die Lehre studieren.
[Link zur Hauptseite zu Uposatha-Tag (Uposatha)]
V
Vedanā (Gefühl) – Aussprache: We-da-naa
Die Empfindung von Angenehmem, Unangenehmem oder Neutralem, die aus dem Kontakt der Sinne mit ihren Objekten entsteht. Es ist das zweite der fünf Aggregate und das siebte Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Gefühl (Vedanā)]
Vedanānupassanā (Gefühle) – Aussprache: We-da-naa-nu-pas-sa-naa
Die achtsame Betrachtung der Gefühle (angenehm, unangenehm, neutral), ihrer Natur und ihres Entstehens und Vergehens, als eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
[Link zur Hauptseite zu Gefühle (Vedanānupassanā)]
Vicikicchā (Zweifel) – Aussprache: Wi-tschi-kit-tschaa
Eines der fünf Hindernisse und die zweite der zehn Fesseln, das sich als Ungewissheit, Skepsis oder Mangel an Vertrauen in die Lehre oder den Pfad manifestiert.
[Link zur Hauptseite zu Zweifel (Vicikicchā)]
Vimutti (Befreiung) – Aussprache: Wi-mut-ti
Die endgültige Erlösung von Leid, die durch das vollständige Auslöschen aller Geistesbefleckungen und das Erreichen des Nibbāna erfolgt.
[Link zur Hauptseite zu Befreiung (Vimutti)]
Viññāṇa (Bewusstsein) – Aussprache: Win-njaa-na
Die Fähigkeit des Geistes, Objekte über die sechs Sinne wahrzunehmen und zu erkennen. Es ist das fünfte der fünf Aggregate und das dritte Glied im Bedingten Entstehen.
[Link zur Hauptseite zu Bewusstsein (Viññāṇa)]
Vipassanā-Bhāvanā (Einsichts-Meditation) – Aussprache: Wi-pas-sa-naa Bhaa-wa-naa
Eine Art der Meditation, die darauf abzielt, die wahre Natur der Realität (die drei Daseinsmerkmale) durch direkte Beobachtung zu erkennen und Einsicht zu entwickeln.
[Link zur Hauptseite zu Einsichts-Meditation (Vipassanā-Bhāvanā)]
Virāga (Loslösung / Entsüchtigen) – Aussprache: Wi-raa-ga
Das Schwinden, Verblassen oder Aufhören des Begehrens (Taṇhā) und der Leidenschaft. Virāga ist die direkte Folge der Ernüchterung (Nibbidā) und oft ein Synonym für den Pfad zur Befreiung oder Nibbāna selbst.
[Link zur Hauptseite zu Kette der Befreiung]
Vīriya (Energie) – Aussprache: Wii-ri-ja
Die zielgerichtete Anstrengung, Ausdauer und Entschlossenheit auf dem buddhistischen Pfad. Es ist das dritte der sieben Erleuchtungsglieder.
[Link zur Hauptseite zu Energie (Vīriya)]
Y
Yoga (Joch / Anschirrung) – Aussprache: Joo-ga
Metaphorischer Begriff für das „Joch“, das Lebewesen an den Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) fesselt, vergleichbar mit einem Zugtier vor dem Karren. Es werden vier Arten unterschieden: Sinnlichkeit, Werden, Ansichten und Unwissenheit.
[Link zur Hauptseite zu Die vier Yogas (Joche)]
Yoniso manasikāra (Weise Betrachtung) – Aussprache: Jo-ni-so Ma-na-si-kaa-ra
Die Fähigkeit des Geistes, Phänomene sorgfältig und systematisch zu analysieren, um ihre wahre Natur zu verstehen, anstatt sie oberflächlich oder verzerrt wahrzunehmen.
[Link zur Hauptseite zu Weise Betrachtung (Yoniso manasikāra)]
Begriffe und Konzepte gezielt finden 🧭
Eine Anleitung für deine Recherche
Dieser Bereich ist eine umfangreiche Schatzkiste zentraler buddhistischer Lehren. Um schnell und präzise den gesuchten Begriff, das Konzept oder die dazugehörigen Lehrreden zu finden, kannst du diese Suchfunktion als dein persönliches Nachschlagewerk nutzen.
Um deine Suche so fruchtbar wie möglich zu gestalten, findest du hier einige einfache, aber wirkungsvolle Tipps.
So funktioniert die Suche
Die Suchfunktion ist darauf ausgelegt, dir präzise Ergebnisse zu liefern. Du kannst deine Suche durch die Kombination von Begriffen und die Verwendung einfacher Operatoren verfeinern:
- Mehrere Begriffe (UND-Suche): Wenn du mehrere Wörter eingibst (z. B.
Bedingtes Entstehen), sucht das System nach Inhalten, die alle diese Begriffe enthalten. Je mehr Begriffe du hinzufügst, desto spezifischer wird das Ergebnis. - Genaue Wortgruppen (Phrasensuche): Um nach einer exakten Wortfolge zu suchen, setze diese in Anführungszeichen. Die Suche nach
"Sieben Erleuchtungsglieder"liefert nur Ergebnisse, in denen genau diese Wortgruppe vorkommt. - Begriffe ausschließen (NICHT-Suche): Du kannst Ergebnisse ausschließen, die ein bestimmtes Wort enthalten, indem du ein Minuszeichen (
-) direkt vor den Begriff setzt (ohne Leerzeichen). Die Suche nachLeiden -Wurzelnfindet beispielsweise alle Texte über das Leiden, schließt aber jene aus, die spezifisch die „Wurzeln des Leidens“ behandeln.
Beispiele für deine Suche
- Suche nach einem Pāli-Begriff:
Satta BojjhaṅgāoderPaṭiccasamuppāda - Suche nach der deutschen Übersetzung:
"Drei Daseinsmerkmale"oderZehn Fesseln - Suche nach einem Konzept aus dem Lernpfad:
Edle FreundschaftoderWeise Betrachtung - Verfeinerte Suche nach einem Thema:
Befreiung -Fesseln
Viel Freude und wertvolle Einsichten beim Erforschen der Lehre!







