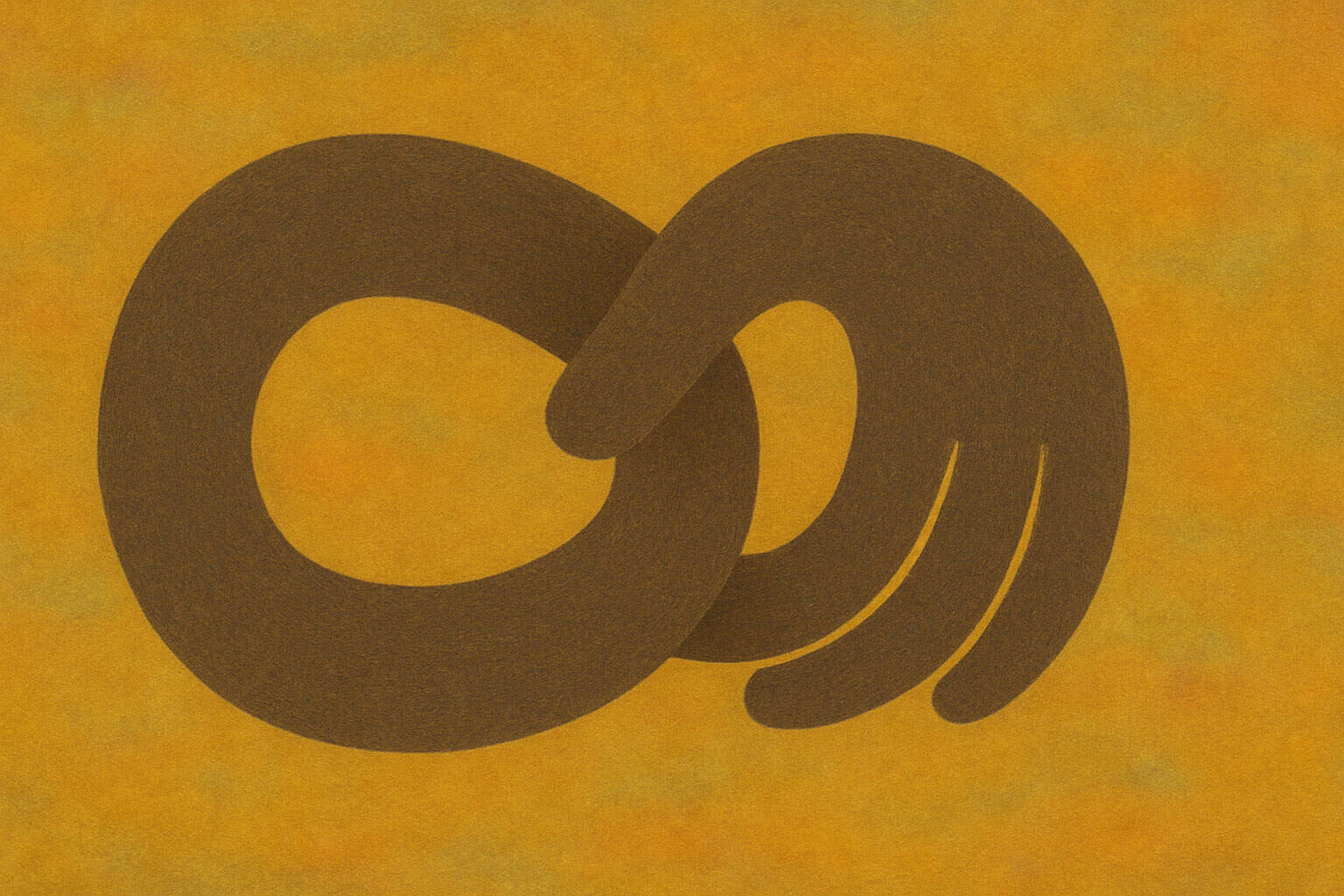
Taṇhā – Durst, Gier und Verlangen im frühen Buddhismus
Die Ursache des Leidens: Eine Analyse der drei Arten von Taṇhā und ihrer Rolle im Bedingten Entstehen
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Das Verständnis zentraler Begriffe aus der Sprache des Buddha, dem Pāli, ist ein Schlüssel zum tieferen Erfassen seiner Lehre. Einer dieser Kernbegriffe ist Taṇhā. Oft mit „Gier“, „Verlangen“ oder „Begehren“ übersetzt, identifiziert der Buddha Taṇhā als die entscheidende Kraft, die uns im leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) gefangen hält. Dieser Bericht möchte den Begriff Taṇhā beleuchten: seine Bedeutung, seine verschiedenen Formen und seine zentrale Rolle in den buddhistischen Lehren vom Leiden (Dukkha) und dessen Überwindung. Ziel ist es, sowohl Neueinsteigern als auch Lesern mit Vorkenntnissen eine fundierte Erklärung zu bieten und sie durch gezielte Verweise auf Lehrreden (Suttas) aus dem Pāli-Kanon zu einem vertieften Studium anzuregen. Als Hauptquelle für Sutta-Referenzen dient dabei die Online-Ressource SuttaCentral.net bzw. für Erklärungen das Lehrreden-Verzeichnis dieser Seite.
2. Was ist Taṇhā? Definition und Erklärung
Wörtliche Bedeutung und Übersetzung
Das Pāli-Wort Taṇhā (Sanskrit: Tṛṣṇā) Aussprache: Tan-haa (Skt: Trisch-naa) bedeutet wörtlich „Durst“. Diese ursprüngliche Bedeutung verweist auf ein starkes, drängendes Verlangen, ähnlich dem physischen Durst nach Wasser. Im buddhistischen Kontext meint Taṇhā jedoch primär einen tiefgreifenden mentalen Durst – ein unaufhörliches Verlangen, eine Gier oder Sucht, die sich auf Objekte, Erfahrungen, Zustände oder auch Ideen richten kann.
Gängige deutsche Übersetzungen wie „Gier“, „Verlangen“ oder „Begehren“ treffen Aspekte von Taṇhā, doch keine erfasst die volle Konnotation. „Durst“ oder das englische „craving“ betonen stärker den leidvollen, oft unstillbaren und problematischen Charakter dieses mentalen Zustands, der im Zentrum der buddhistischen Analyse des Leidens steht. Es geht nicht um jeden Wunsch, sondern um ein spezifisches, oft zwanghaftes Begehren, das Leiden erzeugt.
Die Natur von Taṇhā
Taṇhā ist mehr als nur ein flüchtiger Wunsch; es ist ein tief verwurzelter Geisteszustand, der oft reflexhaft und unbewusst operiert. Es ist die treibende Kraft hinter dem Anhaften (Upādāna) und damit der Motor, der den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) in Gang hält. Es ist wichtig zu verstehen, dass Taṇhā nicht jeden Wunsch meint. Heilsame Wünsche, wie der Wunsch nach Befreiung, nach dem Wohl anderer oder nach ethischem Handeln, werden im Buddhismus positiv bewertet und sind von Taṇhā zu unterscheiden. Taṇhā bezeichnet spezifisch das egozentrische, auf Unwissenheit (Avijjā oder Moha) basierende Verlangen.
Diese Unwissenheit ist die tiefste Wurzel, aus der Taṇhā entspringt. Taṇhā selbst manifestiert sich oft in Form von Gier/Anhaftung (Rāga) oder Abneigung/Hass (Dosa). Diese drei – Gier, Hass und Verblendung/Unwissenheit – werden auch als die „Drei Geistesgifte“ bezeichnet, wobei Taṇhā eng mit Gier und Hass verbunden ist und aus der grundlegenden Unwissenheit über die wahre Natur der Realität (vor allem Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst) genährt wird. Der „Durst“ des Taṇhā ist deshalb so problematisch, weil er sich auf Phänomene richtet, die ihrer Natur nach unbeständig (Anicca), unbefriedigend (Dukkha) und ohne einen festen Wesenskern (Anattā) sind. Das Verlangen nach etwas Vergänglichem führt unweigerlich zu Enttäuschung und Leid, wenn sich das Objekt des Verlangens verändert oder vergeht.
Die drei Formen von Taṇhā
Der Buddha unterschied drei Hauptformen des Verlangens, die alle Aspekte unseres Daseins durchdringen:
- Kāma-Taṇhā (Verlangen nach Sinnesfreuden): Dies ist das Verlangen nach angenehmen Erfahrungen durch die sechs Sinne – Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken. Es umfasst die Gier nach schönen Formen, angenehmen Klängen, wohlriechenden Düften, köstlichem Geschmack, angenehmen Berührungen und auch nach anziehenden Ideen, Konzepten oder geistigen Zuständen (Dhamma-Taṇhā). Es ist der Wunsch nach sinnlicher Befriedigung und Genuss.
- Bhava-Taṇhā (Verlangen nach Sein/Existenz): Dies ist das tief sitzende Verlangen, zu existieren, zu sein, zu werden. Es ist der Wunsch nach Fortdauer, nach einer festen Identität, nach einem ewigen Selbst. Dieses Verlangen ist eng mit dem Ego und dem Streben nach Selbsterhaltung verbunden. Es wurzelt oft in der falschen Ansicht des Eternalismus (Sassatadiṭṭhi) – dem Glauben an eine unveränderliche, ewige Seele oder ein dauerhaftes Selbst. Dieses Verlangen treibt den Wunsch nach Wiedergeburt an, sei es in dieser Welt oder in feineren Daseinsbereichen.
- Vibhava-Taṇhā (Verlangen nach Nicht-Sein/Vernichtung): Dies ist das Verlangen, nicht zu sein, unangenehme Erfahrungen, schmerzhafte Gefühle, unerwünschte Situationen oder gar die eigene Existenz loszuwerden. Es ist eng verbunden mit Abneigung, Hass (Dosa) und der falschen Ansicht des Annihilationismus (Ucchedadiṭṭhi) – dem Glauben, dass mit dem Tod alles endet und keine Wiedergeburt stattfindet. Dieses Verlangen kann sich in extremen Formen wie Selbsthass oder Suizidgedanken äußern.
Wichtig ist, dass Vibhava-Taṇhā nicht mit dem buddhistischen Ziel des Nibbāna (Verlöschen) verwechselt wird. Nibbāna ist das Ende des Leidens durch das Verlöschen der Ursachen (Gier, Hass, Verblendung), während Vibhava-Taṇhā eine reaktive, auf Leid und falscher Sicht basierende Ablehnung der Existenz ist, die paradoxerweise zu weiterer Wiedergeburt führen kann.
Diese drei Formen des „Durstes“ offenbaren eine tiefe psychologische Einsicht: Sie spiegeln grundlegende menschliche Ängste und Begierden wider, die oft mit tief verwurzelten philosophischen Überzeugungen über das Selbst und die Welt zusammenhängen. Kāma-Taṇhā repräsentiert die Anhaftung an vergängliche Freuden. Bhava-Taṇhā spiegelt die Angst vor dem Nichts und den Wunsch nach Beständigkeit wider, oft verbunden mit eternalistischen Weltbildern. Vibhava-Taṇhā hingegen zeigt die Reaktion auf unerträgliches Leid und die Hoffnung auf Auslöschung, oft verbunden mit annihilationistischen oder materialistischen Weltbildern. Das Verständnis dieser drei Aspekte zeigt, dass Taṇhā weit über oberflächliche Wünsche hinausgeht und tief in unserer existenziellen Verfasstheit wurzelt.
3. Taṇhā im Kontext zentraler buddhistischer Lehren
Taṇhā steht nicht isoliert, sondern ist in zwei der wichtigsten Lehrgebäude des frühen Buddhismus eingebettet: die Vier Edlen Wahrheiten und das Bedingte Entstehen.
Die Zweite Edle Wahrheit (Dukkha Samudaya Sacca)
Die Vier Edlen Wahrheiten bilden das Fundament der Lehre des Buddha. Die erste Wahrheit benennt das universelle Problem: Dukkha – Leiden, Unzulänglichkeit, Stress. Die zweite Wahrheit identifiziert dessen Ursache (Samudaya): eben Taṇhā. In seiner ersten Lehrrede, dem Dhammacakkappavattana Sutta (SN 56.11), formulierte der Buddha dies klassisch:
„Und dies, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensentstehung: Es ist dieser Durst (Taṇhā), der zur Wiedergeburt führt (Ponobbhavikā), begleitet von Wohlgefallen und Gier (Nandīrāgasahagatā), hier und da sich ergötzend (Tatratatrābhinandinī), nämlich: Verlangen nach Sinnesfreuden (Kāma-Taṇhā), Verlangen nach Sein (Bhava-Taṇhā), Verlangen nach Nicht-Sein (Vibhava-Taṇhā).“
Taṇhā wird hier als die Kraft beschrieben, die den Kreislauf der Wiedergeburten antreibt (Ponobbhavikā), weil sie uns an das Dasein bindet – durch die Suche nach Vergnügen (Nandīrāgasahagatā) in den verschiedensten Formen und Bereichen (Tatratatrābhinandinī).
Obwohl Taṇhā als die zentrale und unmittelbarste Ursache des Leidens gilt, ist es wichtig zu verstehen, dass sie selbst nicht als absolute Erstursache gesehen wird. Im Buddhismus ist alles bedingt und voneinander abhängig. Taṇhā selbst entsteht in Abhängigkeit von anderen Faktoren, wie im Bedingten Entstehen dargelegt wird.
Das Bedingte Entstehen (Paṭiccasamuppāda)
Das Bedingte Entstehen beschreibt den Prozess, wie Leiden und Wiedergeburt durch eine Kette von zwölf kausal verknüpften Gliedern entstehen und aufrechterhalten werden. Taṇhā ist das achte Glied in dieser Kette. Die für das Verständnis von Taṇhā entscheidende Sequenz lautet:
6. Berührung (Phassa) → 7. Gefühl (Vedanā) → 8. Verlangen (Taṇhā) → 9. Anhaften (Upādāna) → 10. Werden (Bhava) →… Leiden (Dukkha)
Hier wird deutlich, dass Taṇhā nicht aus dem Nichts entsteht, sondern eine Reaktion auf Vedanā (Gefühl) ist, welches wiederum durch Phassa (Kontakt zwischen Sinnesorgan, Sinnesobjekt und Bewusstsein) ausgelöst wird.
Kurze Erklärung von Vedanā (Gefühl): Vedanā bezeichnet die unmittelbare affektive Tönung einer Erfahrung, noch bevor komplexe Emotionen oder Gedanken entstehen. Es gibt drei Arten: angenehm (Sukha), unangenehm (Dukkha) und weder-angenehm-noch-unangenehm oder neutral (Adukkhamasukha). Diese grundlegende Gefühlstönung ist eine universelle Reaktion auf jeden Sinneskontakt. Entscheidend ist, wie wir darauf reagieren: Angenehme Gefühle lösen oft den Wunsch nach mehr aus (Kāma-Taṇhā), unangenehme Gefühle führen zu Abneigung und dem Wunsch, sie loszuwerden (was zu Vibhava-Taṇhā beitragen kann), und selbst neutrale Gefühle können subtiles Verlangen nach Fortdauer oder Unruhe auslösen.
Kurze Erklärung von Upādāna (Anhaften/Ergreifen): Wenn Taṇhā (das Verlangen) stark wird, geht es in Upādāna über – das aktive Festhalten, Greifen, Sich-Anklammern an Objekte, Ansichten oder das Selbst. Upādāna bedeutet wörtlich auch „Brennstoff“ oder „Nahrung“. Dies deutet darauf hin, dass das Anhaften den Prozess des Werdens (Bhava) – die karmischen Tendenzen, die zur nächsten Existenz führen – nährt und somit den Kreislauf des Leidens weiter befeuert. Der Buddha nannte vier Hauptbereiche des Anhaftens: Anhaften an Sinnesfreuden (Kāmupādāna), an Ansichten (Diṭṭhupādāna), an Regeln und Ritualen (im Glauben, sie allein führten zur Erlösung, Sīlabbatupādāna) und an der Vorstellung eines Selbst (Attavādupādāna).
Die Abfolge Vedanā → Taṇhā → Upādāna ist von immenser praktischer Bedeutung. Sie zeigt den kritischen Punkt auf, an dem der Kreislauf des Leidens unterbrochen werden kann. Die buddhistische Praxis, insbesondere die Achtsamkeitsmeditation (Satipaṭṭhāna), zielt darauf ab, sich der Gefühle (Vedanā) bewusst zu werden, bevor sie automatisch zu Verlangen (Taṇhā) und Anhaften (Upādāna) führen. Durch achtsame, nicht-reaktive Beobachtung der aufkommenden Gefühle kann die Kette durchbrochen und die Entstehung von Leiden verhindert werden. Dies ist das Herzstück der meditativen Befreiung.
Darüber hinaus lehrt der Buddha, dass dieser egoistische „Durst“ nicht nur die Quelle individuellen Leidens ist, sondern auch die Wurzel aller Konflikte in der Welt – von persönlichen Streitigkeiten bis hin zu Kriegen zwischen Nationen. Diese Perspektive erweitert das Verständnis von Taṇhā von einem rein psychologischen Problem zu einem mit tiefgreifenden sozialen und ethischen Implikationen, was die buddhistische Betonung von Mitgefühl und Gewaltlosigkeit untermauert.
4. Taṇhā in den Lehrreden (Suttas)
Obwohl Taṇhā ein allgegenwärtiges Thema im Pāli-Kanon ist, gibt es einige Lehrreden (Suttas), die diesen Begriff besonders hervorheben oder detailliert erklären. Die folgenden Beispiele aus den „Langen Reden“ (Dīgha Nikāya, DN), „Mittleren Reden“ (Majjhima Nikāya, MN), „Gruppierten Reden“ (Saṃyutta Nikāya, SN) und „Angereihten Reden“ (Aṅguttara Nikāya, AN) bieten wertvolle Einblicke. Die Referenzen folgen dem Standard von SuttaCentral.net (z. B. MN 9). Erklärende Texte zu Lehrreden finden sich im Lehrreden-Verzeichnis.
Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN)
- MN 9: Sammādiṭṭhi Sutta (Die Lehrrede über Rechte Ansicht) In dieser Lehrrede erklärt der Ehrwürdige Sāriputta die „Rechte Ansicht“ (Sammā Diṭṭhi), die erste Stufe des Edlen Achtfachen Pfades. Ein zentraler Aspekt der Rechten Ansicht ist das Verständnis des Leidens, seiner Entstehung, seiner Aufhebung und des Weges zu seiner Aufhebung – die Vier Edlen Wahrheiten. Sāriputta erläutert hierbei explizit das Verlangen (Taṇhā) als Ursprung des Leidens, dessen Entstehung durch Gefühl (Vedanā) bedingt ist, dessen Aufhebung durch die Aufhebung des Gefühls erfolgt und dessen Weg zur Aufhebung der Edle Achtfache Pfad ist. Besonders relevant ist die Auflistung der sechs Arten des Verlangens, die sich auf die sechs Sinnesbereiche beziehen: Verlangen nach Formen (Rūpa-Taṇhā), Tönen (Sadda-Taṇhā), Gerüchen (Gandha-Taṇhā), Geschmäcken (Rasa-Taṇhā), Körperempfindungen (Phoṭṭhabba-Taṇhā) und Geistobjekten/Ideen (Dhamma-Taṇhā).
MN 9 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis. - MN 38: Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta (Die große Lehrrede über die Auflösung des Verlangens) Der Titel selbst weist auf das zentrale Thema hin: die „Auflösung“ oder „Zerstörung“ des Verlangens (Taṇhāsaṅkhaya). Der Buddha widerlegt hier die falsche Ansicht des Mönchs Sāti, der glaubte, dass ein und dasselbe Bewusstsein (Viññāṇa) unverändert von Wiedergeburt zu Wiedergeburt wandert. Der Buddha betont stattdessen, dass Bewusstsein, wie alle Phänomene, abhängig entstanden ist und ohne Bedingungen nicht entsteht. Er legt die Kette des Bedingten Entstehens dar, um zu zeigen, wie Taṇhā aus Vedanā entsteht und zu weiterem Werden und Leiden führt, und wie dessen Aufhebung zur Aufhebung des Leidens führt. Die Rede führt auch das Konzept der vier „Nahrungen“ (Āhāra) ein, die das Dasein aufrechterhalten, und zeigt, wie Verlangen als Treibstoff für den Daseinsprozess wirkt.
MN 38 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Erwähnenswert:
- DN 15: Mahānidāna Sutta (Die große Lehrrede über die Ursachen): Bietet eine sehr detaillierte Analyse des Bedingten Entstehens, insbesondere der wechselseitigen Abhängigkeit von Bewusstsein (Viññāṇa) und Geist-Körperlichkeit (Nāma-Rūpa) sowie der Sequenz Vedanā → Taṇhā → Upādāna.
DN 15 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis. - DN 22: Mahāsatipaṭṭhāna Sutta (Die große Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit): Stellt die Vier Edlen Wahrheiten als einen der Hauptbereiche der Achtsamkeitsmeditation (Dhammānupassanā) dar und definiert dabei Taṇhā als Ursache des Leidens. Dies zeigt die praktische Relevanz des Verständnisses von Taṇhā für die Meditationspraxis.
DN 22 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Saṃyutta Nikāya (SN)
Es gibt kein eigenes Kapitel (Saṃyutta), das ausschließlich Taṇhā gewidmet ist. Jedoch ist Taṇhā ein zentrales Thema in Kapiteln, die seinen Entstehungskontext behandeln:
- SN 12: Nidāna Saṃyutta (Das Kapitel über die Ursachen/Bedingtes Entstehen): Dieses Kapitel ist grundlegend für das Verständnis, wie Taṇhā als achtes Glied in die Kausalkette des Leidens eingebettet ist und wie es aus Gefühl entsteht und zu Anhaften führt.
SN 12 – Zusammenfassung des Kapitels im Lehrreden-Verzeichnis. - SN 56: Sacca Saṃyutta (Das Kapitel über die Wahrheiten): Dieses Kapitel versammelt Lehrreden über die Vier Edlen Wahrheiten. Taṇhā, als Kern der Zweiten Edlen Wahrheit, ist hier ein durchgehendes, fundamentales Thema.
SN 56 – Zusammenfassung des Kapitels im Lehrreden-Verzeichnis.
Schlüssel-Sutta Beispiel: SN 56.11: Dhammacakkappavattana Sutta (Die Lehrrede vom Ingangsetzen des Rades der Lehre) Dies ist die erste Lehrrede des Buddha nach seiner Erleuchtung. Sie legt das Fundament der gesamten Lehre, indem sie die Vier Edlen Wahrheiten vorstellt. Hier findet sich die maßgebliche Definition der Zweiten Edlen Wahrheit mit Taṇhā (einschließlich der drei Formen Kāma-, Bhava-, Vibhava-Taṇhā) als Ursprung des Leidens.
Aṅguttara Nikāya (AN)
Besonders bekannte Lehrrede: AN 4.199: Taṇhāsutta (Die Lehrrede über das Verlangen) Diese Rede ist bekannt für ihre bildhafte Beschreibung von Taṇhā als „Weberin“ (Jālinī), „Fließende“ (Saritā), „Ausgebreitete“ (Visaṭā) und „Haftende“ (Visattikā), die die Welt wie ein verheddertes Garn umgarnt. Sie führt die Analyse der „18 Strömungen des Verlangens“ (Taṇhāvicaritāni) ein, die sich auf innere Bezugspunkte (z. B. „Ich bin“) und äußere Bezugspunkte (z. B. „Ich bin durch dieses“) beziehen. Diese 18 inneren und 18 äußeren Strömungen ergeben 36. Bezogen auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ergeben sich 108 Strömungen des Verlangens. Diese detaillierte Aufschlüsselung ist nicht nur eine Zahlenspielerei. Sie verdeutlicht eindrücklich, wie tief das Verlangen mit unserer grundlegenden Identifikation als „Ich“ und „Mein“ verwoben ist und wie es jede Wahrnehmung und jeden Gedanken durchdringt, der auf dieser Ich-Vorstellung basiert – und das über alle Zeitdimensionen hinweg. Es zeigt die subtile und allgegenwärtige Verstrickung von Taṇhā mit der Konstruktion unserer Identität.
Erwähnenswert: AN 6.106: Taṇhāsutta (Die Lehrrede über das Verlangen) Diese kurze Rede verbindet die Aufgabe der drei Arten von Taṇhā (Kāma-, Bhava-, Vibhava-Taṇhā) mit der Aufgabe der drei Arten von Dünkel (Māna, Omāna, Atimāna – Überlegenheits-, Unterlegenheits- und Gleichheitsdünkel) als Voraussetzung für das Durchschneiden des Verlangens und das Beenden des Leidens.
Tabelle: Ausgewählte Lehrreden zu Taṇhā
| Nikāya | Sutta Nr. | Pali Name | Deutscher Titel (SuttaCentral) | Kurze Relevanz für Taṇhā |
|---|---|---|---|---|
| MN | 9 | Sammādiṭṭhi Sutta | Die Lehrrede über Rechte Ansicht | Erklärt Taṇhā (6 Arten) als Teil der Rechten Ansicht, Ursprung = Vedanā. |
| MN | 38 | Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta | Die große Lehrrede über die Auflösung des Verlangens | Widerlegt falsche Sicht über Bewusstsein, erklärt Taṇhā im Kontext von Bedingtem Entstehen und den vier Nahrungen. |
| DN | 15 | Mahānidāna Sutta | Die große Lehrrede über die Ursachen | Detaillierte Analyse des Bedingten Entstehens, inkl. Vedanā → Taṇhā → Upādāna. |
| DN | 22 | Mahāsatipaṭṭhāna Sutta | Die große Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit | Definiert Taṇhā (2. Edle Wahrheit) als Objekt der Achtsamkeitsmeditation (Dhammānupassanā). |
| SN | 56.11 | Dhammacakkappavattana Sutta | Die Lehrrede vom Ingangsetzen des Rades der Lehre | Erste Lehrrede; grundlegende Definition der 2. Edlen Wahrheit mit Taṇhā (3 Arten) als Leidensursprung. |
| AN | 4.199 | Taṇhāsutta | Die Lehrrede über das Verlangen | Beschreibt Taṇhā als „Weberin“; analysiert 36/108 Strömungen des Verlangens basierend auf Ich-Vorstellungen. |
5. Zusammenfassung und Ausblick
Taṇhā, der „Durst“ oder das „Verlangen“, ist ein zentraler Begriff im Buddhismus, der als die unmittelbare Ursache des Leidens (Dukkha) identifiziert wird (Zweite Edle Wahrheit). Es manifestiert sich in drei Hauptformen: dem Verlangen nach Sinnesfreuden (Kāma-Taṇhā), dem Verlangen nach Existenz (Bhava-Taṇhā) und dem Verlangen nach Nicht-Existenz (Vibhava-Taṇhā). Im Rahmen des Bedingten Entstehens (Paṭiccasamuppāda) entsteht Taṇhā aus Gefühl (Vedanā) und führt zu Anhaften (Upādāna), was den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) antreibt.
Das Verständnis von Taṇhā ist nicht nur theoretisch relevant, sondern bildet die Grundlage für die buddhistische Praxis. Die Erkenntnis, wie Verlangen aus Gefühlen entsteht und zu Anhaften führt, eröffnet den Weg zur Befreiung. Durch Achtsamkeit und Weisheit kann dieser Prozess erkannt und unterbrochen werden. Die in diesem Bericht genannten Lehrreden aus dem Dīgha, Majjhima, Saṃyutta und Aṅguttara Nikāya bieten tiefere Einblicke und konkrete Anleitungen. Es wird empfohlen, diese Sutta-Referenzen als Ausgangspunkt für das eigene Studium zu nutzen. Ressourcen wie SuttaCentral.net ermöglichen den Zugang zu den Originaltexten und Übersetzungen.
Das Erkennen und schrittweise Loslassen von Taṇhā durch die Entfaltung des Edlen Achtfachen Pfades ist der vom Buddha gewiesene Weg zur Beendigung des Leidens und zur Verwirklichung von Nibbāna – ein Weg, der jedem offensteht.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.
- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.
- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.
- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.
- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.
- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Upādāna (Anhaften – 9. Glied)
Aus dem Begehren entwickelt sich Upādāna, das Anhaften oder Ergreifen – eine intensivierte Form des Begehrens. Hier geht es um das Festhalten an Sinnesfreuden, an bestimmten Ansichten, an Regeln und Ritualen oder – am grundlegendsten – an der Vorstellung eines festen „Ich“. Verstehe, wie dieses Anhaften dich noch fester an den Kreislauf bindet.







