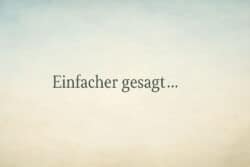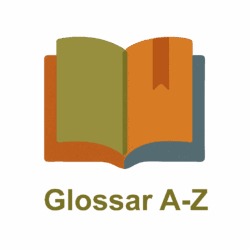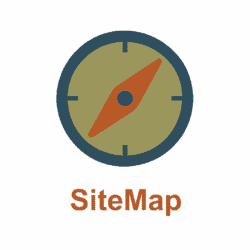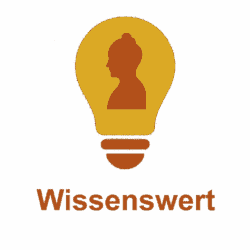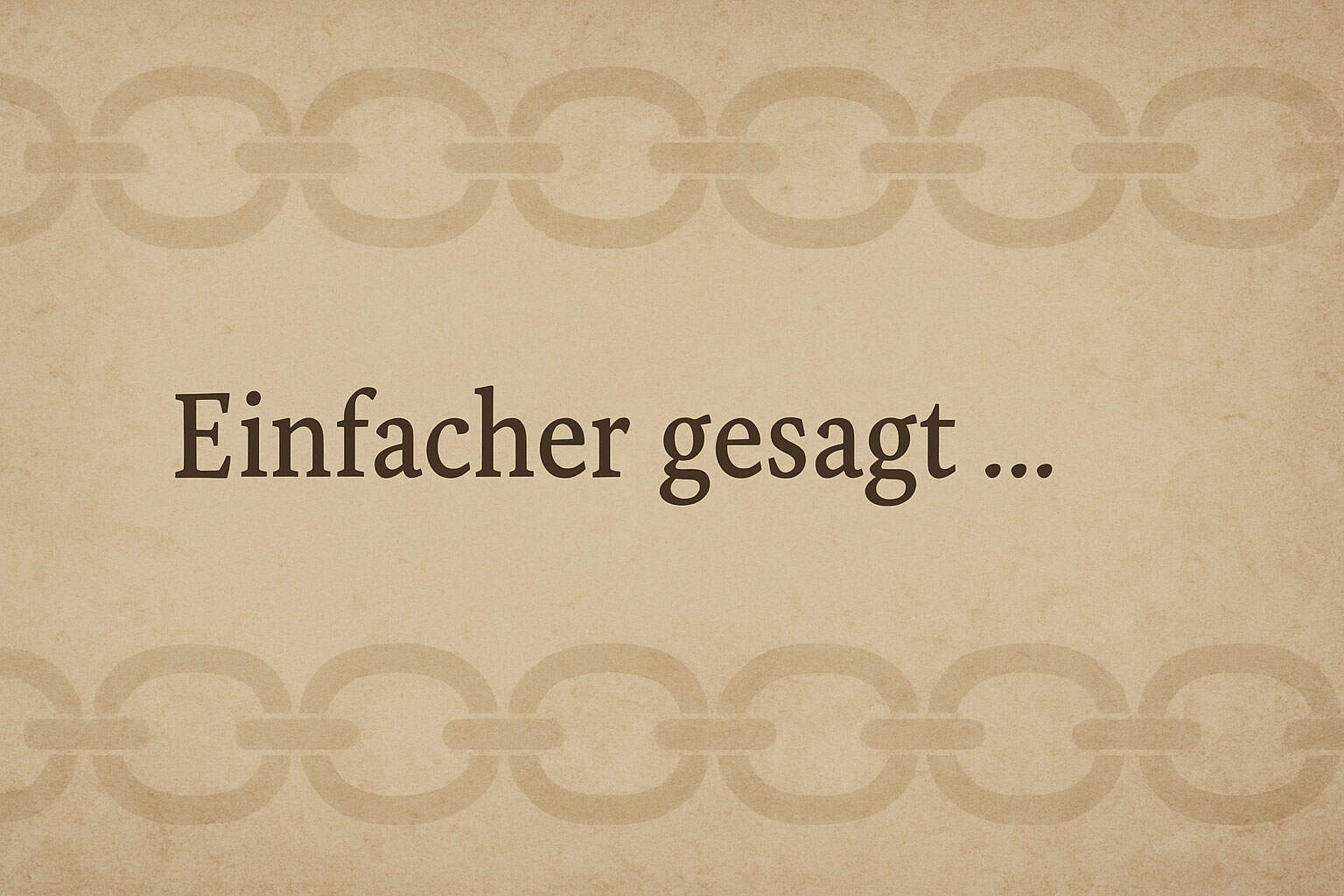
Das Netz der Wirklichkeit: Eine Einführung in das Bedingte Entstehen (Paṭicca Samuppāda) im Buddhismus
Im Zentrum der Lehren des historischen Buddha Siddhartha Gautama steht das tiefgründige Prinzip Paṭicca Samuppāda (Bedingtes Entstehen), das erklärt, wie Leiden entsteht und vergeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Das Herz der Lehre Buddhas – Was ist Bedingtes Entstehen?
- Die Kette des Leidens: Die 12 Glieder (Nidānas) des Bedingten Entstehens
- Ein tiefer Ozean: Der Buddha über das Bedingte Entstehen (Zitate aus den Lehrreden)
- Bilder des Verstehens: Gleichnisse und Analogien
- Verknüpfte Wahrheiten: Wichtige Begriffe im Kontext
- Fazit: Den Faden entwirren – Der Weg zur Einsicht
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung: Das Herz der Lehre Buddhas – Was ist Bedingtes Entstehen?
Im Zentrum der Lehren des historischen Buddha Siddhartha Gautama steht ein tiefgründiges Prinzip, das als Paṭicca Samuppāda (Pali) oder Pratītyasamutpāda (Sanskrit) bekannt ist. Übersetzt wird dieser Begriff meist als „Bedingtes Entstehen“, „Abhängiges Entstehen“ oder „Entstehen in Abhängigkeit“. Es handelt sich um eine der fundamentalsten Einsichten des Buddhismus, die erklärt, wie die Phänomene der Welt – insbesondere das menschliche Erleben von Leiden – entstehen und wie sie auch wieder vergehen können.
Das Grundprinzip hinter Paṭicca Samuppāda lässt sich durch eine einfache, aber weitreichende Formel ausdrücken, die in den alten buddhistischen Texten häufig wiederkehrt: „Wenn dies ist, ist das; wenn dies entsteht, entsteht das. Wenn dies nicht ist, ist das nicht; wenn dies aufhört, hört das auf.“ (Pali: Imasmiṃ sati, idaṃ hoti; imassuppādā, idaṃ uppajjati. Imasmiṃ asati, idaṃ na hoti; imassa nirodhā, idaṃ nirujjhati ). Diese Formel besagt, dass nichts in unserer Erfahrungswelt isoliert oder aus sich selbst heraus existiert.
Alles, was wir wahrnehmen – seien es materielle Objekte, Gedanken, Gefühle oder ganze Lebenssituationen – entsteht in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Ursachen und Bedingungen. Die Wirklichkeit wird hier nicht als eine Sammlung fester, unabhängiger Einheiten verstanden, sondern als ein dynamisches Netz von Wechselwirkungen, in dem alles mit allem verbunden ist und sich gegenseitig beeinflusst.
Der primäre Zweck dieser Lehre im Buddhismus ist es, den Prozess zu beleuchten, durch den Dukkha – ein zentraler Begriff, der oft mit Leiden, Schmerz, Unzufriedenheit oder Stress übersetzt wird – im Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) entsteht. Gleichzeitig aber zeigt Paṭicca Samuppāda auch den Weg auf, wie dieser leidvolle Kreislauf durchbrochen und Befreiung (Nibbāna, Sanskrit: Nirvana) erlangt werden kann. Es ist die detaillierte Erklärung der zweiten und dritten der Vier Edlen Wahrheiten – der Wahrheit vom Ursprung des Leidens und der Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Der Buddha betonte die zentrale Bedeutung dieser Einsicht mit den Worten: „Wer das Bedingte Entstehen sieht, sieht das Dhamma (die Lehre); wer das Dhamma sieht, sieht das Bedingte Entstehen.“
Es ist wichtig zu verstehen, dass Paṭicca Samuppāda kein theologisches Konzept ist, das auf einen Schöpfergott verweist. Vielmehr beschreibt es ein unpersönliches, universelles Naturgesetz der Bedingtheit (Idappaccayatā), das allem zugrunde liegt. Obwohl die Grundformel einfach erscheinen mag, warnte der Buddha selbst davor, die Tiefe dieser Lehre zu unterschätzen. Sie erfordert sorgfältige Betrachtung und tiefes Durchdringen, um ihre volle Tragweite zu erfassen. Die scheinbare Einfachheit verbirgt eine komplexe Analyse der Realität und des menschlichen Geistes.
Man unterscheidet oft zwischen dem allgemeinen Prinzip der Bedingtheit (alles entsteht abhängig von Ursachen und Bedingungen) und einer spezifischen, sehr wichtigen Anwendung dieses Prinzips: der zwölfgliedrigen Kette des Bedingten Entstehens. Diese Kette, die im Folgenden detailliert erläutert wird, beschreibt den spezifischen Prozess, der zur Entstehung von Leiden und zur Fortsetzung des Wiedergeburtenkreislaufs führt.
Dieser Bericht wird zunächst die zwölf Glieder dieser Kette vorstellen und erläutern. Anschließend werden Zitate aus den Lehrreden des Buddha präsentiert, die die Tiefe und spezifische Aspekte des Bedingten Entstehens beleuchten. Darauf folgen kanonische und moderne Gleichnisse, die das Verständnis erleichtern sollen. Abschließend werden zentrale buddhistische Begriffe kurz im Kontext des Bedingten Entstehens eingeführt, um ein umfassenderes Bild zu ermöglichen.
Die Kette des Leidens: Die 12 Glieder (Nidānas) des Bedingten Entstehens
Die bekannteste Darstellung von Paṭicca Samuppāda ist die sogenannte zwölfgliedrige Kette, die aus zwölf Faktoren oder Gliedern (Nidānas) besteht. Diese Kette beschreibt, wie durch eine Abfolge von bedingenden Faktoren das Leiden (Dukkha) entsteht und sich der Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) fortsetzt. Traditionell wird dieser Prozess oft über drei aufeinanderfolgende Leben erklärt, aber viele moderne Interpretationen betonen auch seine Relevanz für psychologische Prozesse, die sich von Moment zu Moment in unserem Geist abspielen. Jedes Mal, wenn Gier, Hass oder Verblendung aufkommen und zu Handlungen führen, kann darin ein Mikrokosmos dieser Kette erkannt werden.
Es ist entscheidend zu verstehen, dass diese Kette kein starrer, linearer oder deterministischer Ablauf ist, bei dem ein Glied unweigerlich das nächste hervorruft wie eine Reihe umfallender Dominosteine. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von Bedingungen, einen dynamischen Kreislauf oder ein Rad (Vaṭṭa), bei dem die Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und verstärken können. Manche Glieder bedingen sich sogar wechselseitig, wie wir später sehen werden.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zwölf Glieder in ihrer Standardreihenfolge:
| Nr. | Pali-Begriff | Deutsche Übersetzung(en) | Kernidee/Stichwort |
|---|---|---|---|
| 1 | Avijjā | Unwissenheit, Nichtwissen, Verblendung | Grundlegendes Missverstehen der Realität (Vier Wahrheiten, Anicca, Dukkha, Anattā) |
| 2 | Saṅkhāra | Formationen, Gestaltungen, Willensregungen, (karmische) Impulse | Absichtsvolle Handlungen (Karma), geprägt durch Unwissenheit |
| 3 | Viññāṇa | Bewusstsein | Grundlegendes Gewahrsein, „Samen“ für Erfahrung, selbst bedingt |
| 4 | Nāmarūpa | Name-und-Form, Geist-und-Körper | Die psycho-physische Einheit des Individuums (mentale & körperliche Faktoren) |
| 5 | Saḷāyatana | Sechs Sinnesgrundlagen/Sinnestore | Die sechs Sinne (inkl. Geist) und ihre Objekte |
| 6 | Phassa | Kontakt, Berührung | Zusammentreffen von Sinn, Objekt und Bewusstsein |
| 7 | Vedanā | Gefühl, Empfindung | Unmittelbare Reaktion auf Kontakt (angenehm, unangenehm, neutral) |
| 8 | Taṇhā | Verlangen, Durst, Begehren, Gier | Reaktion auf Gefühl (Haben-Wollen, Nicht-Haben-Wollen) |
| 9 | Upādāna | Anhaften, Ergreifen, Festhalten | Intensiviertes Verlangen, Identifikation („Ich“, „Mein“) |
| 10 | Bhava | Werden, Existenz(prozess) | Karmische Energie/Tendenz, die zu neuer Existenz führt |
| 11 | Jāti | Geburt | Tatsächliches Entstehen (Wiedergeburt oder neuer Leidensmoment) |
| 12 | Jarāmaraṇa (…) | Altern und Tod (& Kummer, Jammer, Schmerz, Gram, Verzweiflung) | Unausweichliche Folge der Geburt, Manifestation von Dukkha |
Detaillierte Erklärung der 12 Glieder:
1. Unwissenheit (Avijjā): Dies ist nicht nur ein Mangel an intellektuellem Wissen, sondern eine tiefgreifende Verblendung oder Verkennung der wahren Natur der Wirklichkeit. Insbesondere bezieht es sich auf das Nichtverstehen der Vier Edlen Wahrheiten und der drei Daseinsmerkmale: Vergänglichkeit (Anicca), Leidhaftigkeit (Dukkha) und Nicht-Selbst (Anattā). Diese grundlegende Ignoranz gilt als die Wurzel des gesamten Leidenskreislaufs.
2. Formationen/Willensregungen (Saṅkhāra): Bedingt durch die Unwissenheit entstehen Saṅkhāras. Dies sind absichtsvolle Handlungen – körperlich, sprachlich oder geistig – sowie die daraus resultierenden karmischen Prägungen und Tendenzen. Sie sind die formenden Kräfte, die durch unsere von Unwissenheit geleiteten Absichten (Cetanā) entstehen und zukünftige Erfahrungen gestalten. Man kann sie als die „Baupläne“ für zukünftiges Erleben betrachten.
3. Bewusstsein (Viññāṇa): Aus den Saṅkhāras der Vergangenheit entsteht das Bewusstsein im gegenwärtigen Moment oder zu Beginn einer neuen Existenz. Es ist das grundlegende Gewahrsein oder die Fähigkeit zu erkennen, die als „Samenkorn“ (bīja) für die Entfaltung der individuellen Erfahrung dient. Entscheidend ist: Dieses Bewusstsein ist selbst ein bedingter Prozess und keine ewige Seele oder ein transzendentes Selbst, das von Leben zu Leben wandert – ein Punkt, den der Buddha nachdrücklich betonte.
4. Name-und-Form / Geist-und-Körper (Nāmarūpa): Bedingt durch das Bewusstsein entsteht die psycho-physische Einheit, die ein Individuum ausmacht. Nāma (wörtlich „Name“) bezieht sich hier auf die Gesamtheit der mentalen Faktoren: Gefühl (Vedanā), Wahrnehmung (Saññā), Absicht (Cetanā), Kontakt (Phassa) und Aufmerksamkeit (Manasikāra). Rūpa („Form“) bezeichnet den physischen Körper mit seinen Elementen und Funktionen. Geist und Körper entstehen und existieren in untrennbarer, wechselseitiger Abhängigkeit voneinander.
5. Sechs Sinnesgrundlagen (Saḷāyatana): Aus der psycho-physischen Einheit (Nāmarūpa) entwickeln sich die sechs „Tore“ oder Grundlagen der Wahrnehmung: die fünf physischen Sinne (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper) und der Geist (Manas) als sechster Sinn, der Gedanken und mentale Objekte wahrnimmt. Diese bilden die Schnittstelle zwischen dem Individuum und der Welt.
6. Kontakt (Phassa): Durch die Sinnesgrundlagen kommt es zum Kontakt. Kontakt ist das Zusammentreffen von drei Faktoren: einem Sinnesorgan (z.B. Auge), einem entsprechenden Sinnesobjekt (z.B. eine sichtbare Form) und dem dazugehörigen Bewusstsein (z.B. Sehbewusstsein). In diesem Moment des Kontakts beginnt die eigentliche Erfahrung.
7. Gefühl/Empfindung (Vedanā): Unmittelbar auf den Kontakt folgt ein Gefühl oder eine Empfindung. Diese Empfindung ist grundlegend und wird in drei Kategorien eingeteilt: angenehm (sukha), unangenehm (dukkha) oder weder-angenehm-noch-unangenehm, also neutral (adukkhamasukha). Dies ist ein entscheidender Moment in der Kette, denn hier entscheidet sich oft unbewusst, wie wir weiter reagieren. Achtsamkeit auf Vedanā ist daher ein zentraler Punkt der buddhistischen Praxis, um die automatische Kausalkette zu unterbrechen.
8. Verlangen/Durst (Taṇhā): Bedingt durch das Gefühl entsteht Taṇhā, der „Durst“ oder das Verlangen. Bei angenehmen Gefühlen entsteht das Verlangen, sie mögen andauern oder sich wiederholen (Gier). Bei unangenehmen Gefühlen entsteht das Verlangen, sie mögen aufhören oder vermieden werden (Abneigung, Hass). Bei neutralen Gefühlen bleibt oft eine subtile Form der Unwissenheit oder Gleichgültigkeit, die ebenfalls auf Verlangen basiert (z.B. Verlangen nach Nicht-Existenz oder nach weiterer Stimulation). Taṇhā ist neben Avijjā die zweite große Antriebskraft des Leidenskreislaufs.
9. Anhaften/Ergreifen (Upādāna): Aus dem Verlangen entwickelt sich das Anhaften oder Ergreifen. Dies ist eine Intensivierung des Durstes, ein Festhalten an Erfahrungen, Objekten, Meinungen, Regeln, Ritualen und vor allem an der Vorstellung eines festen, beständigen Selbst („Ich“, „Mein“). Es gibt vier Arten des Anhaftens: Anhaften an Sinnesfreuden, an Ansichten, an Regeln und Ritualen sowie an der Vorstellung eines Selbst.
10. Werden (Bhava): Das Anhaften nährt den Prozess des Werdens. Bhava bezeichnet die karmische Energie oder Tendenz, die durch unsere anhaftenden Handlungen erzeugt wird und zur Fortsetzung der Existenz in Saṃsāra führt. Es ist das Potential für eine zukünftige Geburt oder das fortwährende Entstehen von Identifikationen und leidvollen Geisteszuständen im Hier und Jetzt.
11. Geburt (Jāti): Bedingt durch das Werden kommt es zur Geburt. Im traditionellen Kontext meint dies die physische Wiedergeburt in einer neuen Existenzform innerhalb des Saṃsāra. Im psychologischen Sinne kann es auch das „Geborenwerden“ einer neuen Ich-Identität, einer bestimmten Rolle oder eines spezifischen Leidenszustandes in einem gegebenen Moment bedeuten.
12. Altern und Tod (Jarāmaraṇa) & assoziiertes Leid: Jede Geburt führt unausweichlich zu Alter, Verfall und schließlich zum Tod. Mit diesem Prozess verbunden sind alle Formen des Leidens: Kummer, Jammer, Schmerz (körperlich), Gram (geistig) und Verzweiflung (sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā). Dies ist die vollständige Manifestation von Dukkha, die aus der Kette der Bedingungen hervorgeht.
Der umgekehrte Weg zur Befreiung:
Die Lehre vom Bedingten Entstehen erklärt nicht nur, wie Leiden entsteht (Anuloma, die Vorwärts-Sequenz), sondern auch, wie es beendet werden kann (Paṭiloma, die Rückwärts-Sequenz). Wenn die grundlegende Bedingung – die Unwissenheit (Avijjā) – durch Weisheit und Einsicht restlos aufgelöst wird, dann hören die daraus entstehenden Formationen (Saṅkhāra) auf. Wenn die Formationen aufhören, hört das Bewusstsein (Viññāṇa) auf, das von ihnen geprägt wird. Wenn das Bewusstsein aufhört, hören Name-und-Form (Nāmarūpa) auf, und so weiter durch die gesamte Kette, bis schließlich Geburt (Jāti) und damit auch Altern, Tod und alles damit verbundene Leid (Jarāmaraṇa…) aufhören. Dies ist der Weg zur Befreiung (Nibbāna), der durch das Verstehen und Durchbrechen der Kette des Bedingten Entstehens beschritten wird.
Ein tiefer Ozean: Der Buddha über das Bedingte Entstehen (Zitate aus den Lehrreden)
Der Buddha selbst hat immer wieder die außerordentliche Tiefe und zentrale Bedeutung der Lehre vom Bedingten Entstehen (Paṭicca Samuppāda) hervorgehoben. Sie ist keine leicht zugängliche Oberflächenweisheit, sondern erfordert gründliche Untersuchung und Reflexion. In den Sammlungen der langen (Dīgha Nikāya, DN) und mittleren Lehrreden (Majjhima Nikāya, MN) des Palikanons finden sich zahlreiche Passagen, in denen der Buddha dieses Prinzip erläutert, Missverständnisse korrigiert und seine Tragweite verdeutlicht. Die folgenden Zitate, basierend auf Übersetzungen, die über SuttaCentral.net zugänglich sind, sollen einen Einblick geben.
Die Tiefe des Konzepts (DN 15):
Eine der bekanntesten Stellen findet sich im Mahānidāna Sutta (Die große Lehrrede über die Ursachen). Hier wendet sich der Buddha an seinen engen Schüler Ānanda, der bemerkt hatte, wie klar und einfach ihm das Bedingte Entstehen erscheine. Der Buddha erwidert darauf eindringlich:
„Sage das nicht, Ānanda, sage das nicht! Tiefgründig ist dieses Bedingte Entstehen, Ānanda, und tiefgründig erscheint es auch. Weil sie diese Lehre nicht verstehen, nicht durchdringen, deshalb ist diese Menschheit wie ein verhedderter Faden geworden, wie ein verknotetes Garnknäuel, wie verfilztes Schilf und Riedgras; sie kommt nicht hinaus über den leidvollen Daseinsweg, die schlimmen Bestimmungsorte, die Unterwelt, den Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra).“
(DN 15, Mahānidāna Sutta)
Dieses Zitat macht unmissverständlich klar, dass ein oberflächliches Verständnis nicht ausreicht. Die Verstrickung der Wesen im leidvollen Kreislauf ist eine direkte Folge des Nicht-Durchdringens dieser tiefgründigen Lehre. Es ist eine Mahnung zur Sorgfalt und eine Ermutigung, sich intensiv mit diesem Prinzip auseinanderzusetzen. Es zeigt auch, wie der Buddha lehrte: Er korrigierte die voreilige Einschätzung seines Schülers und betonte die Schwierigkeit, um zu tieferer Einsicht anzuregen.
Bewusstsein ist bedingt, kein ewiges Selbst (MN 38):
Im Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta (Größere Lehrrede über die Auflösung des Verlangens) wird von einem Mönch namens Sāti berichtet, der die falsche Ansicht vertrat, es gäbe ein und dasselbe Bewusstsein (Viññāṇa), das von einem Leben zum nächsten wandert – eine Vorstellung, die einer ewigen Seele ähnelt. Der Buddha rief Sāti zu sich und wies ihn scharf zurecht:
„Du fehlgeleiteter Mensch, wem gegenüber hast du mich je gekannt, dass ich die Lehre auf diese Weise dargelegt hätte? Habe ich nicht, du fehlgeleiteter Mensch, auf vielfältige Weise das Bewusstsein als bedingt entstanden erklärt, [indem ich sagte]: ‚Ohne Bedingung gibt es kein Entstehen von Bewusstsein‘? Aber du, fehlgeleiteter Mensch, hast uns durch dein falsches Erfassen falsch dargestellt, schadest dir selbst und häufst viel Unverdienst an; denn dies wird dir lange Zeit zu Schaden und Leid gereichen.“
(MN 38, Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta)
Diese Passage ist von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis der buddhistischen Lehre vom Nicht-Selbst (Anattā). Sie widerlegt direkt die Idee eines permanenten, wandernden Bewusstseins oder einer Seele. Stattdessen wird betont, dass Bewusstsein, wie alle anderen Phänomene auch, nur in Abhängigkeit von Bedingungen entsteht. Sātis Ansicht repräsentiert eine Form der Ewigkeitsansicht (sassatadiṭṭhi), die der Buddha ablehnte. Die Lehre vom Bedingten Entstehen bildet hier die Grundlage für den „Mittleren Weg“ (Majjhimā Paṭipadā), der die Extreme eines ewig existierenden Selbst und einer nihilistischen Verneinung jeglicher Kontinuität oder Verantwortlichkeit vermeidet.
Die wechselseitige Abhängigkeit von Bewusstsein und Name-und-Form (DN 15):
Im bereits erwähnten Mahānidāna Sutta (DN 15) geht der Buddha noch detaillierter auf die Beziehung zwischen Bewusstsein (Viññāṇa) und der psycho-physischen Einheit Name-und-Form (Nāmarūpa) ein. Er erklärt ihre gegenseitige Abhängigkeit, die über eine einfache lineare Kausalität hinausgeht:
„‚Name-und-Form sind Bedingungen für Bewusstsein‘ – so wurde es gesagt. Und wie das zu verstehen ist, Ānanda, soll auf diese Weise gesehen werden: Wenn Bewusstsein keinen Stützpunkt in Name-und-Form fände (Pali: patiṭṭhaṃ na labhissatha), würde dann in Zukunft ein Entstehen der Leidensmasse von Geburt, Altern und Tod offenbar werden?“
– „Sicherlich nicht, Herr.“
„Darum, Ānanda, ist dies der Grund, dies die Ursache, dies der Ursprung, dies die Bedingung für Bewusstsein, nämlich Name-und-Form.“
„‚Bewusstsein ist eine Bedingung für Name-und-Form‘ – so wurde es gesagt. Und wie das zu verstehen ist, Ānanda, soll auf diese Weise gesehen werden: Wenn Bewusstsein nicht in den Schoß der Mutter einginge (Pali: mātukucchismiṃ na okkamissatha), würde sich Name-und-Form dort bilden?“
– „Sicherlich nicht, Herr.“
„Wenn Bewusstsein, nachdem es in den Schoß der Mutter eingegangen ist, wieder schwinden würde, würde Name-und-Form dann zur Geburt in diesem Daseinszustand gelangen?“
– „Sicherlich nicht, Herr.“
„Wenn bei einem Knaben oder Mädchen, noch jung an Jahren, das Bewusstsein abgeschnitten würde, würde Name-und-Form dann zu Wachstum, Zunahme und Reife gelangen?“
– „Sicherlich nicht, Herr.“
„Darum, Ānanda, ist dies der Grund, dies die Ursache, dies der Ursprung, dies die Bedingung für Name-und-Form, nämlich Bewusstsein.“
(DN 15, Mahānidāna Sutta)
Dieses Zitat verdeutlicht die untrennbare und wechselseitige Verknüpfung von Bewusstsein und der psycho-physischen Konstitution. Keines kann ohne das andere entstehen oder bestehen. Das Bewusstsein braucht Name-und-Form als „Stützpunkt“ oder „Feld“, um sich manifestieren zu können, während Name-und-Form das Bewusstsein als notwendige Bedingung für seine Entstehung und Entwicklung benötigt (hier illustriert am Beispiel der Empfängnis und des Wachstums). Dies untergräbt erneut die Vorstellung eines unabhängigen Selbst oder Geistes und zeigt die Komplexität der Bedingtheit, die in einem ständigen gegenseitigen Bedingungsverhältnis operiert. Der Buddha nutzt hier das konkrete Beispiel der Empfängnis, um ein abstraktes Prinzip – die gegenseitige Abhängigkeit – anschaulich zu machen, was seine pädagogische Methode illustriert.
Bilder des Verstehens: Gleichnisse und Analogien
Um komplexe philosophische und psychologische Lehren wie das Bedingte Entstehen zugänglich zu machen, verwendete der Buddha häufig Gleichnisse (Upamā) und Analogien. Diese Bilder sprechen nicht nur den Intellekt an, sondern auch die Vorstellungskraft und Intuition, und können helfen, die abstrakten Prinzipien im eigenen Erleben wiederzuerkennen.
Kanonisches Gleichnis: Die zwei Schilfbündel (Naḷakalāpī)
Ein besonders eindrückliches und oft zitiertes kanonisches Gleichnis zur Illustration der wechselseitigen Abhängigkeit findet sich im Naḷakalāpī Sutta (Lehrrede von den Schilfbündeln) aus dem Saṃyutta Nikāya (SN 12.67). Obwohl dieser Text nicht aus dem Dīgha oder Majjhima Nikāya stammt, ist er von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Beziehung zwischen Bewusstsein (Viññāṇa) und Name-und-Form (Nāmarūpa).
In dieser Lehrrede erklärt der ehrwürdige Sāriputta, einer der Hauptschüler des Buddha, diese Beziehung wie folgt:
„Freund, es ist so, wie wenn zwei Schilfbündel sich gegenseitig stützen würden. Genauso, Freund, ist durch Name-und-Form als Bedingung Bewusstsein [bedingt]; durch Bewusstsein als Bedingung ist Name-und-Form [bedingt]. Durch Name-und-Form als Bedingung sind die sechs Sinnesgrundlagen [bedingt]; durch die sechs Sinnesgrundlagen als Bedingung ist Kontakt [bedingt] … So ist die Entstehung dieser ganzen Masse des Leidens.“
„Wenn man, Freund, eines dieser Schilfbündel wegnähme, würde das andere umfallen; und wenn man das andere wegnähme, würde das erste umfallen. Genauso, Freund, kommt es durch die Aufhebung von Name-und-Form zur Aufhebung des Bewusstseins; durch die Aufhebung des Bewusstseins kommt es zur Aufhebung von Name-und-Form. Durch die Aufhebung von Name-und-Form kommt es zur Aufhebung der sechs Sinnesgrundlagen; durch die Aufhebung der sechs Sinnesgrundlagen kommt es zur Aufhebung des Kontakts … So ist die Aufhebung dieser ganzen Masse des Leidens.“
(SN 12.67, Naḷakalāpī Sutta, paraphrasiert)
Dieses Gleichnis illustriert auf brillante Weise mehrere Kernpunkte:
- Wechselseitige Abhängigkeit: So wie keines der Schilfbündel alleine stehen kann, können auch Bewusstsein und die psycho-physische Einheit nicht unabhängig voneinander existieren. Sie stützen und bedingen sich gegenseitig.
- Fehlen einer unabhängigen Substanz: Das Gleichnis untergräbt die Vorstellung, dass entweder der Geist (Nāma und Viññāṇa) oder der Körper (Rūpa) eine eigenständige, feste Grundlage besitzt. Beide sind Teil eines interdependenten Systems. Dies ist eine kraftvolle Illustration der Anattā-Lehre (Nicht-Selbst).
- Bedingte Entstehung und Vergehen: Es zeigt, dass das System als Ganzes entsteht und vergeht. Entfernt man eine der fundamentalen Bedingungen (ein Schilfbündel), bricht das gesamte System (das andere Bündel fällt) zusammen. Dies verdeutlicht, wie die Aufhebung der Bedingungen (z.B. durch Weisheit) zur Aufhebung des Leidens führt.
Moderne und Alltags-Analogien:
Um das Prinzip der Bedingtheit noch greifbarer zu machen, können auch moderne Vergleiche und Beispiele aus dem Alltag hilfreich sein:
- Netzwerk oder Ökosystem: Stellen Sie sich ein komplexes Netzwerk oder ein biologisches Ökosystem vor. Jedes Element (eine Spinne im Netz, eine Pflanzenart im Wald) existiert nicht isoliert, sondern ist mit unzähligen anderen Elementen verbunden und beeinflusst diese – und wird von ihnen beeinflusst. Eine kleine Veränderung an einer Stelle, wie der Ausbruch eines Vulkans auf Island, kann weitreichende Folgen haben, etwa die Lahmlegung des Flugverkehrs in Europa. Das buddhistische Bild von Indras Netz, in dem jeder Juwel alle anderen reflektiert, drückt eine ähnliche Idee der totalen Interdependenz aus.
- Domino-Effekt (mit Einschränkung): Eine Reihe von Dominosteinen, bei der das Umfallen eines Steins das nächste auslöst, kann die sequentielle Natur der Kette veranschaulichen. Allerdings ist diese Analogie begrenzt, da Paṭicca Samuppāda komplexer ist und Rückkopplungen sowie wechselseitige Abhängigkeiten beinhaltet, die über eine einfache lineare Kette hinausgehen.
- Feuer und Brennstoff: Bewusstsein und Leiden entstehen nur unter bestimmten Bedingungen, so wie ein Feuer nur brennen kann, wenn Brennstoff und Sauerstoff vorhanden sind. Nimmt man den Brennstoff (die Bedingungen wie Unwissenheit und Verlangen) weg, erlischt das Feuer (das Leiden) von selbst.
- Pflanzensamen und Wachstum: Ein Samen enthält das Potential für eine Pflanze, aber er braucht die richtigen Bedingungen – Erde, Wasser, Licht, Wärme – um zu keimen und zu wachsen. Die Ursache (Samen, vergangenes Kamma) braucht die passenden Bedingungen im Hier und Jetzt, um ihre Wirkung zu entfalten. Bewusstsein wird manchmal als der Samen bezeichnet, der im Feld der Handlungen (Kamma) aufgeht, genährt durch die Feuchtigkeit des Verlangens (Taṇhā).
- Computer-Software und Abhängigkeiten: Ein Computerprogramm kann oft nur dann ausgeführt werden, wenn bestimmte andere Softwarekomponenten (Bibliotheken, Betriebssystem-Dienste) vorhanden und korrekt installiert sind. Fehlt eine dieser Abhängigkeiten, startet das Programm nicht oder stürzt ab. Ähnlich kann Leiden nur entstehen, wenn alle notwendigen Bedingungen der zwölfgliedrigen Kette zusammenkommen. Fehlt eine wesentliche Bedingung (z.B. wird Verlangen durch Achtsamkeit ersetzt), kann der leidvolle Prozess nicht ablaufen.
- Chemische Reaktion: Eine chemische Reaktion, wie eine Explosion, findet nur statt, wenn alle notwendigen Reagenzien in der richtigen Konzentration und unter den richtigen Bedingungen (Temperatur, Druck) vorhanden sind. Entfernt man einen der Stoffe oder ändert die Bedingungen, bleibt die Reaktion aus.
- Alltagsbeispiele: Das Prinzip der Bedingtheit lässt sich ständig im Alltag beobachten: Wie führt eine schlaflose Nacht zu Gereiztheit am nächsten Tag? Wie kann ein freundliches Wort eine angespannte Situation entschärfen? Wie entsteht Ärger, wenn eine Erwartung enttäuscht wird? Wie beeinflusst die Lektüre dieses Textes gerade jetzt Ihre Gedanken und Gefühle? Die bewusste Beobachtung solcher alltäglichen Kausalketten kann das Verständnis von Paṭicca Samuppāda vertiefen.
Diese verschiedenen Analogien beleuchten unterschiedliche Facetten des Bedingten Entstehens – von der sequentiellen Abfolge über die komplexe Vernetzung bis hin zur Notwendigkeit spezifischer Bedingungen. Keine einzelne Analogie kann das Konzept vollständig erfassen, aber in ihrer Gesamtheit können sie helfen, ein intuitives Gefühl für dieses zentrale buddhistische Prinzip zu entwickeln.
Verknüpfte Wahrheiten: Wichtige Begriffe im Kontext
Die Lehre vom Bedingten Entstehen (Paṭicca Samuppāda) steht nicht isoliert da, sondern ist das Herzstück, das viele andere zentrale Konzepte des Buddhismus miteinander verbindet und in einen kohärenten Zusammenhang stellt. Das Verständnis von Paṭicca Samuppāda vertieft und transformiert das Verständnis dieser verwandten Begriffe.
Im Folgenden werden einige der wichtigsten kurz vorgestellt und ihre Verbindung zur Bedingtheit erläutert:
- Dukkha (Leiden, Unzufriedenheit): Wie bereits erwähnt, dient die zwölfgliedrige Kette primär dazu, die Entstehung von Dukkha zu erklären. Das zwölfte Glied gipfelt explizit in der Beschreibung von „Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung“. Paṭicca Samuppāda ist somit die detaillierte Ausarbeitung der Zweiten Edlen Wahrheit (Ursprung des Leidens) und zeigt gleichzeitig durch die umgekehrte Sequenz den Weg zur Aufhebung des Leidens (Dritte Edle Wahrheit) auf.
- Anicca (Vergänglichkeit, Unbeständigkeit): Das Prinzip der Bedingtheit impliziert zwangsläufig Vergänglichkeit. Da alle Phänomene nur in Abhängigkeit von sich ständig ändernden Bedingungen entstehen und existieren, kann nichts von Dauer sein. Sobald sich eine Bedingung ändert, ändert sich auch das bedingte Phänomen. Das Erkennen der allgegenwärtigen Bedingtheit führt direkt zur Einsicht in die universelle Vergänglichkeit (Anicca).
- Anattā (Nicht-Selbst, Substanzlosigkeit): Dies ist vielleicht die tiefgreifendste Konsequenz aus Paṭicca Samuppāda. Weil alles bedingt entsteht und vergänglich ist, kann es keine feste, unabhängige, unveränderliche Essenz oder Seele (Attā) geben – weder in uns selbst noch in äußeren Objekten. Das, was wir als „Ich“ oder „Selbst“ wahrnehmen, ist kein festes Wesen, sondern ein sich ständig verändernder Prozess, ein komplexes Zusammenspiel der fünf Aggregate (Khandhas: Form, Gefühl, Wahrnehmung, Formationen, Bewusstsein), die selbst wiederum bedingt entstehen. Paṭicca Samuppāda erklärt, wie der Eindruck eines Selbst durch diese bedingten Prozesse entsteht, ohne dass ein tatsächliches, inhärentes Selbst existiert. Es zeigt das Fehlen eines unabhängigen Akteurs innerhalb des Prozesses.
- Kamma (Absichtsvolles Handeln, Karma): Kamma ist der Motor, der den Kreislauf des Bedingten Entstehens antreibt. Insbesondere die Glieder Saṅkhāra (Formationen, Glied 2) und Bhava (Werden, Glied 10) repräsentieren absichtsvolle Handlungen und deren karmisches Potenzial. Von Unwissenheit (Avijjā) getriebene Handlungen erzeugen karmische Spuren, die zukünftige Erfahrungen und die Bedingungen für die Wiedergeburt formen. Paṭicca Samuppāda beschreibt den Mechanismus, wie Kamma wirkt – nicht als unabänderliches Schicksal, sondern als ein bedingter Prozess, der durch Einsicht und verändertes Handeln beeinflusst werden kann.
- Saṃsāra (Kreislauf der Wiedergeburten): Die zwölfgliedrige Kette ist die klassische Darstellung des Prozesses, der Lebewesen im leidvollen Zyklus von Geburt, Altern, Tod und Wiedergeburt gefangen hält. Jedes Durchlaufen der Kette, angetrieben von Unwissenheit und Verlangen, führt zu einer neuen Geburt und damit zu neuem Leiden.
- Nibbāna (Erlöschen, Befreiung): Das ultimative Ziel der buddhistischen Praxis ist Nibbāna – das vollständige Erlöschen von Gier, Hass und Verblendung, die Beendigung des Leidens und das Austreten aus dem Kreislauf von Saṃsāra. Dieses Ziel wird durch das tiefe Verstehen und das Durchbrechen der Kette des Bedingten Entstehens erreicht. Indem die Wurzelbedingungen – Unwissenheit (Avijjā) und Verlangen (Taṇhā) – beseitigt werden, kommt der gesamte Prozess zum Stillstand. Nibbāna selbst wird als das Unbedingte (Asaṅkhata) beschrieben – das, was jenseits aller bedingten Prozesse liegt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Paṭicca Samuppāda wie ein roter Faden ist, der die zentralen Lehren des Buddhismus miteinander verwebt. Es liefert die logische und psychologische Grundlage dafür, warum die Welt als leidhaft, vergänglich und ohne festes Selbst erfahren wird, wie unsere Handlungen uns an diesen Kreislauf binden und wie durch Einsicht in diese Prozesse Befreiung möglich ist. Es verleiht den anderen Begriffen eine dynamische, prozesshafte Bedeutung und zeigt die innere Kohärenz der buddhistischen Lehre auf.
Fazit: Den Faden entwirren – Der Weg zur Einsicht
Die Lehre vom Bedingten Entstehen, Paṭicca Samuppāda, enthüllt eine grundlegende Wahrheit über unsere Existenz: Nichts existiert isoliert. Alles, was wir erfahren – Freude und Leid, Geburt und Tod, jeder Gedanke und jedes Gefühl – entsteht in einem komplexen Netz von Abhängigkeiten. „Wenn dies ist, ist das; wenn dies entsteht, entsteht das.“ Diese einfache Formel birgt den Schlüssel zum Verständnis der tiefsten Mechanismen unseres Geistes und der Welt.
Wir haben gesehen, wie die zwölfgliedrige Kette detailliert beschreibt, wie Unwissenheit (Avijjā) und Verlangen (Taṇhā) als treibende Kräfte einen Kreislauf in Gang setzen, der unweigerlich zu Leiden (Dukkha) führt und uns im Zyklus der Wiedergeburten (Saṃsāra) gefangen hält. Die Zitate aus den Lehrreden des Buddha haben die Tiefe dieses Konzepts unterstrichen und Missverständnisse, wie die Vorstellung eines ewigen Bewusstseins, korrigiert. Gleichnisse wie die zwei Schilfbündel und moderne Analogien helfen dabei, die abstrakten Prinzipien der wechselseitigen Abhängigkeit und Bedingtheit greifbarer zu machen. Die Verknüpfung mit anderen zentralen Begriffen wie Anicca, Anattā, Kamma und Nibbāna zeigt, dass Paṭicca Samuppāda das integrative Gerüst bildet, das die buddhistische Lehre zusammenhält.
Doch das Verständnis des Bedingten Entstehens ist weit mehr als eine intellektuelle Übung. Es ist eine Einsicht mit tiefgreifender praktischer Relevanz. Die Lehre lädt dazu ein, die Prozesse von Ursache und Wirkung im eigenen Erleben durch Achtsamkeit und Meditation zu erforschen. Indem wir lernen, genau hinzusehen, wie Gefühle zu Verlangen führen, wie Anhaften entsteht und wie unsere Sichtweisen unser Handeln prägen, können wir beginnen, die Kette bewusst zu beeinflussen.
Gerade weil Leiden bedingt entsteht, ist es nicht unser unausweichliches Schicksal. Die Lehre vom Bedingten Entstehen ist letztlich eine Botschaft der Hoffnung und des Potenzials. Sie zeigt, dass durch das Kultivieren von Weisheit (Paññā), durch das Verstehen der Bedingungen und das Loslassen von Unwissenheit und Verlangen, der leidvolle Kreislauf durchbrochen werden kann. Es ist keine Lehre des Determinismus, sondern eine, die die Möglichkeit der Befreiung durch eigenes Bemühen aufzeigt. Das Entwirren des „verhedderten Fadens“, von dem der Buddha sprach, ist möglich.
Darüber hinaus fördert die Einsicht in die allumfassende Interdependenz eine Weltsicht, die über egozentrische Perspektiven hinausgeht. Wenn wir erkennen, wie tief wir mit allen anderen Lebewesen und der gesamten Umwelt verbunden sind, erwachsen daraus Mitgefühl (Karuṇā), Verantwortungsbewusstsein und die Motivation zu ethischem Handeln. Das Verständnis von Paṭicca Samuppāda ist somit nicht nur ein Weg zur persönlichen Befreiung, sondern auch eine Grundlage für ein heilsameres Miteinander in der Welt. Es ist eine Einladung, die tiefgründige Struktur der Wirklichkeit zu erkennen und dadurch Freiheit und Weisheit zu kultivieren.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
- Pratityasamutpada – Encyclopedia of Buddhism
- Pratītyasamutpāda – Wikipedia
- Paticcasamuppada, Paticca-samuppada, Paṭiccasamuppāda: 9 definitions
- Paticcasamuppada – Bedingtes Entstehen mit einem Lächeln – Ajahn Mettiko – YouTube
- Bedingtes Entstehen – BuddhaStiftung
- Dependent Origination – Barre Center for Buddhist Studies
- Bedingtes Entstehen des Leidens – www.theravadanetz.de
- Dependent Origination – Seattle Insight Meditation Society
Weiter in diesem Bereich mit …
Nibbāna – Erlöschung, Befreiung
Was ist das höchste Ziel im Buddhismus? Nibbāna (Nirvāṇa) bedeutet wörtlich „Erlöschen“ – das Verlöschen der „Feuer“ von Gier, Hass und Verblendung. Entdecke, was dieser oft missverstandene Begriff wirklich meint: nicht Vernichtung, sondern die endgültige Befreiung vom Leiden (Dukkha) und dem Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra). Lerne Nibbāna als Zustand höchsten Friedens und das Unbedingte (Asaṅkhata) kennen.