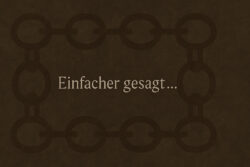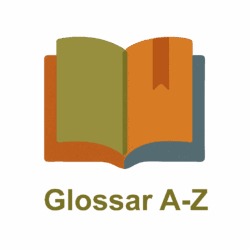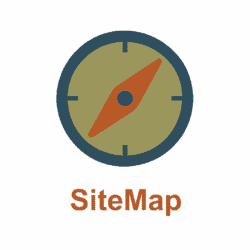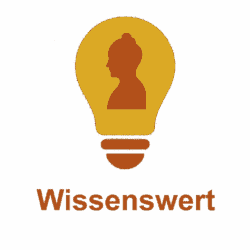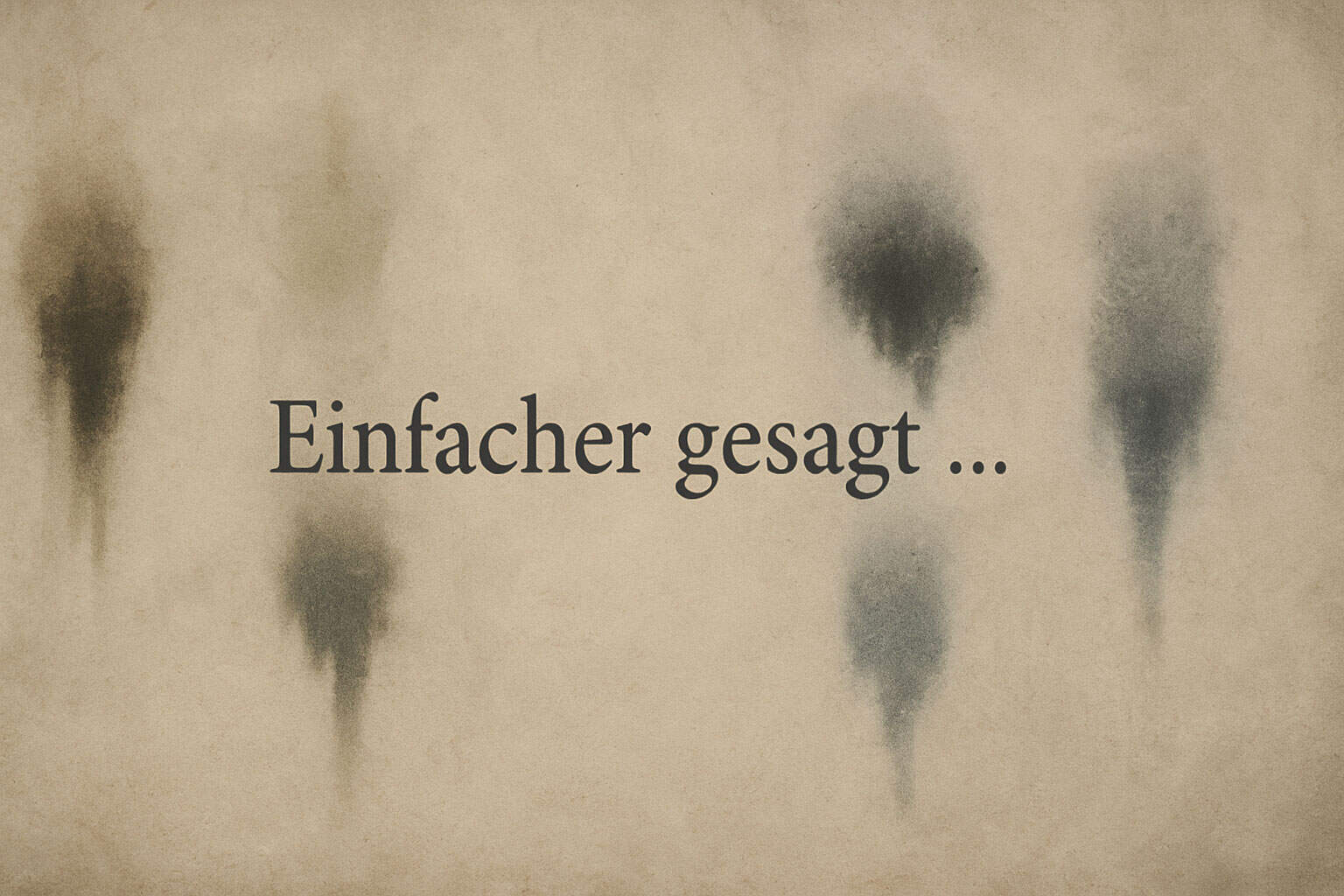
Die Triebe (Āsavas) im frühen Buddhismus: Ein klarer Leitfaden für Einsteiger
Die tief sitzenden, oft unbewussten Kräfte erkennen, die uns im leidvollen Kreislauf gefangen halten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die verborgenen Kräfte – Was sind die Āsavas?
- Definition: Was bedeutet „Āsava“?
- Die Gesichter der Triebe: Arten der Āsavas
- Die Āsavas in den Lehrreden des Buddha
- Bilder für das Unsichtbare: Gleichnisse und Analogien
- Den Trieben begegnen: Sieben Methoden zur Überwindung
- Im Netzwerk der Lehre: Verwandte Schlüsselbegriffe
- Ausblick: Der Pfad zur Befreiung
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
1. Einleitung: Die verborgenen Kräfte – Was sind die Āsavas?
Herzlich willkommen zu dieser Einführung in ein zentrales Konzept der buddhistischen Lehre: die Āsavas, oft mit „Triebe“ oder „Befleckungen“ übersetzt. Der Buddhismus, wie er in den ältesten Schriften, dem Palikanon, überliefert ist, beschreibt einen Weg zur Befreiung vom Leiden (dukkha), einem grundlegenden Merkmal unserer menschlichen Existenz. Doch was hält uns in diesem leidvollen Kreislauf gefangen?
Die Lehre des Buddha identifiziert hier tief sitzende, oft unbewusste Kräfte in unserem Geist, die uns immer wieder an das Rad des Werdens (saṃsāra) binden – eben diese Āsavas. Das Verständnis und vor allem die Überwindung dieser Triebe ist kein Nebenaspekt, sondern ein Kernstück der buddhistischen Praxis. Es ist der Prozess, der letztlich zur höchsten Befreiung führt, dem Zustand eines Arahants, eines „Heiligen“, der die Triebe vollständig zerstört hat (khīṇāsava).
Die Āsavas sind also nicht nur individuelle psychologische Unzulänglichkeiten, sondern werden als die fundamentalen Motoren betrachtet, die den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (saṃsāra) überhaupt erst antreiben und aufrechterhalten. Sie sind mehr als nur schlechte Angewohnheiten; sie sind die tiefsten Verunreinigungen, die unsere Wahrnehmung trüben und uns daran hindern, die Wirklichkeit klar zu erkennen.
Eine der wichtigsten Lehrreden zu diesem Thema, das Sabbāsava Sutta („Die Lehrrede über alle Triebe“) aus der Majjhima Nikāya (Sammlung der mittellangen Lehrreden), beginnt mit einer entscheidenden Feststellung des Buddha:
„Ihr Bhikkhus, ich sage, die Vernichtung der Triebe gibt es für einen, der weiß und sieht, nicht für einen, der nicht weiß und sieht.“
Was bedeutet dieses „Wissen und Sehen“ (ñāṇa-dassana)? Es geht nicht um bloßes intellektuelles Verständnis oder angelesenes Wissen. Vielmehr ist eine tiefere, durch Praxis und Achtsamkeit entwickelte Einsicht (paññā) gemeint. Das Sabbāsava Sutta führt weiter aus, dass dieses Wissen und Sehen sich auf das Erkennen von „weisem Erwägen“ (yoniso manasikāra) und „unweisem Erwägen“ (ayoniso manasikāra) bezieht. Die Art und Weise, wie wir unsere Aufmerksamkeit lenken und die Dinge betrachten, ist also entscheidend dafür, ob die Triebe in uns wachsen oder schwinden.
Die Überwindung der Āsavas ist somit kein passiver Vorgang, sondern erfordert eine aktive Schulung des Geistes und eine tiefgreifende Einsicht in seine Funktionsweise. Dieser Leitfaden möchte Ihnen helfen, dieses wichtige Konzept der Āsavas besser zu verstehen: Was genau sind sie? Welche Formen nehmen sie an? Wie beschreibt sie der Buddha in seinen Lehrreden? Und welche Wege zeigt er auf, um ihnen zu begegnen und sie letztlich zu überwinden?
2. Definition: Was bedeutet „Āsava“?
Um das Konzept der Āsavas zu verstehen, ist es hilfreich, die verschiedenen Bedeutungsebenen des Pali-Wortes āsava zu betrachten.
- Wörtliche Bedeutung: Das Wort leitet sich vom Verb ā-savati ab, was „hinzufließen“, „ausfließen“ oder „strömen“ bedeutet. Wörtliche Übersetzungen sind daher „Ausfluss“, „Einströmung“ oder „Einfluss“. Dieses Bild des Fließens steht in einem interessanten Kontrast zum Ziel des Buddhismus, Nibbāna (Nirwana), das oft als „Verlöschen“ oder „Stillstand“ beschrieben wird. Es deutet auf den Gegensatz zwischen dem Zustand des Getriebenseins im Fluss des Saṃsāra und dem befreiten Zustand hin, in dem dieser unheilsame Fluss zum Stillstand gekommen ist.
- Bildhafte Bedeutungen: Im ursprünglichen Sprachgebrauch hatte āsava auch konkretere, bildhafte Bedeutungen, die wichtige Aspekte der psychologischen Bedeutung beleuchten:
- Gegorener Saft, Alkohol, Rauschmittel: Āsava konnte einen fermentierten, berauschenden Trank bezeichnen. Diese Analogie betont die berauschende, verblendende und verwirrende Wirkung der Triebe auf den Geist. Sie machen unfähig, die Dinge klar zu sehen.
- Eiter, Wundsekret: Das Wort konnte auch den Ausfluss aus einer Wunde bezeichnen. Dieses Bild unterstreicht den unheilsamen, verunreinigenden, krankmachenden Aspekt der Āsavas. Sie sind wie ein Zeichen einer inneren Krankheit.
- Psychologische Bedeutung im Buddhismus: Im Kontext der buddhistischen Lehre beschreiben die Āsavas tief verwurzelte, oft unbewusste geistige Neigungen, Verunreinigungen oder Befleckungen, die den Geist trüben und das Leiden (dukkha) verursachen und aufrechterhalten. Gängige Übersetzungen versuchen, diese Dimension einzufangen:
- Triebe: Betont den antreibenden Charakter.
- Befleckungen / Verunreinigungen: Hebt den Aspekt hervor, dass sie den Geist verschmutzen.
- Gifte / Intoxikanten: Unterstreicht ihre schädliche, bewusstseinstrübende Wirkung.
- Kanker (engl. canker): Beschreibt den langsam zersetzenden Einfluss.
- Mentale Voreingenommenheiten (engl. mental bias): Verdeutlicht, wie sie Wahrnehmung und Denken färben.
Die Vielfalt der Übersetzungen und Bilder zeigt, dass die Āsavas ein vielschichtiges Phänomen sind. Sie wirken subtil, fließen unbemerkt ein, berauschen den Geist, zersetzen heilsame Qualitäten und treiben uns im Kreislauf des Leidens an. Jede Metapher beleuchtet eine andere Facette ihrer schädlichen Wirkung.
Abgrenzung zum Jainismus: Es ist wichtig zu wissen, dass der Begriff āsrava (die Sanskrit-Entsprechung) auch im Jainismus eine zentrale Rolle spielt. Dort bezeichnet er jedoch das Einströmen von Karma-Materie in die Seele. Der Buddhismus lehnt diese spezifische Theorie ab und verwendet āsava für mentale Phänomene.
3. Die Gesichter der Triebe: Arten der Āsavas
Die buddhistischen Texte, insbesondere die frühen Lehrreden (Suttas), unterscheiden üblicherweise drei oder vier Hauptarten von Āsavas. Diese Kategorien beschreiben die fundamentalen Bereiche, in denen sich der menschliche Geist verstrickt und Leiden erzeugt.
Die häufigste Aufzählung in den Suttas, die auch im Sabbāsava Sutta (MN 2) vorkommt, nennt drei Triebe:
- Der Sinnlichkeitstrieb (kāmāsava): Dies ist das tief verwurzelte Begehren nach und das Anhaften an angenehmen Sinneserfahrungen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) sowie an angenehmen Gedanken und Vorstellungen. Es ist die grundlegende Faszination und Verstrickung in die Welt der Sinnesobjekte.
- Der Daseinstrieb (bhavāsava): Dieser Trieb beschreibt das tiefe Verlangen nach Existenz, nach Werden, nach Fortbestand und Identität. Es ist der Wunsch, „jemand“ zu sein und weiter zu existieren. Dieser Trieb ist eng verbunden mit ego-bezogener Anhaftung und oft mit der falschen Ansicht eines ewigen Selbst.
- Der Unwissenheitstrieb (avijjāsava): Dies ist die grundlegendste Form der Verblendung und des Nicht-Wissens (avijjā oder moha). Sie bezieht sich auf das mangelnde Verständnis der wahren Natur der Wirklichkeit, insbesondere der Vier Edlen Wahrheiten, des Bedingten Entstehens und der Drei Daseinsmerkmale (Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbst). Avijjāsava gilt als die tiefste Wurzel, aus der die anderen Triebe erwachsen.
In einigen späteren Texten und auch in einigen Suttas wird oft noch ein vierter Trieb hinzugefügt:
- Der Ansichtstrieb (diṭṭhāsava): Dies bezeichnet das Festhalten an falschen Ansichten (diṭṭhi), spekulativen Meinungen, Ideologien und Theorien, insbesondere an Ansichten über ein dauerhaftes Selbst (sakkāya-diṭṭhi).
Zusammen decken diese drei bzw. vier Āsavas die zentralen Bereiche ab, in denen der menschliche Geist fehlgeleitet wird und sich verstrickt: die Ebene der Sinneswahrnehmung (kāma), der Existenz (bhava), der Konzepte (diṭṭhi) und der grundlegenden Erkenntnis (avijjā).
4. Die Āsavas in den Lehrreden des Buddha (Palikanon)
Die Āsavas sind ein wiederkehrendes Thema in den Lehrreden des Buddha, die in den Sammlungen des Palikanon überliefert sind. Besonders die Majjhima Nikāya (MN) und die Dīgha Nikāya (DN) enthalten wichtige Erklärungen.
Hauptquelle: Das Sabbāsava Sutta (MN 2 – „Die Lehrrede über alle Triebe“)
Diese Lehrrede gilt als die zentrale Abhandlung über die praktische Überwindung der Āsavas. Der Buddha betont, dass ihre Vernichtung „Wissen und Sehen“ erfordert, was er als das Verständnis von weiser und unweiser Aufmerksamkeit (yoniso und ayoniso manasikāra) identifiziert.
- Weise vs. Unweise Aufmerksamkeit: Der Buddha erklärt: „Wenn jemand unweise erwägt, entstehen Triebe, die noch nicht entstanden sind, und Triebe, die bereits entstanden sind, nehmen zu. Wenn jemand weise erwägt, entstehen Triebe nicht, die noch nicht entstanden sind, und Triebe, die bereits entstanden sind, werden überwunden.“ Unweise Aufmerksamkeit äußert sich z.B. im Grübeln über Vergangenheit/Zukunft oder Identitätsfragen („Wer bin ich?“).
- Das Entstehen der Triebe: Durch unweise Aufmerksamkeit entstehen und wachsen die drei Haupttriebe: Sinnlichkeitstrieb (kāmāsava), Daseinstrieb (bhavāsava) und Unwissenheitstrieb (avijjāsava).
- Sieben Methoden: Das Herzstück des Suttas bildet die Darlegung von sieben spezifischen Methoden zur Überwindung der Triebe (siehe Abschnitt 6), was Flexibilität und situationsangemessenes Handeln erfordert.
(Quelle: Majjhima Nikāya 2, Sabbāsava Sutta)
Kontext aus dem Sāmaññaphala Sutta (DN 2 – „Die Früchte des Asketenlebens“)
Diese Lehrrede beschreibt den buddhistischen Übungsweg stufenweise.
- Die Zerstörung der Triebe als höchstes Ziel: Am Ende des Pfades (der sīla, samādhi, jhānas, abhiññā umfasst) steht das Wissen von der Zerstörung der Triebe (āsavakkhayañāṇa). Der Text beschreibt diesen Höhepunkt: „Sein Herz, so wissend, so sehend, wird frei vom Trieb der Sinnlichkeit (kāmāsava), frei vom Trieb des Werdens (bhavāsava), frei vom Trieb der Unwissenheit (avijjāsava). In der Befreiung entsteht das Wissen: ‚Befreit!‘ Er erkennt: ‚Geburt ist zerstört, das heilige Leben ist erfüllt, die Aufgabe getan. Es gibt kein weiteres Werden in irgendeinem Zustand.‘“ Dies zeigt, dass die Überwindung das Ergebnis umfassenden Trainings ist.
(Quelle: Dīgha Nikāya 2, Sāmaññaphala Sutta)
Erwähnung im Mahāparinibbāna Sutta (DN 16 – „Die Große Lehrrede vom endgültigen Verlöschen“)
Diese Lehrrede beschreibt die letzten Monate und das Verlöschen (parinibbāna) des Buddha.
- Der Arahant als Khīṇāsava: Der Zustand des Buddha und anderer vollkommen befreiter Schüler (Arahants) wird oft als khīṇāsava bezeichnet – „einer, dessen Triebe versiegt sind“. Die Lehrrede illustriert durch diese Personen den Zustand der Freiheit von den Trieben.
(Quelle: Dīgha Nikāya 16, Mahāparinibbāna Sutta)
Diese Beispiele zeigen, dass die Āsavas ein zentrales Thema sind, das Ursache, Weg und Ziel der Befreiung definiert.
5. Bilder für das Unsichtbare: Gleichnisse und Analogien
Da die Āsavas oft unbewusste Kräfte sind, verwendet die buddhistische Tradition verschiedene Bilder:
Kanonische und traditionelle Bilder:
- Ausfluss / Strömung (Ogha): Wie eine Flut, die uns im Leiden gefangen hält. Betont das Unaufhaltsame, Subtile und Mitreißende.
- Gärstoff / Rauschmittel (Intoxicant): Wie Alkohol, der den Geist berauscht, trübt und unfähig zu klarem Sehen macht.
- Eiter / Wundsekret: Wie der Ausfluss einer Wunde, der innere Krankheit, Unreinheit und Schmerzhaftigkeit symbolisiert.
- Kanker (engl. Canker): Betont den langsam fortschreitenden, korrodierenden Einfluss, der heilsame Qualitäten untergräbt.
- Joch / Bande (Yoga): Wie Fesseln, die uns ans Rad des Saṃsāra binden.
Die Metaphern aus den Bereichen des Flüssigen und der Krankheit/Verunreinigung vermitteln die subtile, pervasive und schädliche Natur der Āsavas.
Moderne und erklärende Analogien:
- Tiefsitzende Gewohnheiten / Neigungen (engl. biases, propensities): Wie eingefahrene mentale Muster oder unbewusste Voreingenommenheiten.
- Mentale „Viren“ oder „Malware“: Wie schädliche Programme, die im Hintergrund laufen und das System (Geist) stören.
- „Lecks“ im Geist (engl. Leakages): Wie undichte Stellen, durch die wertvolle geistige Energie oder Klarheit verloren geht (basierend auf der chinesischen Übersetzung lòu).
- Schlamm im Wasser: Latente Triebe (anusaya) sind wie Schlamm am Boden. Bei Aufwühlung (Sinnesreiz) trüben sie das Wasser (die manifesten Āsavas erscheinen).
- Schießpulver: Latente Neigungen sind wie inaktives Schießpulver. Ein Auslöser (Reibung) entzündet es (die Āsavas flammen auf). Ein Arahant ist wie ein Streichholz ohne Schießpulver.
- Suchtverhalten: Ähnelt psychologischen Suchtmodellen (Auslöser → Verlangen → Handlung → Verstärkung).
Diese modernen Analogien helfen, die psychologischen Mechanismen – automatisiert, oft unbewusst, sich selbst verstärkend – nachzuvollziehen und die Wichtigkeit von Achtsamkeit und Einsicht zu verstehen.
6. Den Trieben begegnen: Sieben Methoden zur Überwindung (aus MN 2)
Das Sabbāsava Sutta (MN 2) legt sieben Methoden dar, um den Trieben zu begegnen:
| Methode (Pali) | Methode (Deutsch) | Kurzbeschreibung (Kernidee) |
|---|---|---|
| 1. Dassanā | Durch Sehen/Durchschauen | Überwindung durch Einsicht in die Vier Edlen Wahrheiten und das Erkennen, welche Gedanken/Aufmerksamkeit heilsam bzw. unheilsam sind (weise Aufmerksamkeit). |
| 2. Saṁvarā | Durch Zügeln/Kontrolle | Überwindung durch bewusste Zurückhaltung und Kontrolle der sechs Sinne (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist), um auf Reize nicht automatisch zu reagieren. |
| 3. Paṭisevanā | Durch (rechten) Gebrauch | Überwindung durch achtsamen und zweckmäßigen Gebrauch der Lebensgrundlagen (Kleidung, Nahrung, Unterkunft, Medizin), nicht aus Gier oder Eitelkeit. |
| 4. Adhivāsanā | Durch Ertragen/Dulden | Überwindung durch geduldiges Ertragen von Unangenehmem (Hitze, Kälte, Hunger, Schmerz, harte Worte), ohne darauf mit Ablehnung oder Verzweiflung zu reagieren. |
| 5. Parivajjanā | Durch Vermeiden | Überwindung durch bewusstes Meiden von Gefahren, unheilsamen Orten, Situationen oder schlechter Gesellschaft, die Triebe auslösen könnten. |
| 6. Vinodanā | Durch Zerstreuen/Beseitigen | Überwindung durch aktives Vertreiben, Loslassen und Nicht-Nähren von bereits aufgestiegenen unheilsamen Gedanken (Gier, Hass, Grausamkeit). |
| 7. Bhāvanā | Durch Entfalten/Entwickeln | Überwindung durch Kultivierung der sieben Erleuchtungsglieder (Achtsamkeit, Wirklichkeitserforschung, Energie, Freude, Ruhe, Sammlung, Gleichmut). |
Detailliertere Erläuterung:
- Durch Sehen/Durchschauen (Dassanā): Entwicklung von Weisheit (paññā) durch Verstehen der Vier Edlen Wahrheiten und Anwendung weiser Aufmerksamkeit (yoniso manasikāra). Zentral ist das Durchschauen der Ich-Illusion. Überwindet v.a. den Ansichtstrieb (diṭṭhāsava).
- Durch Zügeln/Kontrolle (Saṁvarā): Praxis der Sinnenkontrolle (indriya-saṁvara). Achtsamkeit an den Sinnestoren, um nicht automatisch mit Gier/Ablehnung auf Reize zu reagieren.
- Durch (rechten) Gebrauch (Paṭisevanā): Achtsamer Umgang mit Lebensbedürfnissen (Kleidung, Nahrung etc.) zur Unterstützung der Praxis, nicht aus Genusssucht oder Eitelkeit.
- Durch Ertragen/Dulden (Adhivāsanā): Geduldiges Ertragen unvermeidlicher Schwierigkeiten (Hitze, Kälte, Schmerz, harte Worte), ohne in Widerstand oder Klage zu verfallen.
- Durch Vermeiden (Parivajjanā): Kluge Prävention durch bewusstes Meiden von Situationen, Orten oder Personen, die Triebe stark auslösen.
- Durch Zerstreuen/Beseitigen (Vinodanā): Aktives Unterbrechen, Vertreiben und Nicht-Nähren bereits aufgestiegener unheilsamer Gedanken (Begierde, Hass etc.).
- Durch Entfalten/Entwickeln (Bhāvanā): Aktive Kultivierung heilsamer Geisteszustände, v.a. der sieben Erleuchtungsglieder (satta bojjhaṅgā).
Diese Methoden zeigen einen ganzheitlichen Ansatz: präventiv (Zügeln, Gebrauch, Vermeiden), reaktiv (Ertragen, Zerstreuen) und proaktiv-kultivierend (Sehen, Entfalten). Während Bhāvanā eng mit Meditation verbunden ist, finden die anderen Methoden v.a. im Alltag Anwendung. Die Überwindung erfordert beides.
7. Im Netzwerk der Lehre: Verwandte Schlüsselbegriffe
Die Āsavas sind eng mit anderen Kernkonzepten verbunden:
- Unwissenheit (avijjā): Die Wurzel aller Triebe. Ihre Beseitigung durch Weisheit (paññā) ist der Schlüssel zur Überwindung der Āsavas.
- Begehren (taṇhā): Die unmittelbare Ursache des Leidens (Zweite Edle Wahrheit). Die Āsavas (v.a. kāmāsava, bhavāsava) sind tief verwurzelte Manifestationen dieses Begehrens. Taṇhā ist der akute Durst, die Āsavas die latenten Neigungen, die ihn nähren.
- Ansichten (diṭṭhi): Falsche Ansichten, v.a. die Ich-Ansicht (sakkāya-diṭṭhi), werden als diṭṭhāsava selbst zu einem Trieb.
- Nicht-Selbst (anattā): Die Einsicht in anattā ist das direkte Gegenmittel zur Ich-Ansicht und untergräbt fundamental den Daseinstrieb (bhavāsava). Wenn es kein Selbst gibt, woran soll man festhalten?
- Leidenserlöschen (dukkhanirodha): Das Ziel des Weges (Nibbāna) ist identisch mit der vollständigen Zerstörung der Triebe (āsavakkhaya).
Das System: Unwissenheit führt zu Trieben, die sich als Begehren und Festhalten an Ansichten zeigen. Dies verursacht Leiden. Weisheit (v.a. Einsicht in Nicht-Selbst) durchbricht dies, zerstört die Triebe und führt zum Leidenserlöschen.
Die Überwindung geschieht stufenweise: Der Ansichtstrieb fällt beim Stromeintritt, der Sinnlichkeitstrieb bei Nichtwiederkehr, der Daseins- und Unwissenheitstrieb bei Arahantship.
8. Ausblick: Der Pfad zur Befreiung
Wir haben gesehen, dass die Āsavas – Triebe zur Sinnlichkeit, Existenz, falschen Ansichten und Unwissenheit – tiefgreifende mentale Kräfte sind, die uns im leidvollen Kreislauf (saṃsāra) gefangen halten.
Die Lehre Buddhas zeigt jedoch, dass sie durch bewusste Praxis überwunden werden können. Der Weg basiert auf Ethik (sīla), Sammlung (samādhi) und Weisheit (paññā). Das Sabbāsava Sutta (MN 2) bietet mit sieben Methoden (Sehen, Zügeln, Gebrauch, Ertragen, Vermeiden, Zerstreuen, Entfalten) einen praktischen Leitfaden.
Das Ziel ist Nibbāna, die vollständige Befreiung vom Leiden, gleichbedeutend mit dem Zustand des Khīṇāsava – desjenigen, dessen Triebe versiegt sind. Es ist ein Zustand unerschütterlichen Friedens und tiefster Einsicht.
Diese Einführung ist nur ein erster Einblick. Die Auseinandersetzung mit den Āsavas ist ein lebenslanger Prozess der Selbsterkenntnis und erfordert engagierte praktische Übung. Möge dieser Leitfaden Sie zu weiterer Beschäftigung anregen und vielleicht zu ersten Schritten auf dem Pfad der Achtsamkeit und Einsicht, der zu wahrer Freiheit führen kann.
Hinweis zur Pali-Schreibung: Die in diesem Text verwendeten Pali-Begriffe (die Sprache der ältesten buddhistischen Schriften) werden gemäß dem International Alphabet of Sanskrit Transliteration (IAST) wiedergegeben. Dieses System verwendet diakritische Zeichen (z.B. das Makron über dem ā in Āsava), um die korrekte Aussprache der Laute anzudeuten. Die Darstellung erfolgt mittels UTF-8-Kodierung, um eine möglichst breite Kompatibilität auf verschiedenen Geräten und Plattformen zu gewährleisten.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
- Four Noble Truths – Wikipedia
- Kernaussagen des Buddhismus – Religion – Planet Wissen
- āsava – Palikanon
- Asava – Wikipedia
- Definitions for: āsava – SuttaCentral
- Asava: Significance and symbolism – Wisdomlib
- The Great Total Unbinding Discourse Mahā Parinibbāna Sutta (DN 16) – dhammatalks.org
- Āsrava – Encyclopedia of Buddhism
Weiter in diesem Bereich mit …
Die Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni)
Welche spezifischen geistigen Ketten binden uns an den leidvollen Kreislauf? Die Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni) beschreiben die konkreten Hindernisse, die auf dem Weg zur Befreiung (Nibbāna) überwunden werden müssen. Von der Ich-Illusion (Sakkāya-diṭṭhi) über Zweifel (Vicikicchā) und Sinnenlust (Kāma-rāga) bis hin zu subtilerem Dünkel (Māna) und Unwissenheit (Avijjā) – lerne diese Fesseln kennen und erfahre, wie ihr schrittweises Durchtrennen die Stufen der Erleuchtung markiert.