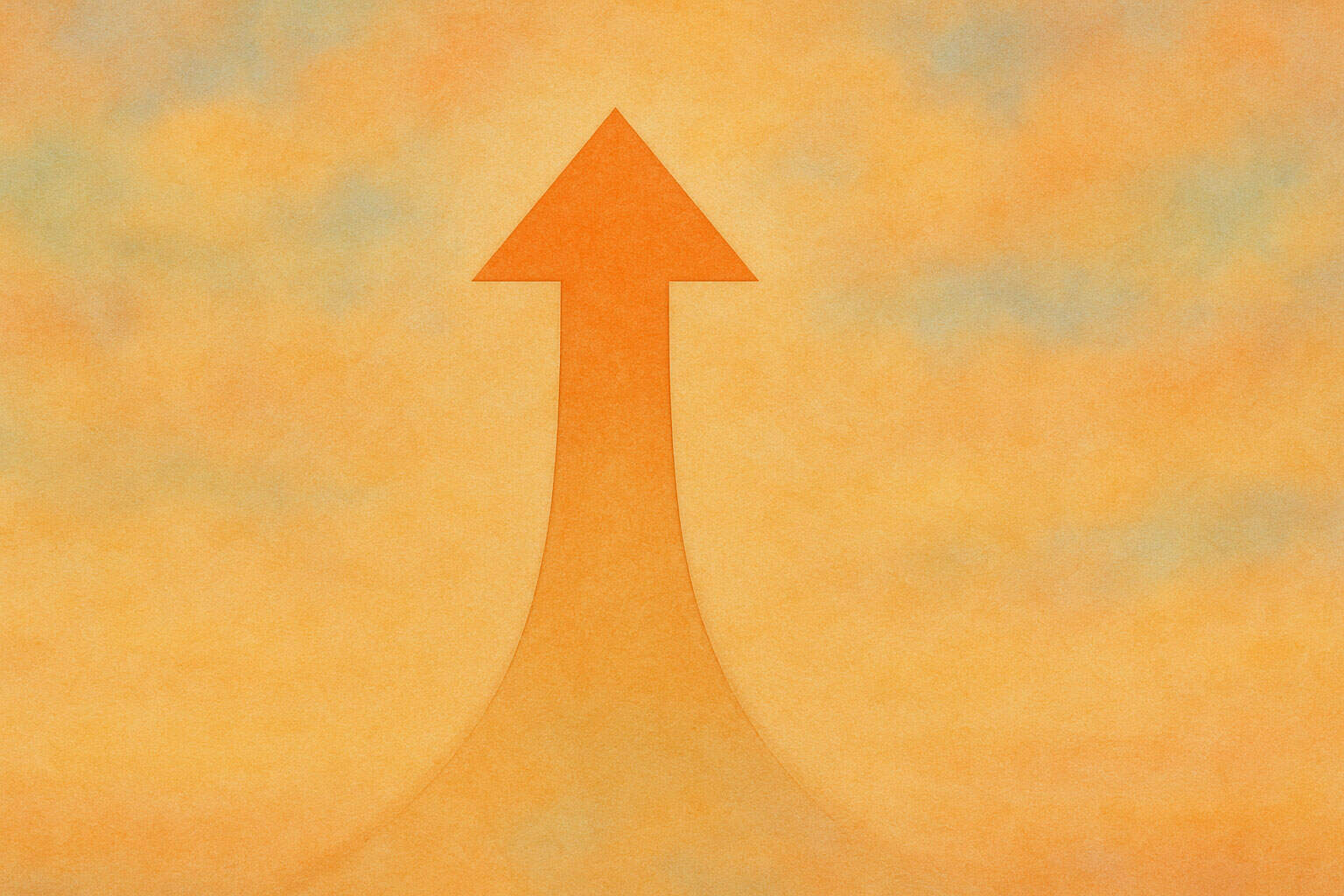
Bhavāsava (Daseinstrieb): Der Trieb zum Dasein im Buddhismus
Eine Einführung in den Daseinstrieb und seine Rolle im Kontext der Āsavas
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Die Āsavas – Mentale Triebe oder Einflüsse im Buddhismus
Im Herzen der buddhistischen Lehre vom Leiden (Dukkha) und seiner Überwindung stehen die sogenannten Āsavas. Diese zentralen Konzepte beschreiben tief verwurzelte mentale Verunreinigungen, Triebe oder „Einflüsse“, die das Bewusstsein trüben und Lebewesen im leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) gefangen halten. Die Übersetzung des Pāli-Begriffs Āsava ins Deutsche ist vielfältig und spiegelt die Komplexität des Konzepts wider: „Triebe“, „Einflüsse“, „Gifte“, „Rauschmittel“, „Befleckungen“ oder „Verderbnisse“ sind gebräuchliche Übertragungen. Jede dieser Übersetzungen hebt einen Aspekt der subtilen, korrumpierenden und leidverursachenden Natur der Āsavas hervor.
Die Etymologie des Wortes gibt weitere Hinweise auf seine Bedeutung. Āsava leitet sich von der Pāli-Wurzel ā + √su ab, was „fließen“ bedeutet. Dies kann sowohl als „Ausfluss“ (wie Eiter aus einer Wunde oder der Saft einer Pflanze) als auch als „Zufluss“ (wie durch ein Leck einströmendes Wasser) interpretiert werden. Diese Doppeldeutigkeit ist aufschlussreich: Die Āsavas sind einerseits tiefsitzende innere Verunreinigungen, die aus dem Geist „heraussickern“ oder ihn wie ein Rauschmittel „berauschen“ und vergiften. Andererseits wirken sie wie Kanäle, durch die äußere Sinnesreize unheilsame Reaktionen im Geist auslösen und ihn beeinflussen („Zufluss“). Die buddhistischen Texte selbst betonen die Funktion der Āsavas als Zustände, die „verunreinigen, neues Dasein hervorbringen, Schwierigkeiten bereiten, im Leiden reifen und zu zukünftiger Geburt, Altern und Tod führen“.
Die Wurzel „fließen“ und die Beschreibung in den Lehrreden, dass Āsavas unter bestimmten Bedingungen entstehen und unter anderen vergehen, deuten darauf hin, dass sie keine statischen, unveränderlichen Wesenszüge sind. Vielmehr handelt es sich um dynamische Prozesse oder Tendenzen. Sie werden durch Bedingungen wie unweise Aufmerksamkeit (Ayoniso Manasikāra) aktiviert und genährt, können aber durch bewusste Praxis, insbesondere durch weise Aufmerksamkeit (Yoniso Manasikāra), reduziert und schließlich beseitigt werden. Sie sind Ausdruck latenter Neigungen (Anusaya), die unter bestimmten Umständen als aktive Begierden oder Verblendungen in Erscheinung treten. Diese Prozesshaftigkeit ist fundamental, denn sie impliziert die Veränderbarkeit dieser leidvollen Zustände und bildet die Grundlage für den buddhistischen Befreiungsweg.
Der Pālikanon klassifiziert typischerweise vier Hauptarten von Āsavas:
- Kāmāsava: Der Sinnentrieb, das Verlangen nach Sinnesfreuden.
- Bhavāsava: Der Daseinstrieb oder Werdenstrieb, das Verlangen nach Existenz.
- Diṭṭhāsava: Der Ansichtentrieb, das Festhalten an falschen Ansichten.
- Avijjāsava: Der Unwissenheitstrieb, die grundlegende Verblendung.
Gelegentlich findet sich in den Texten auch eine ältere Liste, die nur die ersten beiden und den vierten Āsava nennt, also Kāmāsava, Bhavāsava und Avijjāsava.
Dieser Bericht konzentriert sich auf den Begriff Bhavāsava, den Daseins- oder Werdenstrieb. Ziel ist es, diesen Begriff im Kontext der vier Āsavas klar zu definieren und zu erläutern sowie auf relevante Lehrreden (Suttas) aus den Hauptsammlungen des Pāli-Kanons zu verweisen, die ein tieferes Verständnis ermöglichen.
2. Bhavāsava – Der Trieb zum Dasein
Bhavāsava setzt sich zusammen aus den Pāli-Wörtern Bhava (Werden, Existenz, Dasein) und Āsava (Trieb, Einfluss, Ausfluss). Es bezeichnet den tief verwurzelten, oft unbewussten Trieb, das Verlangen oder die Begierde nach Existenz und kontinuierlichem Werden. Es ist das instinktive Festhalten am Leben, die Sehnsucht nach Fortbestand und die Angst vor dem Vergehen, sei es in der gegenwärtigen Form oder in einer zukünftigen Wiedergeburt.
Dieses Verlangen nach Existenz ist eng mit dem Konzept des Bhava (Werdens) im Bedingten Entstehen (Paṭiccasamuppāda) verknüpft. Bhava ist das Glied in dieser Kette der Abhängigkeiten, das unmittelbar zur Geburt (Jāti) führt, welche wiederum unausweichlich Alter, Tod, Kummer, Schmerz und Leiden (Jarāmaraṇa, Dukkha) nach sich zieht. Bhavāsava ist die treibende mentale Kraft hinter diesem Prozess des Werdens; es ist der Durst nach Leben, der uns im Saṃsāra, dem endlosen Kreislauf von Geburt und Tod, gefangen hält.
Das Verlangen nach Dasein manifestiert sich auf verschiedenen Ebenen der Existenz, die in der buddhistischen Kosmologie beschrieben werden:
- Verlangen nach Existenz in der Sinnenwelt (Kāma-Bhava): Das Begehren, in Welten wiedergeboren zu werden, die von Sinnesobjekten und deren Genuss geprägt sind (wie die Menschenwelt oder bestimmte Himmelswelten).
- Verlangen nach Existenz in feinkörperlichen Welten (Rūpa-Bhava): Die Sehnsucht nach Wiedergeburt in höheren, subtileren Daseinsformen, die oft mit der Erfahrung tiefer meditativer Zustände (Jhāna) verbunden sind und als angenehmen und dauerhafter empfunden werden.
- Verlangen nach Existenz in unkörperlichen Welten (Arūpa-Bhava): Das subtilste Verlangen nach Existenz in rein geistigen Sphären, die durch die höchsten meditativen Vertiefungen erreicht werden und durch extrem lange Lebensspannen gekennzeichnet sind.
Bhavāsava umfasst auch subtilere Formen des Anhaftens, wie den Wunsch nach ewigem Bestehen (Ewigkeitshoffnung) oder umgekehrt die nihilistische Angst vor völliger Auslöschung nach dem Tod, was sich im Verlangen nach Nicht-Werden (Vibhava-Taṇhā) äußert. Beide Extreme – der Glaube an ein ewiges Selbst und der Glaube an die völlige Vernichtung – wurzeln im Bhavāsava, dem Festhalten an einer Form von Sein oder Nicht-Sein.
Psychologisch betrachtet geht Bhavāsava über das reine Verlangen nach zukünftiger Wiedergeburt hinaus. Es manifestiert sich im alltäglichen Leben als das Festhalten an der eigenen Identität, am Gefühl des „Ich-Seins“, und als die tief sitzende Angst vor Vergänglichkeit, Verlust und dem eigenen Tod. Dieses Verlangen nach Existenz ist untrennbar mit der Konstruktion und Aufrechterhaltung eines Selbstbildes verbunden.
Lehrreden wie das Sammādiṭṭhi Sutta (MN 9) zeigen, dass die Überwindung der zugrundeliegenden Neigung zur Ansicht und zum Dünkel „Ich bin“ (Asmimāna) ein zentraler Schritt zur Befreiung ist. Das Sabbāsava Sutta (MN 2) illustriert, wie unweise Aufmerksamkeit zu existenziellen Fragen wie „Bin ich? Bin ich nicht? Was bin ich?“ führt, die direkt die Āsavas nähren. Bhavāsava ist somit nicht nur der Wunsch weiterzuleben, sondern die grundlegende Tendenz, sich mit den vergänglichen Bestandteilen der Erfahrung – Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, Geistesformationen, Bewusstsein (den fünf Aggregaten oder Khandhas) – zu identifizieren und daraus ein vermeintlich beständiges „Selbst“ zu konstruieren. Die Angst vor dem Nichts oder der Auslöschung befeuert diesen Trieb zusätzlich.
Folglich ist die Überwindung von Bhavāsava eng mit der Entwicklung von Einsicht in Nicht-Selbst (Anattā) und der Auflösung dieser Ich-Identifikation verknüpft. Praktiken, die zu dieser Einsicht führen, zielen direkt auf die Wurzel des Daseinstriebs ab.
3. Die Vier Āsavas im Überblick
Um Bhavāsava vollständig zu verstehen, ist es hilfreich, es im Kontext der anderen drei Āsavas zu betrachten, mit denen es zusammen die Gruppe der vier grundlegenden mentalen Triebe bildet:
- Kāmāsava (Sinnestrieb): Dies ist das Verlangen nach und das Anhaften an angenehmen Sinneserfahrungen, die durch die fünf physischen Sinne vermittelt werden: ansprechende Formen und Farben (Sehen), angenehme Klänge (Hören), wohlriechende Düfte (Riechen), köstliche Geschmäcker (Schmecken) und angenehme Berührungen (Tasten). Es ist die Gier nach sinnlichem Vergnügen und die Abneigung gegen unangenehme Sinneserfahrungen.
- Diṭṭhāsava (Ansichtentrieb): Dies bezieht sich auf das Festhalten an falschen Ansichten, Meinungen, Spekulationen, Dogmen und Ideologien. Dazu gehören insbesondere Ansichten, die die wahre Natur der Realität (Daseinsmerkmale) – Vergänglichkeit (Anicca), Leidhaftigkeit (Dukkha) und Nicht-Selbst (Anattā) – leugnen oder verdrehen. Es umfasst auch das Beharren auf der eigenen Meinung als der einzig richtigen und überlegenen, sowie metaphysische Spekulationen über die Ewigkeit oder Nicht-Ewigkeit der Welt oder des Selbst.
- Avijjāsava (Unwissenheitstrieb): Dies ist die fundamentalste Verunreinigung – die grundlegende Unwissenheit (Avijjā) oder Verblendung bezüglich der wahren Natur der Phänomene. Sie bezieht sich insbesondere auf das Nichtverstehen der Vier Edlen Wahrheiten und des Bedingten Entstehens (Paṭiccasamuppāda). Diese Unwissenheit bildet die Wurzel, aus der die anderen Āsavas und das gesamte Leiden entstehen.
Die folgende Tabelle fasst die vier Āsavas zusammen:
| Pāli Begriff | Deutsche Übersetzung (Beispiele) | Kernbedeutung |
|---|---|---|
| Kāmāsava | Sinnestrieb, Trieb der Sinneslust | Verlangen nach/Anhaften an angenehmen Sinnes- und Geistobjekten |
| Bhavāsava | Daseinstrieb, Werdenstrieb | Verlangen nach Existenz, Werden, Fortbestand; Festhalten am Leben/Ich-Sein |
| Diṭṭhāsava | Ansichtentrieb, Spekulationstrieb | Festhalten an falschen Ansichten, Meinungen, Ideologien |
| Avijjāsava | Unwissenheitstrieb | Grundlegende Unwissenheit/Verblendung bzgl. der Realität (Vier Edle Wahrheiten) |
Diese vier Triebe wirken nicht isoliert voneinander, sondern sind eng miteinander verflochten und verstärken sich gegenseitig. Die Unwissenheit (Avijjāsava) bildet die grundlegende Bedingung, aus der die anderen Triebe Nahrung ziehen. Falsche Ansichten (Diṭṭhāsava), wie der Glaube an ein ewiges Selbst, können das Verlangen nach Sinnesfreuden (Kāmāsava) oder nach fortwährender Existenz (Bhavāsava) rechtfertigen und intensivieren. Umgekehrt wurzelt das Festhalten an Sinnesfreuden und Existenz in der Unwissenheit über deren letztlich unbefriedigende, vergängliche und substanzlose Natur.
Obwohl oft als gleichrangige Liste präsentiert, legen die Texte eine gewisse Hierarchie und eine klare Abfolge ihrer Überwindung auf dem buddhistischen Pfad nahe. Avijjāsava ist die fundamentalste Wurzel. Diṭṭhāsava, insbesondere die Ich-Ansicht (Sakkāya-Diṭṭhi), wird typischerweise als erstes auf der Stufe des Stromeintritts (Sotāpatti) durchbrochen. Kāmāsava wird auf der Stufe des Nichtwiederkehrers (Anāgāmī) vollständig beseitigt. Bhavāsava und die letzten Reste von Avijjāsava werden erst mit der vollen Erwachung, der Arahantschaft, endgültig zerstört. Diese Progression verdeutlicht, dass die Befreiung ein schrittweiser Prozess ist.
Die enge Verflechtung der Āsavas bedeutet jedoch, dass die Praxis auf allen Ebenen ansetzen muss: ethisches Verhalten (Sīla), geistige Sammlung (Samādhi) und insbesondere die Entwicklung von Weisheit (Paññā), um die grundlegende Unwissenheit zu durchdringen.
4. Lehrreden (Suttas) zur Vertiefung: Āsavas im Pālikanon
Zahlreiche Lehrreden im Pālikanon erwähnen die Āsavas, da ihre Überwindung das zentrale Ziel der buddhistischen Praxis darstellt. Einige Suttas behandeln sie jedoch besonders ausführlich und bieten wertvolle Einblicke in ihre Natur und die Methoden zu ihrer Beseitigung. Im Folgenden werden drei solcher Schlüsseltexte aus dem Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN) vorgestellt. Hinweis: Erklärende Texte zu Lehrreden finden sich im Lehrreden-Verzeichnis.
Majjhima Nikāya (MN)
- MN 2: Sabbāsava Sutta (Alle Triebe)
- Relevanz: Dieses Sutta gilt als eine der grundlegendsten und praktischsten Anleitungen zur Überwindung der Āsavas. Es legt systematisch sieben verschiedene Methoden dar, wie diese tiefsitzenden Verunreinigungen gehandhabt und beseitigt werden können. Der Buddha betont hier, dass die Vernichtung der Triebe (Āsavakkhaya) nur für denjenigen möglich ist, der „weiß und sieht“ (jānato passato), was insbesondere die Fähigkeit zur weisen, zweckdienlichen Aufmerksamkeit (Yoniso Manasikāra) im Gegensatz zur unweisen, ablenkenden Aufmerksamkeit (Ayoniso Manasikāra) impliziert. Unweise Aufmerksamkeit lässt unentstandene Triebe entstehen und bereits entstandene anwachsen, während weise Aufmerksamkeit dies verhindert bzw. zur Aufgabe der Triebe führt.
- Inhalt (Die Sieben Methoden): Das Sutta präsentiert einen umfassenden Werkzeugkasten für die Praxis:
- Überwindung durch Sehen (Dassanā Pahātabbā): Dies bezieht sich auf die Einsicht in die Vier Edlen Wahrheiten und das Durchschauen falscher Ansichten, insbesondere spekulativer Fragen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Selbst („War ich? Bin ich? Werde ich sein?“).
- Überwindung durch Zügelung/Kontrolle (Saṁvarā Pahātabbā): Hier geht es um die bewusste Kontrolle der sechs Sinnesfakultäten (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist), um zu verhindern, dass beim Kontakt mit Sinnesobjekten Begierde, Abneigung oder Verblendung aufkommen und den Geist beherrschen.
- Überwindung durch (weisen) Gebrauch (Paṭisevanā Pahātabbā): Die vier Lebensgrundlagen – Kleidung, Nahrung, Unterkunft und Medizin – sollen bewusst und reflektiert nur für ihren notwendigen Zweck genutzt werden (Schutz, Erhaltung des Körpers, Gesundheit) und nicht aus Genusssucht oder Anhaftung.
- Überwindung durch Erdulden (Adhivāsanā Pahātabbā): Entwicklung von Geduld und Widerstandskraft gegenüber unvermeidlichen Widrigkeiten wie extremen Temperaturen, Hunger, Durst, Insektenstichen, beleidigenden Worten und körperlichen Schmerzen.
- Überwindung durch Vermeiden (Parivajjanā Pahātabbā): Kluges Meiden von offensichtlichen Gefahrenquellen, seien es gefährliche Tiere, Orte oder unheilsame Gesellschaft, die das Entstehen von Trieben fördern könnten.
- Überwindung durch Beseitigen/Zerstreuen (Vinodanā Pahātabbā): Aktives Vertreiben und Nicht-Nähren von bereits aufgestiegenen unheilsamen Gedanken wie sinnlichem Begehren, Hass oder Gewaltabsichten.
- Überwindung durch Entfalten (Bhāvanā Pahātabbā): Die Kultivierung heilsamer Geisteszustände, insbesondere der sieben Erleuchtungsglieder (Bojjhaṅga: Achtsamkeit, Wirklichkeitsergründung, Tatkraft, Freude, Ruhe, Sammlung, Gleichmut).
- Quellenangabe: MN 2, Sabbāsava Sutta (Alle Triebe). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/mn2/de/ | MN 2 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- MN 9: Sammādiṭṭhi Sutta (Rechte Ansicht)
- Relevanz: In dieser Lehrrede erklärt der Ehrwürdige Sāriputta, einer der Hauptschüler des Buddha, detailliert das Konzept der Rechten Ansicht (Sammā-Diṭṭhi), dem ersten Glied des Edlen Achtfachen Pfades. Er tut dies auf verschiedenen Ebenen, beginnend mit dem grundlegenden Verständnis von Heilsamem (Kusala) und Unheilsamem (Akusala) sowie deren Wurzeln (Nicht-Gier, Nicht-Hass, Nicht-Verblendung bzw. Gier, Hass, Verblendung). Das Sutta zeigt auf, wie dieses tiefere Verständnis zur Überwindung der Āsavas führt, insbesondere der Unwissenheit (Avijjāsava) und der falschen Ansichten (Diṭṭhāsava). Die Erklärung schreitet fort über das Verständnis von Nahrung (Āhāra), der Vier Edlen Wahrheiten und der zwölf Glieder des Bedingten Entstehens bis hin zum expliziten Verständnis der Āsavas selbst als abschließendem Kriterium für Rechte Ansicht.
- Inhalt (Bezug zu Āsavas): Das Sutta stellt fest, dass ein Edler Schüler (jemand, der zumindest die Stufe des Stromeintritts erreicht hat) Rechte Ansicht besitzt, wenn er die Āsavas, ihren Ursprung (Samudaya), ihre Aufhebung (Nirodha) und den zur Aufhebung führenden Weg (Nirodhagāminī Paṭipadā) versteht. Obwohl Bhavāsava nicht isoliert analysiert wird, ist die im Sutta erwähnte Ausrottung der „zugrundeliegenden Neigung zur Ansicht und zum Dünkel ‚Ich bin‘“ (Asmimāna-Anusaya) direkt mit der Überwindung von Bhavāsava (dem Trieb zum Ich-Sein) und Diṭṭhāsava (der Ich-Ansicht) verbunden. Das gesamte Sutta zielt durch die Erklärung kausaler Zusammenhänge auf die Beseitigung der grundlegenden Unwissenheit (Avijjā) und somit auf die Wurzel des Avijjāsava.
- Quellenangabe: MN 9, Sammādiṭṭhi Sutta (Rechte Ansicht). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/mn9 | MN 9 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Dīgha Nikāya (DN)
- DN 2: Sāmaññaphala Sutta (Die Früchte des Asketenlebens)
- Relevanz: Dieses umfangreiche und bedeutende Sutta zeichnet ein detailliertes Bild des gesamten buddhistischen Übungsweges, wie er einem Laien (König Ajātasattu) erklärt wird. Es beschreibt die „stufenweise Übung“ (Anupubbī-Sikkhā), beginnend mit ethischem Verhalten (Sīla), über die Zügelung der Sinne, Achtsamkeit und Zufriedenheit, die Überwindung der fünf Hindernisse (Nīvaraṇa), das Erreichen der meditativen Vertiefungen (Jhāna) bis hin zur Entwicklung der höheren Geisteskräfte und Wissen (Abhiññā). Der absolute Höhepunkt und das letztendliche Ziel dieses gesamten Pfades ist das Erlangen des „Wissens um die Zerstörung der Triebe“ (Āsavakkhaya-Ñāṇa).
- Inhalt (Bezug zu Āsavas): Das Sutta führt die Āsavas (hier in der Regel die drei: Kāmāsava, Bhavāsava, Avijjāsava) im Kontext des höchsten Wissens auf, das zur endgültigen Befreiung (Arahantschaft) führt. Es beschreibt, wie der Praktizierende, dessen Geist durch Sammlung gefestigt und geläutert ist, die Vier Edlen Wahrheiten in Bezug auf das Leiden erkennt und dann entsprechend auch die Āsavas selbst durchschaut: „Er versteht wirklichkeitsgemäß: ‚Dies sind die Triebe.‘ Er versteht wirklichkeitsgemäß: ‚Dies ist der Ursprung der Triebe.‘ Er versteht wirklichkeitsgemäß: ‚Dies ist die Aufhebung der Triebe.‘ Er versteht wirklichkeitsgemäß: ‚Dies ist der zur Aufhebung der Triebe führende Weg.‘“. Mit diesem direkten Wissen und Sehen wird sein Geist von den Trieben befreit. Bhavāsava, der Trieb zum Dasein, wird hier explizit als eine der fundamentalen Verunreinigungen genannt, deren Zerstörung für die Befreiung notwendig ist.
- Quellenangabe: DN 2, Sāmaññaphala Sutta (Die Früchte des Asketenlebens). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/dn2 | DN 2 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Die Betrachtung dieser drei Lehrreden offenbart unterschiedliche, sich ergänzende Perspektiven auf die Āsavas. Das Sabbāsava Sutta (MN 2) bietet einen sehr praktischen, methodischen Ansatz mit sieben konkreten Techniken für den Alltag und die Meditationspraxis. Das Sāmaññaphala Sutta (DN 2) positioniert die Zerstörung der Āsavas als das höchste Ziel und Ergebnis des gesamten spirituellen Pfades, erreicht durch tiefgreifende Einsicht, die auf fortgeschrittener Tugend-, Sammlungs- und Weisheitsentwicklung basiert. Das Sammādiṭṭhi Sutta (MN 9) wiederum betont die kognitive Dimension – das richtige Verstehen der Lehre (Rechte Ansicht) als entscheidendes Mittel zur Überwindung, insbesondere von falschen Ansichten und Unwissenheit. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte zeigen, dass die Überwindung der Āsavas ein vielschichtiger Prozess ist, der ethisches Verhalten, geistige Sammlung, intellektuelles Verständnis und intuitive Einsicht gleichermaßen erfordert.
5. Weitere Erwähnungen der Āsavas in den Nikāyas
Neben den bereits genannten Schlüsseltexten finden sich die Āsavas in vielen weiteren Lehrreden der vier Hauptsammlungen (Nikāyas) des Pāli-Kanons.
Samyutta Nikāya (SN)
Eine Durchsicht der Kapitelstruktur des Samyutta Nikāya (Sammlung der Gruppierten Lehrreden) ergibt, dass es kein eigenes Kapitel (Saṃyutta) gibt, das ausschließlich oder primär den Āsavas gewidmet ist. Der Begriff Āsava und insbesondere das Ziel ihrer Zerstörung (Āsavakkhaya) tauchen jedoch sehr häufig in verschiedenen Kapiteln auf. Dies geschieht vor allem in Kontexten, die sich mit grundlegenden Lehrkonzepten befassen, wie:
- Nidāna Saṃyutta (SN 12): Die Lehrreden über das Bedingte Entstehen. Hier wird die Unwissenheit (Avijjā) als Wurzelbedingung für den Leidensprozess identifiziert, was direkt mit dem Avijjāsava korreliert.
- Magga Saṃyutta (SN 45): Die Lehrreden über den Edlen Achtfachen Pfad, der als Weg zur Aufhebung der Āsavas beschrieben wird.
- Bojjhaṅga Saṃyutta (SN 46): Die Lehrreden über die sieben Erleuchtungsglieder, deren Entfaltung zur Überwindung der Āsavas beiträgt (siehe Methode 7 in MN 2).
- Khandha Saṃyutta (SN 22) und Saḷāyatana Saṃyutta (SN 35): Die Lehrreden über die Daseinsaggregate und die Sinnesgrundlagen. Das Durchschauen ihrer wahren Natur (vergänglich, leidhaft, nicht-selbst) ist entscheidend für die Beseitigung der Anhaftung und damit der Āsavas. Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel finden sich im Lehrreden-Verzeichnis.
Die Zerstörung der Triebe (Āsavakkhaya) wird durchweg als Synonym für das Erreichen der Arahantschaft, der höchsten Stufe der Befreiung, verwendet.
Aṅguttara Nikāya (AN)
Die Aṅguttara Nikāya (Sammlung der Angereihten Lehrreden) enthält ebenfalls zahlreiche relevante Suttas. Eine besonders hervorzuhebende und oft zitierte Lehrrede ist:
- AN 6.63: Nibbedhika Sutta (Die durchdringende Lehrrede)
- Relevanz: Dieses Sutta ist bekannt für seine tiefgründige und systematische Analyse von sechs zentralen Themen des Dhamma: Sinnesvergnügen (Kāma), Gefühl (Vedanā), Wahrnehmung (Saññā), Triebe (Āsava), Handlung (Kamma) und Leiden (Dukkha). Jedes dieser Themen wird anhand einer sechsstufigen Struktur untersucht, die stark an die Analyse der Vier Edlen Wahrheiten erinnert:
- Definition: Was ist es?
- Ursprung: Wodurch entsteht es? (Nidānasambhava)
- Vielfalt: Welche Formen gibt es? (Vemattatā)
- Ergebnis/Frucht: Was bewirkt es? (Vipāka)
- Aufhebung: Wie hört es auf? (Nirodha)
- Weg zur Aufhebung: Was führt zur Aufhebung? (Nirodhagāminī Paṭipadā).
- Inhalt (Analyse der Āsavas): Das Sutta wendet diese Struktur explizit auf die Āsavas an:
- Was sind Āsavas? Genannt werden hier die drei Triebe: Kāmāsava (Sinnentrieb), Bhavāsava (Daseinstrieb) und Avijjāsava (Unwissenheitstrieb).
- Ursprung der Āsavas? Unwissenheit (Avijjā) wird als deren Quelle identifiziert.
- Vielfalt der Āsavas? Es wird unterschieden zwischen Trieben, die zu leidvollen Wiedergeburten in niederen Bereichen (Hölle, Tierreich, Hungergeisterreich) führen, und solchen, die zu Wiedergeburten in höheren Bereichen (Menschenwelt, Götterwelten) führen. Dies zeigt, dass auch scheinbar positive Daseinsformen noch von den subtileren Trieben (insbesondere Bhavāsava und Avijjāsava) durchdrungen sind.
- Ergebnis der Āsavas? Sie sind die Ursache für die fortwährende Entstehung einer neuen „Selbst-Existenz“ (Attabhāva) im Kreislauf der Wiedergeburten, entsprechend der Qualität der zugrundeliegenden Triebe und Handlungen.
- Aufhebung der Āsavas? Ihre vollständige Aufhebung geschieht durch die Aufhebung der Unwissenheit (Avijjānirodha).
- Weg zur Aufhebung der Āsavas? Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Aufhebung der Unwissenheit und damit zur Aufhebung aller Triebe führt.
- Quellenangabe: AN 6.63, Nibbedhika Sutta (Die durchdringende Lehrrede). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/an6.63 | AN 6.63 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- Relevanz: Dieses Sutta ist bekannt für seine tiefgründige und systematische Analyse von sechs zentralen Themen des Dhamma: Sinnesvergnügen (Kāma), Gefühl (Vedanā), Wahrnehmung (Saññā), Triebe (Āsava), Handlung (Kamma) und Leiden (Dukkha). Jedes dieser Themen wird anhand einer sechsstufigen Struktur untersucht, die stark an die Analyse der Vier Edlen Wahrheiten erinnert:
- AN 6.58: Āsava Sutta (Triebe): Dieses Sutta listet sechs der sieben Methoden zur Überwindung der Triebe aus MN 2 auf (lässt „Sehen“ aus) und betont, dass ein Mönch, der diese Methoden anwendet und die entsprechenden Triebe überwunden hat, höchster Verehrung würdig ist, ein „vollkommenes Feld für Verdienst in der Welt“ (anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa). Dies unterstreicht die immense praktische Bedeutung dieser Überwindungsstrategien.
- Quellenangabe: AN 6.58, Āsava Sutta (Triebe), Link: https://suttacentral.net/an6.58/de/
Die Gegenüberstellung von AN 6.63 und MN 2 verdeutlicht erneut die komplementären Ansätze im Kanon. Während AN 6.63 eine hochstrukturierte, analytische Zerlegung des Konzepts Āsava bietet, die dessen kausale Einbettung und Funktion im Gesamtgefüge der Lehre beleuchtet (Ursprung, Ergebnis, Aufhebung etc.), konzentriert sich MN 2 auf die konkreten, anwendbaren Methoden zur Beseitigung im praktischen Leben und in der Meditation. Die analytische Tiefe von AN 6.63 dient der Förderung von Weisheit (Paññā), während die praktischen Anleitungen von MN 2 direkt auf das Verhalten (Sīla) und die Geistesschulung (Samādhi) abzielen. Beide Aspekte – tiefes Verständnis und praktische Anwendung – sind für die vollständige Überwindung der Āsavas unerlässlich.
6. Zusammenfassung und Ausblick
Der Pāli-Begriff Bhavāsava bezeichnet den tiefgreifenden Trieb zum Dasein, das Verlangen nach fortwährender Existenz und das Festhalten am Ich-Sein. Er ist einer der vier fundamentalen Āsavas (Triebe, Einflüsse, Verunreinigungen) – neben Kāmāsava (Sinnestrieb), Diṭṭhāsava (Ansichtentrieb) und Avijjāsava (Unwissenheitstrieb) –, die den Geist verblenden und Lebewesen im leidvollen Kreislauf des Saṃsāra gefangen halten.
Die Überwindung dieser Āsavas ist das erklärte Ziel der buddhistischen Praxis und führt zur Befreiung, zu Nibbāna. Dieser Zustand wird im Pālikanon oft als Āsavakkhaya bezeichnet – die „Zerstörung der Triebe“ – und ist gleichbedeutend mit der Erlangung der Arahantschaft.
Die vorgestellten Lehrreden bieten unterschiedliche, aber sich ergänzende Perspektiven auf die Āsavas und ihre Überwindung:
- MN 2 (Sabbāsava Sutta) liefert einen praktischen Leitfaden mit sieben Methoden zur Handhabung der Triebe im täglichen Leben und in der Meditation.
- MN 9 (Sammādiṭṭhi Sutta) betont die Bedeutung der Rechten Ansicht und des Verständnisses grundlegender Lehren wie Kusala/Akusala und Bedingtes Entstehen für die Beseitigung der Triebe, insbesondere von falschen Ansichten und Unwissenheit.
- DN 2 (Sāmaññaphala Sutta) positioniert die Zerstörung der Triebe als das höchste Ziel des gesamten stufenweisen buddhistischen Pfades, erreicht durch die Kultivierung von Tugend, Sammlung und tiefster Einsicht.
- AN 6.63 (Nibbedhika Sutta) bietet eine detaillierte analytische Struktur zum Verständnis der Ursachen, Wirkungen und der Überwindung der Triebe im Kontext anderer zentraler buddhistischer Konzepte.
Das Verständnis von Bhavāsava und den anderen Āsavas kann die eigene spirituelle Praxis maßgeblich informieren. Es schärft die Achtsamkeit für subtile Formen des Anhaftens – sei es an Sinnesfreuden, an der eigenen Existenz und Identität oder an festgefahrenen Meinungen. Es motiviert zur Hinterfragung eigener Ansichten und zur Kultivierung von Einsicht in die universellen Merkmale der Vergänglichkeit (Anicca), der Leidhaftigkeit (Dukkha) und des Nicht-Selbst (Anattā), welche die Grundlage für die Befreiung von den Āsavas bilden.
Die Auseinandersetzung mit diesen Konzepten ist ein fortlaufender Prozess. Die Lektüre der hier genannten Lehrreden im Original oder in vertrauenswürdigen Übersetzungen kann diesen Prozess vertiefen und zu einem persönlicheren, erfahrungsbasierten Verständnis führen.
Ressourcen wie SuttaCentral (https://suttacentral.net/) bieten einen unschätzbaren Zugang zu diesen alten Texten und ihren vielfältigen Interpretationen.
Möge dieses Wissen als Inspiration dienen, den Pfad zur Befreiung von den Trieben mit Weisheit und Mitgefühl zu beschreiten.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.
- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.
- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.
- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.
- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.
- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Ansichtentrieb (Diṭṭhāsava)
Der Ansichtentrieb (Diṭṭhāsava) beschreibt das Festhalten an falschen Ansichten (Micchā Diṭṭhi), spekulativen Meinungen und starren Doktrinen über dich selbst und die Welt. Lerne hier, warum nicht Ansichten an sich das Problem sind, sondern das Anhaften (Upādāna) an ihnen. Erfahre, welche typischen falschen Ansichten (wie der Glaube an ein ewiges Selbst oder die Leugnung von Ursache und Wirkung ) im Buddhismus identifiziert werden und warum die Überwindung dieses Triebs ein entscheidender erster Schritt auf dem Befreiungsweg ist.







