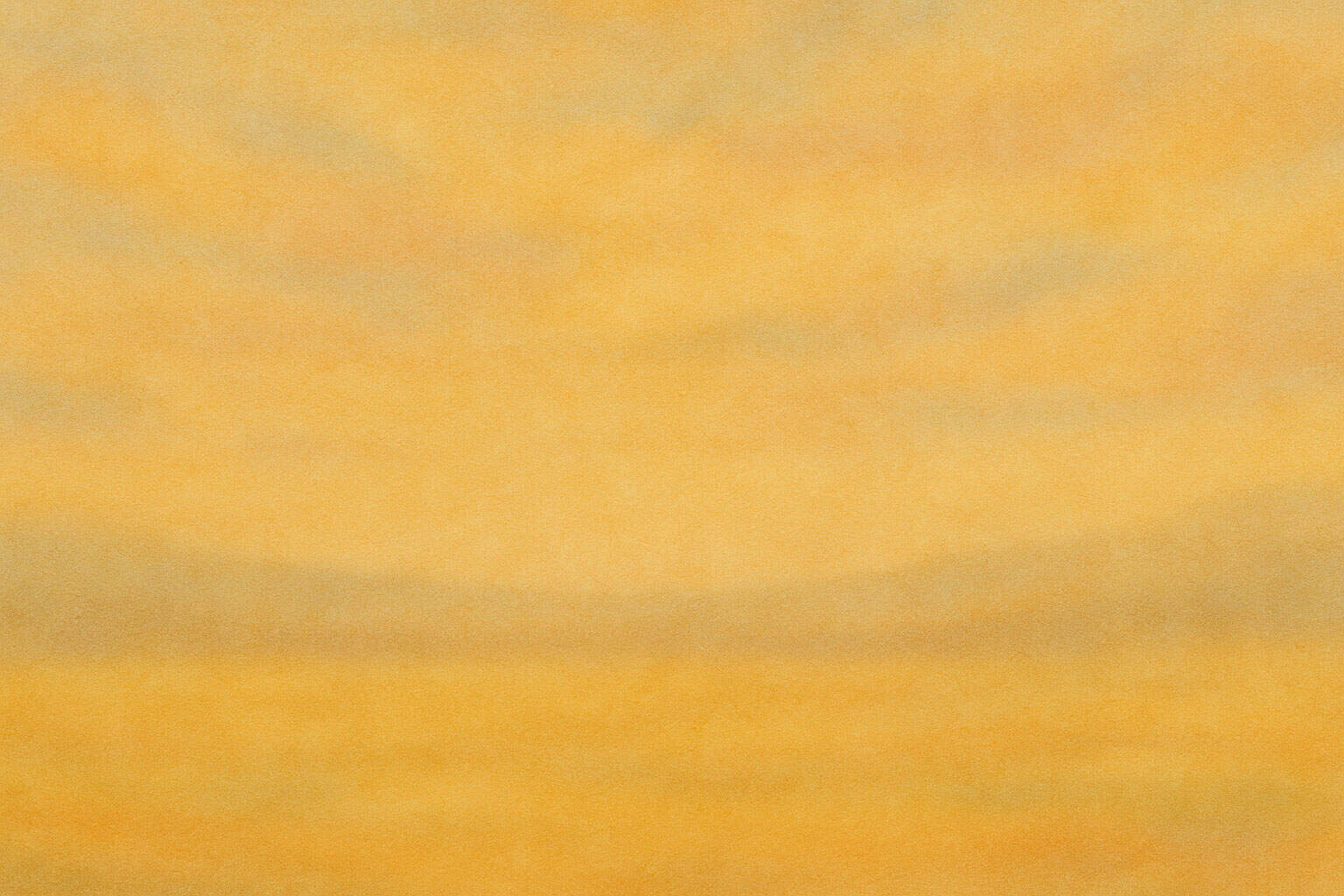
Avijjāsava (Unwissenheitstrieb) und das Konzept der Āsavas im Pālikanon
Der grundlegende Trieb des Nichtwissens und seine Rolle im Buddhismus
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Der Pāli-Begriff Avijjāsava (Unwissenheitstrieb)
Ein tieferes Verständnis der buddhistischen Lehre erfordert oft eine Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen in Pāli, der Sprache, in der uns die ältesten Lehrreden des Buddha überliefert sind. Diese Begriffe tragen Bedeutungsnuancen, die für das Verständnis der buddhistischen Geistesschulung und des Befreiungsweges wesentlich sind.
Einer dieser Schlüsselbegriffe ist Avijjāsava, häufig übersetzt als „Unwissenheitstrieb“ oder „Trieb der Unwissenheit“.
Dieser Bericht zielt darauf ab, den Begriff Avijjāsava zu definieren, ihn in den größeren Kontext des Konzepts der Āsavas (Triebe, Einflüsse) einzuordnen und auf zentrale Lehrreden (Suttas) aus den Sammlungen des Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN) des Pālikanons zu verweisen, die diesen Begriff und das damit verbundene Konzept beleuchten. Ergänzend werden Hinweise auf relevante Texte im Saṃyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN) gegeben.
Der Bericht richtet sich an deutschsprachige Laien des Buddhismus, die bereits über Grundkenntnisse verfügen und ihr Verständnis durch Verweise auf die Originalquellen vertiefen möchten, soll aber auch für Interessierte ohne Vorkenntnisse zugänglich sein.
2. Das Konzept der Āsavas: Die Triebe als Wurzel des Leidens
Um Avijjāsava zu verstehen, ist es notwendig, das übergeordnete Konzept der Āsavas zu betrachten, zu dem es gehört.
Definition Āsava
Der Pāli-Begriff Āsava (Sanskrit: Āśrava) leitet sich etymologisch wahrscheinlich von der Wurzel √su oder √sru („fließen“) in Verbindung mit dem Präfix ā- („hinzu“, „hinein“ oder auch „heraus“) ab. Diese Herkunft spiegelt sich in den vielfältigen Übersetzungsversuchen wider: „Triebe“, „Einflüsse“, „Strömungen“, „Ausflüsse“, „Fermentationen“, „Verderbnisse“ oder „Befleckungen“. Jede Übersetzung beleuchtet eine Facette der Bedeutung:
- „Fließen“: Die Āsavas können als etwas verstanden werden, das beständig aus dem Geist „herausfließt“ oder in ihn „hineinfließt“ und ihn so prägt und beeinflusst. Sie sind wie Strömungen, die uns im Kreislauf der Wiedergeburten mitreißen.
- „Fermentation“: Diese Metapher betont den langsam zersetzenden, korrumpierenden Charakter der Āsavas. Ähnlich wie der Ausfluss aus einer schwärenden Wunde oder der Gärungsprozess bei der Herstellung von Alkohol, „infizieren“ und „vergiften“ die Āsavas den Geist, trüben die Wahrnehmung und verhindern spirituellen Fortschritt. Sie wirken oft subtil und unbemerkt, wie ein innerer Gärungsprozess, der den Geist „berauscht“ und unfähig macht, die Dinge klar zu sehen.
Diese bildhaften Beschreibungen deuten darauf hin, dass die Āsavas keine oberflächlichen Fehler oder einfachen Willensakte sind, sondern tief verwurzelte, subtile Neigungen und Verunreinigungen (Kilesa) des Geistes. Sie sind „zugrundeliegende Neigungen“ oder „mentale Befleckungen“, die oft unbewusst wirken.
Die Haupt-Āsavas
Die Lehrreden nennen meist vier Haupt-Āsavas:
- Kāmāsava (Sinnlichkeitstrieb): Das tiefsitzende Verlangen nach angenehmen Erfahrungen durch die fünf physischen Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) und den Geist (angenehme Vorstellungen, Erinnerungen).
- Bhavāsava (Daseins-/Werdenstrieb): Das Verlangen nach Fortexistenz, nach Werden und Wiedergeburt, sei es in feinstofflichen oder grobstofflichen Daseinsbereichen. Es beinhaltet den Wunsch nach ewigem Leben oder auch die Angst vor der völligen Vernichtung.
- Diṭṭhāsava (Ansichtstrieb): Das Festhalten an falschen, spekulativen oder fixen Ansichten und Meinungen, insbesondere solchen, die die wahre Natur der Wirklichkeit (Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, Nicht-Selbst) leugnen oder missinterpretieren, wie z. B. der Glaube an eine ewige Seele oder die Leugnung von Ursache und Wirkung.
- Avijjāsava (Unwissenheitstrieb): Das grundlegende Nichtwissen oder die Verblendung bezüglich der fundamentalen Wahrheiten des Daseins. Dieser wird im nächsten Abschnitt detaillierter behandelt.
Häufig findet sich in den Suttas auch eine Liste von nur drei Āsavas: Kāmāsava, Bhavāsava und Avijjāsava. Diese Dreierliste wird oft als die ältere angesehen. In diesem Fall wird der Ansichtstrieb (Diṭṭhāsava) manchmal als Aspekt des Daseinstriebs (z. B. Ansichten über Ewigkeit/Vernichtung) oder des Unwissenheitstriebs (als Folge der Verblendung) verstanden.
Rolle im Saṃsāra
Die Āsavas sind die fundamentalen Kräfte, die den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) antreiben und aufrechterhalten. Sie sind der „Treibstoff“ für die Wiedergeburt. Die Lehrreden (z. B. in MN 9) beschreiben sie als „Zustände, die beflecken, neues Dasein bewirken, Ärger machen, in Leid reifen und zu künftiger Geburt, Altern und Tod führen“. Die Befreiung aus dem Saṃsāra, das Erreichen von Nibbāna, ist daher gleichbedeutend mit der vollständigen Zerstörung dieser Triebe (Āsavakkhaya). Die subtile und tiefgreifende Natur der Āsavas macht deutlich, warum ihre Überwindung eine umfassende und beständige Geistesschulung erfordert, die weit über bloße Verhaltensänderungen hinausgeht und vielfältige Methoden einschließt.
Die vier Āsavas im Überblick
Die folgende Tabelle fasst die vier Āsavas zusammen und gibt einen Hinweis auf die Stufe des buddhistischen Pfades, auf der sie primär überwunden werden (basierend auf traditionellen Kommentaren und relevanten Textstellen).
| Pāli-Begriff | Deutsche Übersetzung(en) | Kurzbeschreibung | Überwindung durch (primär) |
|---|---|---|---|
| Kāmāsava | Sinnlichkeitstrieb | Verlangen nach angenehmen Sinneserfahrungen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Denken) | Pfad der Nichtwiederkehr (Anāgāmī) |
| Bhavāsava | Daseins-/Werdenstrieb | Verlangen nach Fortexistenz, Werden, Wiedergeburt | Arahantschaft (Arahant) |
| Diṭṭhāsava | Ansichtstrieb | Festhalten an falschen Ansichten (z. B. über ein Selbst, Ewigkeit/Vernichtung) | Pfad des Stromeintritts (Sotāpanna) |
| Avijjāsava | Unwissenheitstrieb | Fundamentales Nichtwissen über die wahre Natur der Dinge (Vier Wahrheiten, Nicht-Selbst etc.) | Arahantschaft (Arahant) |
3. Avijjāsava im Detail: Nichtwissen als grundlegender Trieb
Der Avijjāsava ist der „Ausfluss“ oder „Trieb“ der Unwissenheit (Avijjā). Avijjā bedeutet wörtlich „Nicht-Wissen“. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen Mangel an alltäglichem Wissen oder intellektueller Bildung, sondern um ein tiefgreifendes, fundamentales Nicht-Verstehen der Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist.
Im Kern bezieht sich Avijjā auf die Unkenntnis der Vier Edlen Wahrheiten: die Wahrheit vom Leiden (Dukkha), von der Leidensentstehung (Samudaya, primär das Begehren), von der Leidensaufhebung (Nirodha, Nibbāna) und vom achtfachen Pfad (Magga), der zur Leidensaufhebung führt. Eng damit verbunden ist das Nicht-Verstehen des Gesetzes der Bedingten Entstehung (Paṭiccasamuppāda), das erklärt, wie Leiden durch eine Kette von Ursachen und Wirkungen entsteht und wie es durch das Brechen dieser Kette beendet werden kann.
Avijjā ist die grundlegende Verblendung (Moha), die uns die wahre Natur der Phänomene verkennen lässt. Sie führt dazu, dass wir das Vergängliche (Anicca) für beständig halten, das Leidhafte (Dukkha) für Glück und das Unpersönliche oder Nicht-Selbst (Anattā) für ein eigenständiges, permanentes Selbst oder eine Seele.
Diese Unwissenheit wird oft als die tiefste Wurzel aller anderen geistigen Verunreinigungen (Kilesa) und des gesamten leidvollen Daseinskreislaufs betrachtet. Im Schema der Bedingten Entstehung steht Avijjā an erster Stelle als die grundlegende Bedingung, aus der alle weiteren leidvollen Faktoren hervorgehen. Folglich ist die Überwindung von Avijjā durch das Kultivieren von Weisheit (Paññā) oder Wissen (Vijjā) der entscheidende Schlüssel zur Befreiung (Nibbāna).
Die Bezeichnung als Āsava („Trieb“, „Ausfluss“, „Fermentation“) deutet darauf hin, dass Avijjā nicht nur eine passive Abwesenheit von Wissen ist, sondern eine aktive, gestaltende Kraft im Geist. Unwissenheit lenkt die Aufmerksamkeit fehl (Ayoniso Manasikāra) und führt aktiv zur Entstehung und Verstärkung der anderen Triebe wie Begierde und Festhalten an Ansichten. Sie „infiziert“ und „schwächt“ den Geist, lässt uns leidhafte Dinge für erstrebenswert halten und bildet die Grundlage für wucherndes, konzeptuelles Denken (Papañca), das uns weiter von der Realität entfernt. Avijjā ist somit eine tief verwurzelte, aktive Fehlwahrnehmung und Fehlinterpretation der Realität, die nicht allein durch Informationsaufnahme, sondern durch meditative Einsicht (Vipassanā) und die Entwicklung befreiender Weisheit (Paññā) überwunden werden muss.
Der Begriff „Trieb“ unterstreicht diesen aktiven, drängenden Charakter der Unwissenheit.
4. Schlüssel-Lehrreden (Suttas) zu Avijjāsava und den Āsavas
Obwohl die Āsavas und ihre Überwindung ein zentrales Thema in vielen Lehrreden des Pālikanons sind, gibt es einige Suttas, die sich besonders intensiv damit befassen.
Im Folgenden werden wichtige Beispiele aus den Sammlungen Dīgha Nikāya (DN), Majjhima Nikāya (MN), Saṃyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN) vorgestellt. Hinweis: Erklärende Texte zu Lehrreden finden sich im Lehrreden-Verzeichnis.
Majjhima Nikāya (MN)
MN 2: Sabbāsava Sutta (Die Lehrrede über alle Triebe / Alle Anhaftungen)
- Relevanz: Dieses Sutta gilt als die zentrale Lehrrede über die praktische Herangehensweise zur Überwindung der Āsavas. Der Buddha betont eingangs, dass die Zerstörung der Triebe nur für denjenigen möglich ist, der „weiß und sieht“ (jānato passato), was auf der Grundlage von „weisem Erwägen“ (Yoniso Manasikāra) geschieht – im Gegensatz zum „unweisen Erwägen“ (Ayoniso Manasikāra), das die Triebe erst entstehen lässt und verstärkt.
- Inhalt: Der Kern des Suttas besteht aus der Darlegung von sieben Methoden, mit denen die Āsavas überwunden werden können:
- Durch Sehen (Dassanā Pahātabbā): Das direkte Erkennen und Durchdringen der Vier Edlen Wahrheiten durch Einsicht. Dies führt unmittelbar zur Aufgabe der ersten drei der zehn Fesseln (Saṃyojana), nämlich der Persönlichkeitsansicht (Sakkāya-Diṭṭhi), des skeptischen Zweifels (Vicikicchā) und des Hängens an Regeln und Ritualen (Sīlabbata-Parāmāsa).
- Durch Kontrolle/Zügelung (Saṃvarā Pahātabbā): Die achtsame Beherrschung und Bewachung der sechs Sinnestore (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist), um zu verhindern, dass durch Sinneskontakte unheilsame Geisteszustände und damit die Triebe entstehen oder genährt werden.
- Durch (weisen) Gebrauch (Paṭisevanā Pahātabbā): Die reflektierte und zweckmäßige Nutzung der vier Lebensgrundlagen (Kleidung, Nahrung, Unterkunft, Medizin). Sie sollen nicht dem Luxus, der Sinnenfreude oder der Eitelkeit dienen, sondern lediglich der Lebenserhaltung, dem Schutz vor Unannehmlichkeiten und der Unterstützung der spirituellen Praxis.
- Durch Ertragen/Duldsamkeit (Adhivāsanā Pahātabbā): Das geduldige und gleichmütige Ertragen von unvermeidlichen Schwierigkeiten und unangenehmen Erfahrungen wie Kälte, Hitze, Hunger, Durst, schmerzhaften Gefühlen, Insektenstichen und beleidigenden Worten, ohne dass dadurch Ärger, Widerstand oder Verzweiflung aufkommen.
- Durch Vermeiden (Parivajjanā Pahātabbā): Das bewusste Meiden von bekannten Gefahrenquellen, seien es gefährliche Tiere, unsichere Orte oder unheilsame Gesellschaft („schlechte Freunde“), die die Praxis behindern oder zu unheilsamen Handlungen verleiten könnten.
- Durch Beseitigen/Vertreiben (Vinodanā Pahātabbā): Das aktive Erkennen, Aufgeben und Vertreiben von bereits aufgestiegenen unheilsamen Gedanken und Geisteszuständen, insbesondere Gedanken der Begierde, des Hasses (Übelwollens) und der Grausamkeit.
- Durch Entwickeln/Kultivieren (Bhāvanā Pahātabbā): Die systematische Entfaltung der sieben Erleuchtungsglieder (Bojjhaṅga) – Achtsamkeit, Wirklichkeitsergründung, Energie, Freude, Stille, Sammlung und Gleichmut – die auf Loslösung, Entsagung und Aufhebung ausgerichtet sind und direkt zur Befreiung führen.
- Quellenangabe: MN 2, Sabbāsava Sutta. Deutsche Titel: „Die Lehrrede über alle Triebe“ (Mettiko), „Alle Anhaftungen“ (Nyanaponika/Palikanon.de), „Alles Wähnen“ (Neumann). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/mn2 | MN 2 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Dīgha Nikāya (DN)
DN 2: Sāmaññaphala Sutta (Die Früchte des Asketenlebens)
- Relevanz: Dieses umfangreiche Sutta beschreibt detailliert den buddhistischen Schulungsweg als Antwort auf die Frage von König Ajātasattu nach den sichtbaren Früchten eines Lebens als Asket. Die höchste Frucht und der Höhepunkt dieses Weges ist die Befreiung des Geistes durch die Zerstörung der Āsavas (Āsavakkhaya).
- Inhalt: Der Buddha legt dar, wie ein Mönch durch Einhalten der ethischen Regeln (Sīla), Zügelung der Sinne, Achtsamkeit und Genügsamkeit die fünf Hindernisse (Nīvaraṇa) überwindet und die meditativen Vertiefungen (Jhāna) erreicht. Darauf aufbauend können verschiedene höhere Geisteskräfte und Wissen (Abhiññā) entwickelt werden. Das höchste dieser Wissen ist das „Wissen um die Zerstörung der Triebe“ (Āsavakkhaya-Ñāṇa). Der Praktizierende erkennt: „Dies ist Leiden… Dies ist die Entstehung… Dies ist die Aufhebung… Dies ist der Pfad.“ Er erkennt die Triebe in sich und versteht, wie sie zerstört werden. Mit dieser Erkenntnis ist sein Geist befreit von Kāmāsava, Bhavāsava und Avijjāsava. Er weiß: „Geburt ist zerstört, der heilige Wandel ist vollbracht, getan ist, was zu tun war, es gibt kein Zurück mehr zu irgendeinem Daseinszustand.“ Dies wird als die höchste, hier und jetzt sichtbare Frucht des Asketenlebens dargestellt.
- Quellenangabe: DN 2, Sāmaññaphala Sutta (Die Lehrrede über die Früchte des Asketenlebens). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/dn2 | DN 2 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
DN 16: Mahāparinibbāna Sutta (Die Große Lehrrede vom Letzten Verlöschen)
- Relevanz: Dieses lange Sutta, das die letzten Monate und das Verlöschen des Buddha beschreibt, enthält mehrere Passagen, in denen der Buddha die Essenz seiner Lehre zusammenfasst und dabei die Befreiung von den Āsavas als zentrales Element hervorhebt. Es illustriert auch, wie der Zustand des Arahants (des Befreiten) durch die Zerstörung der Triebe definiert wird.
- Inhalt: An verschiedenen Orten während seiner letzten Reise wiederholt der Buddha oft die folgende Lehrformel: „Das ist Ethik (Sīla), das ist Sammlung (Samādhi), das ist Weisheit (Paññā). Sammlung, durch Ethik entfaltet, bringt hohen Frucht und Segen. Weisheit, durch Sammlung entfaltet, bringt hohen Frucht und Segen. Der Geist, durch Weisheit entfaltet, wird völlig frei von den Trieben (Āsavā), nämlich dem Sinnlichkeitstrieb (Kāmāsava), dem Daseinstrieb (Bhavāsava) und dem Unwissenheitstrieb (Avijjāsava).“. Diese Formel unterstreicht die untrennbare Verbindung von Ethik, geistiger Sammlung und Weisheit als Grundlage für die Befreiung von den tiefsten Verunreinigungen. Weiterhin berichtet das Sutta, wie der Buddha auf Nachfrage den spirituellen Status verstorbener Schüler erklärt. Bei denen, die die Arahantschaft erreicht haben, stellt er fest, dass sie „durch die Zerstörung der Triebe (Āsavānaṃ Khayā) noch bei Lebzeiten die triebfreie Gemütserlösung und Weisheitserlösung selbst verwirklicht, erkannt und erreicht“ haben. Der Arahant wird daher auch als Khīṇāsava („der die Triebe zerstört hat“) bezeichnet.
- Quellenangabe: DN 16, Mahāparinibbāna Sutta (Die Große Lehrrede vom Letzten Verlöschen / Die letzten Tage des Buddha). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/dn16 | DN 16 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
Saṃyutta Nikāya (SN)
- Spezifisches Kapitel? Eine Durchsicht der Kapitelstruktur des Saṃyutta Nikāya zeigt, dass es kein eigenes Kapitel (Saṃyutta) gibt, das explizit den Titel „Āsava Saṃyutta“ trägt. Die über 50 Kapitel des SN sind nach anderen thematischen Schwerpunkten gegliedert, wie z. B. bestimmte Personengruppen (Götter, Könige, Mönche), zentrale Lehrkonzepte (Bedingtes Entstehen, Aggregate, Sinnengrundlagen, Pfadfaktoren) oder Arten von Lehrreden (Verse enthaltend).
- Relevanz: Trotz des Fehlens eines dedizierten Kapitels ist das Thema der Āsavas und ihrer Überwindung im SN allgegenwärtig. Es durchdringt viele der Kapitel, die sich mit dem buddhistischen Pfad, den edlen Wahrheiten und der Natur der Befreiung beschäftigen. Besonders relevant ist das Nidāna Saṃyutta (SN 12), das sich ausführlich mit der Bedingten Entstehung befasst, deren Ausgangspunkt die Unwissenheit (Avijjā) ist – die Wurzel des Avijjāsava. Das Verständnis der Bedingten Entstehung ist essentiell für das Verständnis, wie die Triebe entstehen und wie sie durchbrochen werden können. Ebenfalls von Bedeutung ist das Asaṅkhata Saṃyutta (SN 43), das sich mit dem „Unbedingten“ (Asaṅkhata), also Nibbāna, befasst. Nibbāna wird hier oft als die „Zerstörung von Gier, Hass und Verblendung“ beschrieben, was inhaltlich der Zerstörung der Āsavas entspricht. Darüber hinaus endet eine große Anzahl von Lehrreden im gesamten SN, nachdem der Buddha eine Darlegung gegeben hat, mit der Formel: „Durch diese Lehrdarlegung wurden die Gemüter der Bhikkhus ohne Anhaften von den Trieben befreit.“ (Anupādāya āsavehi cittāni vimuccimsū’ti). Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung der Triebzerstörung als unmittelbares Ergebnis des Hörens und Verstehens der Lehre.
- Quellenangabe: SN 12 (Nidāna Saṃyutta – Die Lehrreden über Bedingtes Entstehen), SN 43 (Asaṅkhata Saṃyutta – Die Lehrreden über das Unbedingte) und viele andere Suttas im gesamten SN. Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/sn. SN 12 und SN 43 Zusammenfassungen im Lehrreden-Verzeichnis.
Aṅguttara Nikāya (AN)
AN 6.58: Āsava Sutta (Die Lehrrede über die Triebe)
- Relevanz: Dieses Sutta im „Buch der Sechser“ des Aṅguttara Nikāya ist besonders hervorzuheben, da es explizit sechs der sieben Methoden zur Überwindung der Āsavas aus MN 2 aufgreift. Es stellt einen Mönch vor, der durch die erfolgreiche Anwendung dieser sechs Methoden als würdig für Gaben, Gastfreundschaft, Spenden und Verehrung beschrieben wird – als ein „höchstes Feld für Verdienst in der Welt“.
- Inhalt: Das Sutta listet die sechs Methoden auf: Überwindung durch Kontrolle (Saṃvara), durch Gebrauch (Paṭisevanā), durch Ertragen (Adhivāsanā), durch Vermeiden (Parivajjanā), durch Beseitigen (Vinodanā) und durch Entwickeln (Bhāvanā). Jede Methode wird kurz erläutert, inhaltlich sehr ähnlich zu MN 2. Die Methode „durch Sehen“ (Dassanā) aus MN 2 fehlt hier. Dies könnte daran liegen, dass „Sehen“ sich auf die transzendente Einsicht des überweltlichen Pfades bezieht, während AN 6.58 möglicherweise stärker die vorbereitenden und unterstützenden Praktiken im weltlichen Rahmen betont, die einen Mönch spirituell reifen und für die Gemeinschaft wertvoll machen. Das Sutta verbindet die praktische Umsetzung dieser vielfältigen Strategien direkt mit der spirituellen Entwicklung und der Anerkennungswürdigkeit des Praktizierenden.
- Quellenangabe: AN 6.58, Āsava Sutta (Die Lehrrede über die Triebe). Verfügbar auf SuttaCentral: https://suttacentral.net/an6.58.
Die Untersuchung dieser Schlüssel-Lehrreden macht deutlich, dass die Überwindung der Āsavas kein isolierter Aspekt der buddhistischen Praxis ist, sondern ein integrales Element des gesamten achtfachen Pfades. Sie beginnt bei grundlegender Ethik und Sinneskontrolle, erfordert einen weisen Umgang mit den Notwendigkeiten des Lebens, emotionale Reife und Resilienz gegenüber Schwierigkeiten und gipfelt in der Entwicklung meditativer Sammlung und befreiender Weisheit.
Die Zerstörung der Triebe ist das Ergebnis eines umfassenden Transformationsprozesses, der alle Ebenen des Seins berührt.
5. Zusammenfassung und Wegweiser zum Weiterstudium
Der Pāli-Begriff Avijjāsava bezeichnet den „Trieb der Unwissenheit“, ein fundamentales Nicht-Verstehen der wahren Natur der Wirklichkeit, insbesondere der Vier Edlen Wahrheiten und des Bedingten Entstehens.
Er ist einer der vier (oder drei) Haupt-Āsavas (Triebe, Einflüsse, Fermentationen), zu denen auch der Sinnlichkeitstrieb (Kāmāsava), der Daseinstrieb (Bhavāsava) und oft der Ansichtstrieb (Diṭṭhāsava) gezählt werden.
Die Āsavas sind tief verwurzelte, subtile geistige Verunreinigungen, die wie „Fermentationen“ oder „Ausflüsse“ den Geist trüben und den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) aufrechterhalten.
Avijjāsava gilt dabei oft als die grundlegendste Wurzel, aus der die anderen Triebe und das Leiden erwachsen.
Es handelt sich nicht um eine passive Abwesenheit von Wissen, sondern um eine aktive Kraft der Verblendung, die die Wahrnehmung verzerrt und zu unheilsamen Handlungen führt.
Die buddhistische Lehre, wie sie im Pālikanon dargelegt ist, bietet einen umfassenden und vielschichtigen Weg zur Überwindung dieser Triebe.
Die Sabbāsava Sutta (MN 2) beschreibt sieben konkrete Methoden – von Sehen/Einsicht über Sinneskontrolle, weisen Gebrauch, Ertragen, Vermeiden, Beseitigen bis hin zur Entwicklung der Erleuchtungsglieder.
Andere Lehrreden wie das Sāmaññaphala Sutta (DN 2) und das Mahāparinibbāna Sutta (DN 16) zeigen, dass die Zerstörung der Triebe (Āsavakkhaya) das höchste Ziel und die Frucht des gesamten buddhistischen Pfades ist, der Ethik, Sammlung und Weisheit umfasst. Das Āsava Sutta (AN 6.58) unterstreicht die praktische Bedeutung dieser Methoden für die spirituelle Reife.
Die Arbeit an den Āsavas ist somit ein zentrales Anliegen der buddhistischen Praxis, das alle Aspekte des Weges durchdringt und letztlich zur Befreiung vom Leiden (Nibbāna) führt.
Für ein vertieftes Studium der hier genannten Lehrreden und verwandter Texte wird auf die Online-Ressource SuttaCentral (https://suttacentral.net/) sowie das Lehrreden-Verzeichnis dieser Webseite verwiesen.
Die eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Texten ist unerlässlich für ein fundiertes Verständnis der buddhistischen Lehre und Praxis.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.
- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.
- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.
- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.
- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.
- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Die Āsavas: Tiefe geistige Triebe
Entdecke die Āsavas – tief verwurzelte geistige Triebe oder Befleckungen im Buddhismus. Sie trüben den Geist und binden dich an den leidvollen Kreislauf Saṃsāra. Zu ihnen zählen u.a. Sinnensucht (Kāmāsava), Daseinsdurst (Bhavāsava) und Unwissenheit (Avijjāsava). Ihre Überwindung (Āsavakkhaya) ist ein zentraler Schlüssel zur Befreiung.







