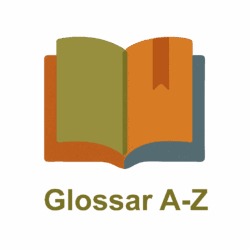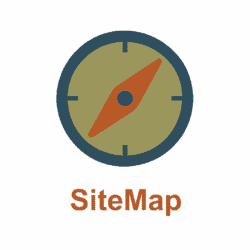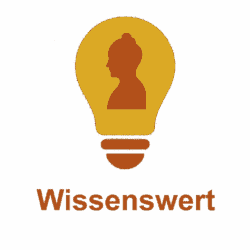Dāna – Gebefreude und Großzügigkeit im Palikanon
Ein Leitfaden zu Bedeutung und Lehrreden
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die zentrale Bedeutung von Dāna (Großzügigkeit) im Buddhismus
- Was ist Dāna ? Definition und Erklärung
- Die Formen des Gebens
- Dāna im Kontext der buddhistischen Lehre und Praxis
- Lehrreden (Suttas) zu Dāna im Palikanon: Ein Wegweiser
- Zusammenfassung: Dāna als Herz der Praxis
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung: Die zentrale Bedeutung von Dāna (Großzügigkeit) im Buddhismus
Im Herzen der buddhistischen Lehre und Praxis steht die Tugend des Gebens, auf Pali als Dāna bezeichnet. Diese Qualität der Großzügigkeit und Freigebigkeit wird nicht nur im Buddhismus, sondern universell als Ausdruck tiefer Menschlichkeit und der Fähigkeit zur Selbsttranszendenz anerkannt. Im Buddhismus nimmt Dāna jedoch eine besonders herausragende Stellung ein, oft als Fundament und Keim für die spirituelle Entwicklung betrachtet.
Es ist bezeichnend, dass der Buddha in seiner „stufenweisen Darlegung“ der Lehre (anupubbikathā) – einer Methode, die Zuhörer schrittweise an tiefere Wahrheiten heranführt – häufig mit einem Vortrag über das Geben (dānakathā) begann. Diese Platzierung an den Anfang ist kein Zufall. Sie unterstreicht die grundlegende Bedeutung von Dāna als Einstiegspunkt in die Praxis, besonders für Laienanhänger. Die Kultivierung von Großzügigkeit bereitet den Geist vor, macht ihn empfänglicher für die nachfolgenden Lehren über ethisches Verhalten (sīla), die Wirkungen von Handlungen (kamma) und den Nutzen des Loslassens (nekkhamma), bevor schließlich die Kernlehre der Vier Edlen Wahrheiten entfaltet wird.
Dieser Bericht zielt darauf ab, die vielschichtige Bedeutung von Dāna im Kontext des frühen Buddhismus zu beleuchten. Er erläutert den Begriff, seine verschiedenen Formen und seine Einbettung in zentrale Lehrkonzepte. Darüber hinaus dient er als Wegweiser zu spezifischen Lehrreden (Suttas) aus den Hauptsammlungen des Palikanons – Dīgha Nikāya (DN), Majjhima Nikāya (MN), Saṃyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN) –, die Dāna besonders thematisieren. Als primäre Quelle für die Sutta-Referenzen dient die Webseite SuttaCentral.net, um interessierten Lesern den Zugang zu den Originaltexten zu erleichtern und ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
Was ist Dāna ? Definition und Erklärung
Der Pali-Begriff und seine Übersetzung
Der Pali-Begriff Dāna, der auch im Sanskrit in gleicher Form existiert, leitet sich von der Wurzel dā ab, was „geben“ bedeutet. Er wird im Deutschen vielfältig übersetzt, unter anderem als Geben, Gebefreude, Großzügigkeit, Freigebigkeit, Spenden oder Almosen. Im Kern bezeichnet Dāna sowohl den Akt des Gebens als auch die Tugend der Großzügigkeit und Mildtätigkeit.
Die traditionelle Definition beschreibt Dāna als jede Handlung, bei der man das Eigentum an etwas, das man als sein Eigenes betrachtet oder identifiziert, aufgibt und es einem Empfänger zukommen lässt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es ist ein bewusstes Loslassen von Besitzansprüchen.
Die innere Haltung der Gebefreude
Entscheidend ist, dass Dāna weit mehr ist als nur der äußere Akt des Übergebens. Es beinhaltet eine spezifische innere Haltung: die Freude am Geben, die Großherzigkeit und Offenheit (cāga), die Bereitschaft, mit anderen zu teilen und loszulassen. Eine Gabe im Sinne von Dāna kommt von Herzen.
Diese innere Dimension ist zentral, denn die Praxis des Gebens dient der Läuterung des Geistes des Gebenden. Durch großzügiges Handeln wird der Geist transformiert, und umgekehrt prägt der Geist die Qualität der Gabe. Auf weltlicher Ebene wird angenommen, dass die durch Geben entwickelte Großzügigkeit zu materiellem Wohlstand in diesem oder zukünftigen Leben führen kann. Auf spiritueller Ebene ist es jedoch die innere Transformation – die Überwindung von Geiz und Anhaftung –, die im Vordergrund steht.
Dāna und Cāga (Freigebigkeit, Loslassen)
Eng verwandt mit Dāna, und manchmal synonym verwendet, ist der Pali-Begriff Cāga. Cāga bedeutet wörtlich „Loslassen, Aufgeben, Freigebigkeit“ und betont oft stärker die innere Qualität der Großzügigkeit und des Verzichts. Während Dāna sich häufig auf den konkreten Akt des Schenkens bezieht, verweist Cāga auf die zugrundeliegende Geisteshaltung des Nicht-Anhaftens und der Befreiung von Geiz (macchariya).
Die Bedeutung dieser inneren Qualität wird durch die Praxis der Cāgānussati – der Achtsamkeitsrückbesinnung auf die eigene Großzügigkeit – unterstrichen, die zu den sechs klassischen Achtsamkeitsübungen (anussati) zählt. In der Lehrrede AN 8.54 wird jemand als „vollendet in Großzügigkeit“ (cāgasampanna) beschrieben, der „mit einem von den Flecken des Geizes gereinigten Bewusstsein zu Hause weilt, freigebig ist, mit offener Hand, sich am Loslassen erfreut, Bitten gegenüber zugänglich ist und sich an der Verteilung von Almosen erfreut“.
Diese enge Verbindung zwischen dem Akt (Dāna) und der Haltung (Cāga) macht deutlich, dass die buddhistische Praxis des Gebens tief auf die Kultivierung des Geistes abzielt. Es geht nicht primär um die Gabe selbst, sondern um die Überwindung von Geiz und Anhaftung und die Entwicklung von Loslassen und innerer Freiheit.
Die Formen des Gebens
Die buddhistische Tradition unterscheidet üblicherweise drei Hauptformen des Gebens, die unterschiedliche Aspekte der Großzügigkeit abdecken:
- Materielle Gaben (Āmisa-dāna): Dies ist die bekannteste Form des Gebens und umfasst das Spenden von materiellen Dingen. Dazu gehören insbesondere die „vier Notwendigkeiten“ (cattāro paccayā) für Ordinierte (Mönche und Nonnen): Nahrung, Kleidung (Roben), Unterkunft und Medizin. Die Praxis des täglichen Almosengangs (piṇḍapāta), bei dem Mönche schweigend Nahrung von Laien entgegennehmen, ist ein klassisches Beispiel hierfür. Āmisa-dāna beschränkt sich jedoch nicht auf Gaben an den Orden, sondern schließt auch die Unterstützung von Armen und Bedürftigen mit ein. Eine erweiterte Bedeutung umfasst sogar „innere“ materielle Gaben, wie die Spende von Blut, Organen oder, in den Jātaka-Erzählungen über die früheren Leben des Buddha, sogar das Opfern eigener Körperteile oder des Lebens selbst.
- Die Gabe der Lehre (Dhamma-dāna): Diese Form des Gebens bezieht sich auf das Teilen der Lehre des Buddha (Dhamma) – des Wissens und der Praktiken, die zur Befreiung vom Leiden führen. Dhamma-dāna gilt als die höchste aller Gaben. Dies wird im Dhammapada (Vers 354) unmissverständlich formuliert: „Die Gabe der Lehre übertrifft alle anderen Gaben“ (Sabbadānaṁ dhammadānaṁ jināti). Diese hohe Bewertung spiegelt den ultimativen Wert wider, der im Buddhismus auf Weisheit und die endgültige Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten (saṃsāra) gelegt wird. Während materielle Gaben zeitweiliges Glück und Wohlbefinden schenken können, führt nur das Verständnis und die Praxis des Dhamma zu dauerhaftem Frieden und Erlösung. Daher wird die Ermöglichung des Zugangs zur Lehre – sei es durch Vorträge, Schriften, Übersetzungen oder die Unterstützung Lehrender – als die tiefgründigste Form der Großzügigkeit betrachtet.
- Die Gabe der Furchtlosigkeit (Abhaya-dāna): Abhaya bedeutet Furchtlosigkeit oder Sicherheit. Abhaya-dāna ist somit das Schenken von Sicherheit, Schutz und Vertrauen, das Helfen, Furcht und Gefahr zu überwinden. Dies kann durch freundliche und tröstende Worte geschehen, durch das Retten von Leben (z.B. von Tieren), das Gewähren von Zuflucht oder Schutz. Im weiteren Sinne umfasst es auch Dienste wie Beratung und seelsorgerische Betreuung. Abhaya-dāna ist eng verbunden mit der Praxis von liebender Güte (mettā) und Mitgefühl (karuṇā) sowie mit der Einhaltung der ethischen Grundregeln (sīla), insbesondere dem Prinzip des Nicht-Schädigens und Nicht-Tötens (pāṇātipātā veramaṇī). Allein durch das Einhalten der Fünf Silas praktiziert man bereits Abhaya-dāna, da man dadurch für andere keine Bedrohung darstellt und eine Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit schafft.
Dāna im Kontext der buddhistischen Lehre und Praxis
Die Bedeutung von Dāna erschließt sich vollständig erst im Zusammenhang mit anderen zentralen Konzepten der buddhistischen Lehre.
Als Grundlage verdienstvollen Handelns: Dāna, Sīla, Bhāvanā
Dāna bildet zusammen mit Sīla (ethisches Verhalten, Sittlichkeit) und Bhāvanā (Geistesentfaltung, Meditation) die drei Grundlagen für verdienstvolles Handeln (puññakiriyavatthu). Diese Triade beschreibt den Kern eines buddhistischen Lebenswegs und ist essentiell für den Fortschritt auf dem Pfad zur Befreiung.
Die drei Aspekte stehen in einer engen Wechselbeziehung und bauen aufeinander auf:
- Dāna (Geben) dient als Basis. Durch die Praxis der Großzügigkeit wird die Wurzel der Gier und Anhaftung (lobha) geschwächt. Ein Geist, der weniger von Besitzdenken und Geiz beherrscht wird, ist offener und empfänglicher für ethische Werte.
- Sīla (Ethik) baut auf dieser Grundlage auf. Ethisches Verhalten, insbesondere das Einhalten der Fünf Silas (nicht töten, nicht stehlen, keinen sexuellen Fehltritt begehen, nicht lügen, keine berauschenden Mittel konsumieren), hilft, Hass und Ärger (dosa) zu überwinden. Ein Leben in Übereinstimmung mit ethischen Prinzipien schafft innere Ruhe und äußere Harmonie.
- Bhāvanā (Geistesentfaltung) wird durch Dāna und Sīla unterstützt. Ein großzügiger und ethisch gefestigter Geist ist die Voraussetzung für erfolgreiche Meditation und die Entwicklung von Weisheit (paññā). Durch Bhāvanā (z.B. Achtsamkeits- und Einsichtsmeditation) wird schließlich die Verblendung oder Unwissenheit (moha) überwunden.
Die Reihenfolge Dāna, Sīla, Bhāvanā ist also nicht willkürlich. Sie beschreibt einen progressiven Pfad der Läuterung. Dāna als erster Schritt ist fundamental, weil es die gröbsten Hindernisse – Gier und Geiz – angeht und den Geist formbar macht für die subtileren Anforderungen von Ethik und Meditation. Es ist die Vorbereitung des Bodens, auf dem die gesamte spirituelle Praxis gedeihen kann.
Als Vollkommenheit: Dāna-Pāramī
Dāna ist auch die erste der zehn Pāramīs (Vollkommenheiten) in der Theravāda-Tradition. Die Pāramīs sind Tugenden, die von einem Bodhisattva über unzählige Leben hinweg kultiviert werden, um die Buddhaschaft zu erlangen. Sie gelten aber auch als Qualitäten, die alle Praktizierenden auf dem Weg zur Befreiung entwickeln sollten.
Die zehn Pāramīs sind:
- Dāna (Großzügigkeit)
- Sīla (Sittlichkeit)
- Nekkhamma (Entsagung, Loslassen)
- Paññā (Weisheit)
- Viriya (Willenskraft, Energie)
- Khanti (Geduld, Nachsicht)
- Sacca (Wahrhaftigkeit)
- Adhiṭṭhāna (Entschlossenheit)
- Mettā (Liebende Güte)
- Upekkhā (Gleichmut).
Auch in der Mahāyāna-Tradition steht Dāna an erster Stelle der sechs Pāramitās (die anderen sind Śīla, Kṣānti, Vīrya, Dhyāna, Prajñā). Vielfach wird betont, dass Dāna die Grundlage für die Entfaltung aller anderen Vollkommenheiten bildet.
Die Tradition kennt zudem drei Stufen der Großzügigkeits-Vollkommenheit:
- Dāna Pāramī: Das Geben von äußeren Gütern.
- Dāna Upapāramī: Das Geben eigener Körperteile.
- Dāna Paramattha Pāramī: Das Geben des eigenen Lebens zum Wohl anderer.
Diese Stufen illustrieren das Ideal vollkommenen Loslassens und selbstloser Hingabe.
Als Edler Schatz: Dāna als Ariyadhana
Schließlich wird Großzügigkeit (Dāna oder Cāga) zu den sieben Ariyadhanas (Edlen Schätzen) gezählt. Diese sind keine materiellen Güter, sondern innere Qualitäten, die den wahren Reichtum eines spirituell Praktizierenden ausmachen:
- Saddhā (Vertrauen, Glaube)
- Sīla (Tugend, Sittlichkeit)
- Hiri (Gewissenhaftigkeit, moralische Scham)
- Ottappa (moralische Scheu, Furcht vor Tadel)
- Suta (Gelehrsamkeit, Wissen um die Lehre)
- Cāga (Großzügigkeit, Freigebigkeit) / Dāna
- Paññā (Weisheit).
Diese Einordnung unterstreicht, dass Großzügigkeit im Buddhismus nicht nur eine gute Tat ist, sondern ein integraler Bestandteil spirituellen Reichtums, der im Gegensatz zu vergänglichem materiellem Besitz dauerhaften Wert besitzt.
Lehrreden (Suttas) zu Dāna im Palikanon: Ein Wegweiser
Der Palikanon enthält zahlreiche Lehrreden, die sich mit Dāna befassen. Die folgende Auswahl aus den vier Haupt-Nikāyas soll einen Einblick geben und zum Weiterlesen anregen. Die Referenzen folgen der Zählung auf SuttaCentral.net.
Dīgha Nikāya (DN): Das wahre Opfer
- DN 5: Kūṭadanta Sutta (Die Lehrrede an Kūṭadanta / Über das wahre Opfer)
- Kontext: Der Brahmane Kūṭadanta plant ein großes Tieropferritual und bittet den Buddha um Rat bezüglich der korrekten Durchführung.
- Inhalt: Der Buddha erzählt eine Geschichte aus einem früheren Leben: Ein König (Mahāvijita) wird von seinem weisen Kaplan (dem Buddha in einer früheren Geburt) davon überzeugt, auf das grausame Opfer zu verzichten. Stattdessen führt er eine Art „soziales Opfer“ durch: Er unterstützt die Bürger seines Reiches gezielt mit dem, was sie für ihren Lebensunterhalt benötigen – Saatgut und Futter für Bauern, Kapital für Händler, Lohn und Verpflegung für Staatsdiener. Diese Maßnahmen führen zu Wohlstand, Sicherheit und Zufriedenheit im Reich. Dieses alternative „Opfer“ geschieht ohne Gewalt, mit freiwilliger Beteiligung und vegetarischen Gaben. Die Lehrrede stellt jedoch klar, dass selbst diese Form des Gebens von noch höheren „Opfern“ übertroffen wird: Zufluchtnahme zu Buddha, Dhamma und Sangha, das Einhalten der Sittlichkeitsregeln und schließlich die Praxis, die zur Befreiung führt – das Aufgeben der geistigen Verunreinigungen.
- Relevanz für Dāna: Diese Lehrrede ist bedeutsam, da sie traditionelle, ritualisierte Opferpraktiken kritisiert und den Begriff des Opfers (yañña) neu interpretiert im Sinne einer konstruktiven, auf Gemeinwohl ausgerichteten Form von Dāna. Sie verbindet Großzügigkeit direkt mit sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher Förderung. Gleichzeitig wird diese weltlich orientierte Großzügigkeit in eine spirituelle Hierarchie eingeordnet, an deren Spitze die individuelle Befreiungspraxis steht. Dies zeigt, wie der Buddhismus bestehende kulturelle Konzepte aufgriff, ethisch umdeutete und in den Rahmen des eigenen Befreiungsweges integrierte.
Majjhima Nikāya (MN): Die Analyse der Gaben
- MN 142: Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta (Die Lehrrede über die Analyse der Gaben / Die Analyse der Spenden)
- Kontext: Die Ziehmutter des Buddha, Mahāpajāpati Gotamī, möchte dem Buddha persönlich ein Paar neue Roben schenken. Der Buddha legt ihr jedoch nahe, die Gabe dem gesamten Orden (Sangha) zukommen zu lassen.
- Inhalt: Der Buddha legt detailliert dar, wie sich Gaben (dakkhiṇā) unterscheiden und wie ihre Frucht (ihr karmisches Ergebnis) von verschiedenen Faktoren abhängt. Er listet 14 Klassen von individuellen Empfängern auf, beginnend bei Tieren bis hin zum Buddha selbst, wobei der Wert der Gabe mit der Tugendhaftigkeit und spirituellen Reife des Empfängers steigt. Anschließend beschreibt er sieben Arten von Gaben, die dem Sangha als Gemeinschaft gegeben werden. Der Buddha betont nachdrücklich, dass eine Gabe an den Sangha (saṅghika-dāna) einen unermesslich größeren Nutzen bringt als jede Gabe an eine Einzelperson – selbst an einen Buddha. Er erklärt weiter, dass eine Gabe auf vier Arten gereinigt wird: durch die Tugend des Gebers, durch die Tugend des Empfängers, durch beider Tugend oder durch keines von beiden. Selbst wenn die einzelnen Mönche oder Nonnen, die die Gabe stellvertretend für den Sangha entgegennehmen, untugendhaft (dussīla) sein sollten, bringt eine Gabe, die im Namen des Sangha gegeben wird, dennoch außerordentliche Frucht.
- Relevanz für Dāna: Diese Lehrrede liefert die kanonische Grundlage für die hohe Wertschätzung von Gaben an den Sangha. Sie analysiert präzise die Faktoren, die den karmischen Ertrag einer Gabe bestimmen, insbesondere die Qualitäten von Geber und Empfänger sowie die Intention (individuell vs. gemeinschaftlich). Die Aussage, dass die Gabe an den Sangha selbst die Gabe an einen Buddha übertrifft, ist bemerkenswert. Sie unterstreicht die immense Bedeutung, die der Institution des Sangha als Träger und Bewahrer der Lehre für die Kontinuität des Dhamma beigemessen wird. Die Analyse der vier Reinigungsarten zeigt zudem, dass die ethische Qualität (sīla) von Geber und Empfänger eine wesentliche Rolle spielt und der Akt des Gebens in einen größeren ethischen Kontext eingebettet ist.
Saṃyutta Nikāya (SN): Verbundene Lehrreden
Hinweis: Im Saṃyutta Nikāya gibt es kein eigenes Kapitel (Saṃyutta), das ausschließlich dem Thema Dāna gewidmet ist. Lehrreden über das Geben finden sich jedoch verstreut in verschiedenen Kapiteln.
- Beispiel: SN 1.33: Sādhusutta (Die Lehrrede vom Guten)
- Inhalt: Eine Gruppe von Gottheiten (devatās) erscheint vor dem Buddha und preist das Geben (dāna) auf verschiedene Weise: Geben an sich sei gut; Geben sei gut, selbst wenn man nur wenig hat; Geben aus Vertrauen (saddhā) sei gut; das Geben von rechtmäßig erworbenem Gut sei gut; und intelligentes, unterscheidendes Geben (viceyya dāna) an würdige Empfänger sei gut. Der Buddha bestätigt die Güte des Gebens in all diesen Formen, fügt aber hinzu, dass der „Pfad der Lehre“ (dhammapada) – also das Verständnis und die Praxis des Dhamma – das Geben übertrifft, da dieser Pfad letztlich zur höchsten Befreiung, dem Nibbāna, führt.
- Relevanz für Dāna: Bestätigt den Wert des Gebens unter verschiedenen Umständen und Motivationen, ordnet es aber klar in den Gesamtzusammenhang des buddhistischen Pfades ein, wo die Entwicklung von Weisheit und das direkte Verständnis der Lehre den höchsten Stellenwert haben.
Aṅguttara Nikāya (AN): Angereihte Lehrreden
Hinweis: Der Aṅguttara Nikāya, der nach numerischen Gesichtspunkten geordnet ist, enthält eine Fülle von Lehrreden, in denen Dāna als Teil von Aufzählungen verschiedener Qualitäten, Praktiken oder deren Ergebnisse diskutiert wird.
- Beispiel 1: AN 6.37: Chaḷaṅgadānasutta (Die Lehrrede über die Gabe mit sechs Faktoren)
- Inhalt: Diese Lehrrede beschreibt eine Gabe, die „mit sechs Faktoren ausgestattet“ ist und unermesslichen Verdienst (puñña) bringt. Drei Faktoren betreffen den Geber: Er ist vor dem Geben frohen Mutes (sumano), während des Gebens ist sein Geist zuversichtlich und klar (cittaṁ pasādeti), und nach dem Geben fühlt er sich erhoben und erfreut (attamano). Drei Faktoren betreffen die Empfänger: Sie sind frei von Gier, Hass und Verblendung oder praktizieren zumindest darauf hin, diese zu überwinden.
- Relevanz für Dāna: Definiert die idealen Geisteszustände des Gebers und die idealen Qualitäten des Empfängers, die zusammenwirken, um die positive Wirkung (vipāka) des Gebens zu maximieren. Sie macht deutlich, dass Dāna nicht nur eine äußere Handlung ist, sondern eine Praxis zur Kultivierung heilsamer Geisteszustände (Freude, Vertrauen, Zufriedenheit) beim Gebenden selbst. Die Reinheit des Empfängers potenziert das Ergebnis und unterstreicht die Wechselwirkung zwischen den Qualitäten beider Seiten.
- Beispiel 2: AN 8.31: Paṭhamadānasutta (Die erste Lehrrede über das Geben)
- Inhalt: Listet acht verschiedene Beweggründe oder Arten des Gebens auf: (1) Geben, nachdem man den Empfänger beleidigt hat; (2) Geben aus Furcht; (3) Geben mit dem Gedanken „Er/Sie hat mir gegeben“ (Erwartung von Gegenseitigkeit); (4) Geben mit dem Gedanken „Er/Sie wird mir geben“ (Erwartung zukünftiger Gaben); (5) Geben mit dem Gedanken „Geben ist gut“ (aus Prinzip); (6) Geben mit dem Gedanken „Ich koche, sie kochen nicht; es wäre unrecht von mir, ihnen nichts zu geben“ (aus Mitgefühl/Pflichtgefühl); (7) Geben, um einen guten Ruf zu erlangen; (8) Geben als „Schmuck und Zubehör des Geistes“ (cittālaṅkāra-cittaparikkhāratthaṁ), d.h. zur Unterstützung der Geistesentwicklung und Konzentration.
- Relevanz für Dāna: Zeigt ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Motivationen, die hinter dem Akt des Gebens stehen können. Diese reichen von weniger reinen Motiven (Furcht, Erwartung, Reputation) bis hin zu altruistischen und spirituell ausgerichteten (Prinzipientreue, Mitgefühl, Geisteskultivierung). Die Lehrrede regt zur Selbstreflexion über die eigenen Beweggründe beim Praktizieren von Dāna an.
Khuddaka Nikāya (Itivuttaka – Iti): „So wurde gesagt“
- Iti 26: Dānasutta (Die Lehrrede über das Geben 1)
- Inhalt: Der Buddha erklärt eindringlich: Wenn die Wesen die Frucht (vipāka) des Gebens und Teilens so kennen würden wie er, würden sie nicht essen, ohne zuvor gegeben zu haben – selbst wenn es ihr letzter Bissen wäre. Der „Flecken des Geizes“ (maccheramala) würde ihren Geist nicht beherrschen. Wer großzügig gibt, besonders an die Würdigen (spirituell Fortgeschrittene), wird im Himmel wiedergeboren und erfreut sich dort der Früchte seiner Großzügigkeit.
- Relevanz für Dāna: Betont kraftvoll die positiven karmischen Folgen des Gebens (himmlische Wiedergeburt) und seine direkte psychologische Wirkung: die Überwindung des Geizes. Die hypothetische Formulierung („Wenn ihr wüsstet…“) dient als starke Motivation zur Praxis. Die Lehrrede verbindet somit die äußere Handlung direkt mit der inneren Transformation (Überwindung von maccheramala) und den zukünftigen karmischen Ergebnissen.
- Iti 98: Dānasutta (Die Lehrrede über das Geben 2)
- Inhalt: Vergleicht jeweils zwei Arten von Geben (āmisa-dāna – materielle Gabe vs. dhamma-dāna – Gabe der Lehre), zwei Arten des Teilens und zwei Arten der Hilfe/Unterstützung. In jedem Fall wird der Aspekt, der sich auf den Dhamma bezieht, als der höchste und vorzüglichste erklärt.
- Relevanz für Dāna: Etabliert unmissverständlich die Hierarchie, in der das Teilen des Weges zur Befreiung (Dhamma) als die höchste Form der Großzügigkeit gilt, und bekräftigt damit die zentrale Bedeutung von Dhamma-dāna.
Zusammenfassung: Dāna als Herz der Praxis
Dāna ist weit mehr als eine einfache Spende. Es ist ein zentraler Pfeiler der buddhistischen Lehre und Praxis – ein Akt, eine Tugend, ein Fundament für ethisches Leben und Geistesentfaltung sowie eine der Vollkommenheiten auf dem Weg zur Befreiung. Die Praxis des Gebens zielt auf die tiefgreifende Transformation des eigenen Geistes ab: die Überwindung von Gier, Geiz und Anhaftung (lobha, macchariya) und die Kultivierung von Freude, Mitgefühl und Loslassen (cāga).
Die Lehrreden des Palikanons zeigen Dāna in vielfältigen Facetten: als materielle Unterstützung für Bedürftige und den Sangha, als höchstes Gut in Form der Weitergabe der Lehre (Dhamma-dāna), und als Schenken von Sicherheit und Furchtlosigkeit (Abhaya-dāna). Sie betonen die Wichtigkeit der inneren Haltung – der Freude und des Vertrauens beim Geben – sowie die Bedeutung der ethischen Qualität von Geber und Empfänger für die Frucht der Handlung.
Als erste Stufe der Triade Dāna-Sīla-Bhāvanā und als erste der Pāramīs legt Großzügigkeit das Fundament für den gesamten spirituellen Weg. In einer Zeit, die oft von Konsumismus und Egoismus geprägt ist, bietet die bewusste Praxis von Dāna einen kraftvollen Gegenpol. Sie fördert nicht nur das eigene Wohlbefinden und positive Geisteszustände, sondern stärkt auch das Mitgefühl, die Verbundenheit mit anderen und trägt zu einer heilsameren Gesellschaft bei. Die Auseinandersetzung mit den hier vorgestellten Lehrreden kann eine wertvolle Inspiration sein, diese grundlegende Tugend im eigenen Leben zu kultivieren und ihre tiefe Bedeutung zu erfahren.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellenverzeichnis (Auswahl relevanter Suttas):
| Sutta Referenz | Pali Name | Deutscher Titel (Vorschlag) | Schlüsselthema bzgl. Dāna | Quelle (SuttaCentral Link) |
|---|---|---|---|---|
| DN 5 | Kūṭadanta Sutta | Die Lehrrede an Kūṭadanta / Über das wahre Opfer | Wahres Opfer vs. Gewalt; Soziale Wohlfahrt durch Geben; Hierarchie des Gebens | https://suttacentral.net/dn5 |
| MN 142 | Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta | Die Lehrrede über die Analyse der Gaben | Analyse der Empfänger; Überlegenheit der Gabe an den Sangha; Reinigung der Gabe durch Tugend | https://suttacentral.net/mn142 |
| SN 1.33 | Sādhusutta | Die Lehrrede vom Guten | Lobpreis verschiedener Aspekte des Gebens; Überlegenheit des Dhamma-Pfades | https://suttacentral.net/sn1.33 |
| AN 6.37 | Chaḷaṅgadānasutta | Die Lehrrede über die Gabe mit sechs Faktoren | Geisteshaltung des Gebers; Qualitäten des Empfängers; Maximierung der Frucht der Gabe | https://suttacentral.net/an6.37 |
| AN 8.31 | Paṭhamadānasutta | Die erste Lehrrede über das Geben | Acht verschiedene Motivationen für das Geben | https://suttacentral.net/an8.31 |
| Iti 26 | Dānasutta | Die Lehrrede über das Geben (1) | Frucht des Gebens (Himmel); Überwindung des Geizes (macchariya) | https://suttacentral.net/iti26 |
| Iti 98 | Dānasutta | Die Lehrrede über das Geben (2) | Überlegenheit der Gabe des Dhamma (Dhamma-dāna) über materielle Gaben (Āmisa-dāna) | https://suttacentral.net/iti98 |
Hinweis: Deutsche Titel sind teils etablierte Übersetzungen, teils beschreibende Vorschläge basierend auf dem Inhalt.
Ausgewählte Referenzen (Web):
- Dāna – Wikipedia
- Dana: The Practice of Giving – Access to Insight
- Meaning of the Pali Word “Dana” – Dharma Wisdom
- Basic Pali Terminology – SuttaCentral
- Stream entry and sathipattana – Q & A – Discuss & Discover – SuttaCentral
- Dana, Dāna, Daṅa: 51 definitions – Wisdom Library
- What is Dāna? – Planet Dharma
- Dāna – Encyclopedia of Buddhism
- Trusting in Generosity: What it Means for Organizations To Run on Dāna – DHARMA GATES
- Definitions for: dinna – SuttaCentral
- Can dāna mean generosity? Does it ever in the texts? – Translations – SuttaCentral
- Punna Kamma Or Meritorious Deeds – Dāna, Sīla, Bhāvanā – Pure Dhamma
- First Fifty – Suttas.com
- (1) First Pāramī: The Perfection of Generosity (dāna-pāramī) – Wisdomlib
- The Significance of Dana – LBYG
Weiter in diesem Bereich mit …
Die Acht Weltgesetze
Gewinn und Verlust, Ehre und Schande, Lob und Tadel, Freude und Leid – diese acht weltlichen Bedingungen (aṭṭha loka dhammā) prägen unser Leben und können uns leicht aus der Bahn werfen. Entdecken Sie, wie der Buddhismus diese universellen Erfahrungen erklärt und warum das Verständnis ihrer vergänglichen Natur entscheidend für inneren Frieden ist. Dieser Bericht beleuchtet die Bedeutung der loka dhammā und verweist auf zentrale Lehrreden im Palikanon, die den Weg zu Gelassenheit weisen.