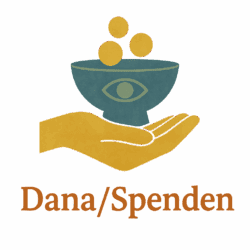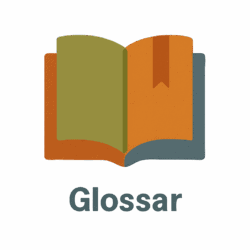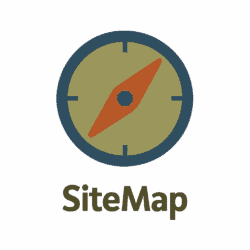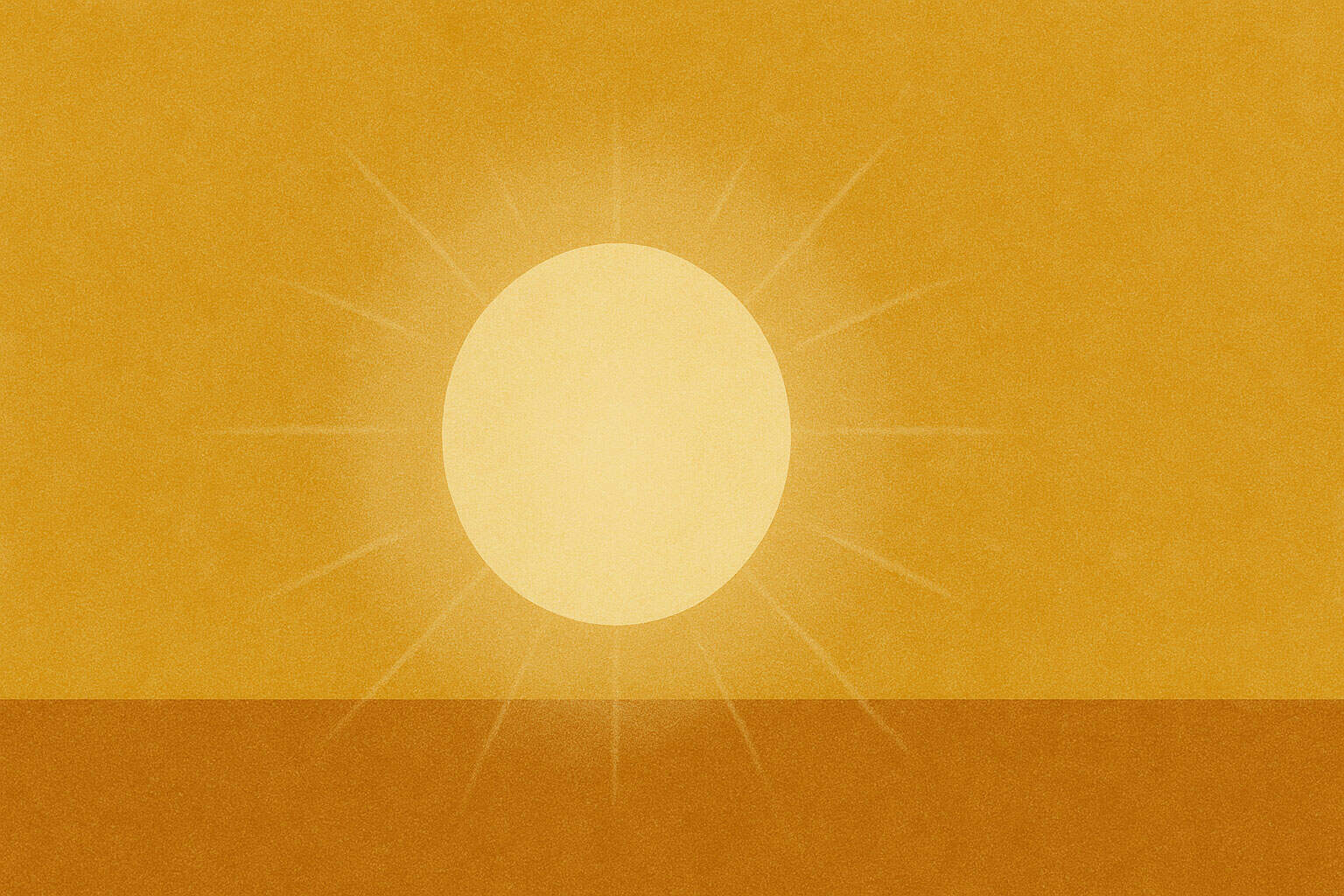
Das Zweite Jhāna (Dutiya Jhāna): Vertiefung der Sammlung im Palikanon
Analyse der zweiten meditativen Vertiefungsstufe, ihrer Merkmale und Bedeutung im buddhistischen Pfad
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Die buddhistische Lehre beschreibt einen Weg zur Befreiung vom Leiden, der oft als der Edle Achtfache Pfad dargestellt wird.
Ein zentrales Element dieses Pfades ist die Entwicklung des Geistes durch Meditation, insbesondere die Kultivierung von Sammlung (samādhi) und Weisheit (paññā).
Innerhalb der meditativen Praxis spielen die sogenannten Jhānas eine herausragende Rolle.
Der Pali-Begriff jhāna (Sanskrit: dhyāna) bezeichnet meditative Vertiefungszustände, die durch intensive Sammlung, innere Ruhe und spezifische mentale Faktoren gekennzeichnet sind. Sie repräsentieren Stufen fortschreitender geistiger Verfeinerung und Konzentration und bilden eine wichtige Grundlage für die Entwicklung befreiender Einsicht.
Dieser Bericht konzentriert sich auf das Zweite Jhāna (Dutiya Jhāna), die zweite der vier Hauptstufen der sogenannten „körperlichen“ oder „feinkörperlichen“ Vertiefungen (Rūpa-Jhānas). Obwohl der Begriff Rūpa-Jhāna selbst eher in den Kommentaren als in den frühesten Lehrreden prominent ist, beschreibt er treffend die ersten vier Jhānas, die noch eine Verbindung zu subtilen „Form“-Objekten aufweisen können.
Ziel dieses Berichts ist es, eine klare Definition und Erklärung des Dutiya Jhāna zu liefern, seine charakteristischen Merkmale zu beleuchten und es in den Kontext des buddhistischen Übungsweges einzuordnen.
Darüber hinaus werden zentrale Lehrreden (Suttas) aus den Sammlungen Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN) des Palikanons vorgestellt, die diesen Zustand behandeln, sowie Hinweise auf relevante Texte im Samyutta Nikaya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN) gegeben.
Wichtige zugehörige Pali-Begriffe werden ebenfalls erläutert, um ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
Die Darstellung richtet sich sowohl an interessierte Laien, die ihr Wissen vertiefen möchten, als auch an Einsteiger, die einen ersten Zugang zu diesem Thema suchen.
Das Verständnis dieser meditativen Zustände ist nicht nur für die Meditationspraxis von Bedeutung, sondern auch für das Studium der buddhistischen Lehre, da sie einen integralen Bestandteil des vom Buddha gelehrten Befreiungsweges darstellen.
2. Definition und Merkmale des Dutiya Jhāna
Das Erreichen des Dutiya Jhāna markiert einen signifikanten Fortschritt in der meditativen Vertiefung im Vergleich zum Ersten Jhāna (Paṭhama Jhāna).
Es wird in zahlreichen Lehrreden des Palikanons mit einer Standardformel beschrieben, die seine wesentlichen Merkmale hervorhebt.
Die Standardformel:
Die kanonische Beschreibung lautet typischerweise wie folgt:
„Ferner, mit der Beruhigung des anfänglichen Hinwendens und des anhaltenden Prüfens (vitakkavicārānaṁ vūpasamā), tritt ein Mönch in den zweiten Jhāna ein und verweilt darin: einen Zustand, der innere Beruhigung (ajjhattaṁ sampasādanaṁ) und Einigung des Geistes (cetaso ekodibhāvaṁ) besitzt, der frei ist von anfänglichem Hinwenden und anhaltendem Prüfen (avitakkaṁ avicāraṁ), erfüllt von Verzückung (pīti) und Glückseligkeit (sukha), die aus der Sammlung (samādhi) geboren sind (samādhijaṁ).“
Erläuterung der Schlüsselmerkmale:
- Aufhören von Vitakka und Vicāra: Das herausragendste Merkmal des Übergangs vom Ersten zum Zweiten Jhāna ist das vollständige Zur-Ruhe-Kommen von vitakka (dem anfänglichen Hinwenden des Geistes zum Meditationsobjekt) und vicāra (dem anhaltenden Prüfen oder Verweilen des Geistes beim Objekt). Diese beiden Faktoren, die im Ersten Jhāna noch notwendig sind, um den Geist auf das Objekt auszurichten und dort zu halten, werden nun als gröber und als eine Form geistiger Aktivität erkannt, die die tiefere Ruhe stört. Ihr Wegfallen bedeutet nicht das Ende jeglicher geistiger Aktivität oder Bewusstheit, sondern das Ende der spezifischen Anstrengung, den Geist aktiv auf das Objekt zu lenken und es diskursiv zu untersuchen. Der Geist verweilt nun mühelos und stabil in der Sammlung, ohne die Notwendigkeit dieser lenkenden und prüfenden Gedankenbewegungen.
- Entstehen von Pīti und Sukha aus Samādhi: Während im Ersten Jhāna Verzückung (pīti) und Glückseligkeit (sukha) als „aus der Abgeschiedenheit geboren“ (vivekaja) beschrieben werden, entstehen sie im Zweiten Jhāna „aus der Sammlung geboren“ (samādhija). Dies markiert eine qualitative Veränderung und Vertiefung. Die Freude und das Wohlgefühl sind nun nicht mehr primär das Ergebnis der äußeren und inneren Zurückgezogenheit von hinderlichen Zuständen, sondern entspringen direkt der gefestigten, ungestörten Konzentration (samādhi) selbst. Der Geist schöpft seine Freude aus seiner eigenen gesammelten und geeinten Natur, was auf eine größere innere Stabilität und Unabhängigkeit von äußeren Bedingungen hindeutet. Pīti wird oft als eine intensivere, manchmal körperlich spürbare, freudige Erregung beschrieben, während sukha ein ruhigeres, tieferes Gefühl des Glücks und Wohlbefindens darstellt.
- Ajjhattaṁ Sampasādanaṁ: Dieser Faktor beschreibt eine tiefe innere Beruhigung, Klarheit und ein Gefühl des Vertrauens. Es entsteht durch das Wegfallen der geistigen Unruhe, die mit vitakka und vicāra verbunden ist. Der Geist ist nun klar, ruhig und voller Vertrauen in seine eigene Stabilität und Sammlung.
- Cetaso Ekodibhāvaṁ / Ekaggatā: Die Einigung des Geistes oder Einspitzigkeit (ekaggatā) erreicht im Zweiten Jhāna eine neue Stufe der Festigkeit. Der Geist ist nun nicht nur auf einen Punkt konzentriert, sondern ruht dort unerschütterlich, ohne Schwankungen oder Ablenkungen. Dieser Zustand wird manchmal als „perfektes samādhi“ beschrieben, eine unbewegliche Stille des Geistes, die auch in den höheren Jhānas erhalten bleibt.
Zusammenfassend ist das Dutiya Jhāna ein Zustand tiefer meditativer Sammlung, charakterisiert durch das Fehlen diskursiver Gedankenaktivität (vitakka, vicāra), das Vorhandensein von intensiver Freude und Glückseligkeit (pīti, sukha), die direkt aus der gefestigten Konzentration (samādhi) entstehen, sowie durch innere Ruhe und unerschütterliche Einspitzigkeit des Geistes (ekaggatā).
3. Kontext: Dutiya Jhāna innerhalb der Rūpa-Jhānas
Das Dutiya Jhāna ist keine isolierte Erfahrung, sondern ein wichtiger Schritt innerhalb einer systematischen Entwicklung meditativer Zustände, den vier Rūpa-Jhānas.
Diese stellen eine aufsteigende Leiter dar, bei der der Geist durch das schrittweise Loslassen gröberer mentaler Faktoren und die Kultivierung feinerer Faktoren zunehmend ruhiger, klarer und gesammelter wird. Die Reihenfolge dieser Zustände ist nicht willkürlich, sondern spiegelt eine psychologisch plausible Progression der meditativen Vertiefung wider.
- Vergleich mit dem Ersten Jhāna (Paṭhama Jhāna): Das Erste Jhāna wird erreicht durch die Abgeschiedenheit von Sinnesvergnügen und unheilsamen Geisteszuständen (den fünf Hindernissen). Es ist gekennzeichnet durch die fünf Faktoren: vitakka, vicāra, pīti, sukha und ekaggatā. Der Übergang zum Zweiten Jhāna erfolgt, wenn der Meditierende die geistige Aktivität von vitakka und vicāra als relativ grob und störend für tiefere Ruhe erkennt und diese loslässt. Die Konzentration (samādhi) wird dadurch stabiler und die Freude (pīti) und Glückseligkeit (sukha) wurzeln nun direkt in dieser gefestigten Sammlung (samādhija).
- Abgrenzung zum Dritten Jhāna (Tatiya Jhāna): Auf das Zweite Jhāna folgt das Dritte Jhāna. Der Übergang geschieht durch das Erkennen der freudigen Erregung (pīti) als einen relativ groben und potenziell aufwühlenden Faktor im Vergleich zu einem noch ruhigeren Glückszustand. Im Dritten Jhāna lässt der Meditierende pīti los und verweilt in einem Zustand, der durch ruhige Glückseligkeit (sukha) und Einspitzigkeit (ekaggatā) gekennzeichnet ist. Hinzu kommt ein ausgeprägter Gleichmut (upekkhā) und klare Bewusstheit (sati-sampajañña).
- Abgrenzung zum Vierten Jhāna (Catuttha Jhāna): Im Vierten Jhāna werden auch die letzten Spuren von Glück (sukha) und Leid (bzw. dessen Abwesenheit im vorherigen sukha) überwunden. Es verbleibt ein Zustand reinen, durch Gleichmut (upekkhā) geläuterten Gewahrseins und vollkommener Einspitzigkeit (ekaggatā), frei von Freude und Leid.
Dieser Prozess des schrittweisen Loslassens und Verfeinerns ist zentral für die Jhāna-Entwicklung.
Jeder Übergang beinhaltet ein Element der Einsicht: das Erkennen der Begrenztheit oder Grobheit der Faktoren des aktuellen Zustands im Vergleich zur Subtilität und Ruhe des nächsten. Dies zeigt, dass die Entwicklung der Jhānas nicht nur eine passive Vertiefung der Konzentration ist, sondern auch ein aktives Verständnis der Natur der beteiligten Geisteszustände erfordert, was die enge Verbindung zwischen Geistesruhe (samatha) und Einsicht (vipassanā) unterstreicht.
4. Zugehörige Schlüsselbegriffe
Für ein klares Verständnis des Dutiya Jhāna ist die Bedeutung einiger zentraler Pali-Begriffe, der sogenannten Jhāna-Faktoren (jhānaṅga), wesentlich.
Diese Faktoren sind keine statischen Zustände, sondern dynamische Qualitäten des Geistes, die in der Meditation kultiviert und deren Zusammenspiel verstanden wird.
- Vitakka: Oft übersetzt als „anfängliches Hinwenden“, „gerichtetes Denken“ oder „Gedankenfassen“. Es beschreibt die geistige Aktion, den Geist auf das Meditationsobjekt auszurichten oder „aufzusetzen“. Im Ersten Jhāna vorhanden, im Zweiten Jhāna beruhigt.
- Vicāra: Oft übersetzt als „anhaltendes Prüfen“, „untersuchendes Denken“ oder „Verweilen“. Es beschreibt das Halten des Geistes beim Objekt und dessen kontinuierliche Untersuchung oder Erforschung. Im Ersten Jhāna vorhanden, im Zweiten Jhāna beruhigt.
- Pīti: Übersetzt als „Verzückung“, „(ekstatische) Freude“, „Begeisterung“ oder „Interesse“. Es ist ein Faktor des Wohlbefindens, der oft als energetisierend und erhebend beschrieben wird und sich manchmal auch körperlich manifestieren kann. Im Ersten und Zweiten Jhāna vorhanden, im Dritten Jhāna überwunden.
- Sukha: Übersetzt als „Glückseligkeit“, „Wohlgefühl“, „Freude“ oder „Zufriedenheit“. Es ist ein tieferes, ruhigeres und stabileres Gefühl des Glücks als pīti. Im Ersten, Zweiten und Dritten Jhāna vorhanden, im Vierten Jhāna überwunden.
- Ekaggatā (oder Cittassa Ekodibhāva): Übersetzt als „Einspitzigkeit des Geistes“, „Sammlung auf einen Punkt“ oder „Konzentration“. Es ist die Fähigkeit des Geistes, stabil, ungeteilt und ohne Ablenkung bei seinem Objekt zu verweilen. Dieser Faktor ist in allen vier Rūpa-Jhānas vorhanden und wird zunehmend verfeinert.
- Samādhi: Übersetzt als „Sammlung“ oder „Konzentration“. Es bezeichnet den allgemeinen Zustand eines geeinten, stabilen und ruhigen Geistes. Samādhi ist die Grundlage für das Erreichen der Jhānas und wird durch deren Praxis vertieft. Die Jhānas selbst sind spezifische Ausprägungen von hohem samādhi. Im Dutiya Jhāna heißt es explizit, dass pīti und sukha aus samādhi geboren sind (samādhija).
Das Verständnis dieser Faktoren und ihres Zusammenspiels ist entscheidend, um die Natur des Dutiya Jhāna und seine Stellung im Rahmen der meditativen Entwicklung zu erfassen.
5. Lehrreden (Suttas) zu Dutiya Jhāna
Die Standardbeschreibung des Dutiya Jhāna, wie oben dargestellt, findet sich in zahlreichen Lehrreden des Palikanons.
Sie ist oft Teil der Darlegung des „Graduellen Trainings“ (anupubbikathā), das den Weg eines Mönchs von den Grundlagen der Ethik bis zur vollen Befreiung beschreibt, oder sie erscheint in Kontexten, die spezifisch die meditative Praxis (samādhi, jhāna) behandeln.
Die folgenden Lehrreden aus dem Dīgha Nikāya (DN) und Majjhima Nikāya (MN) sind besonders relevant für das Verständnis des Dutiya Jhāna.
Die angegebenen Referenzen verweisen auf suttacentral.net als Hauptquelle.
Tabelle: Empfohlene Lehrreden aus DN und MN zu Dutiya Jhāna
| Sammlung | Sutta-Nr. | Pali-Name | Deutscher Titel (gängig) | Relevanz für Dutiya Jhāna |
|---|---|---|---|---|
| DN | 2 | Sāmaññaphala Sutta | Die Früchte des Asketenlebens | Enthält die klassische, ausführliche Beschreibung aller vier Rūpa-Jhānas (einschließlich Dutiya Jhāna) als Teil des vom Buddha dargelegten graduellen Pfades zur Befreiung, eingebettet in einen Dialog mit König Ajātasattu. |
| MN | 52 | Aṭṭhakanāgara Sutta | Die Lehrrede an den Mann aus Aṭṭhakanagara | Erklärt durch den Ehrwürdigen Ānanda, wie das Erreichen und anschließende Reflektieren des Dutiya Jhāna (sowie anderer meditativer Zustände) zur vollständigen Befreiung (Zerstörung der Triebe, āsavakkhaya) oder zur Wiedergeburt als Nichtwiederkehrer in den Reinen Bereichen führen kann. |
| MN | 39 | Mahā-Assapura Sutta | Die große Lehrrede in Assapura | Beschreibt die umfassenden Qualitäten und Praktiken, die einen wahren Asketen ausmachen, wobei die Erreichung der vier Jhānas als wesentlicher Bestandteil der fortgeschrittenen Praxis genannt wird (typischer Kontext für die Jhāna-Formeln). |
| MN | 119 | Kāyagatāsati Sutta | Achtsamkeit auf den Körper | Integriert die vier Jhānas, einschließlich ihrer bekannten Gleichnisse, explizit in die Praxis der Körperachtsamkeit und beschreibt sie als Weg zur Festigung des Geistes und zur Sammlung (samādhi). |
Beispielhafte Beschreibung im Kontext (aus MN 52):
In der Aṭṭhakanāgara Sutta (MN 52) erklärt der Ehrwürdige Ānanda, wie das Zweite Jhāna zur Befreiung führen kann:
„Wiederum, Haushälter, tritt ein Mönch mit der Beruhigung des anfänglichen Hinwendens und des anhaltenden Prüfens in den zweiten Jhāna ein und verweilt darin […] Er erwägt dies und versteht es so: ‚Auch dieser zweite Jhāna ist bedingt und willentlich erzeugt. Aber was auch immer bedingt und willentlich erzeugt ist, ist vergänglich, dem Aufhören unterworfen.‘ Auf dieser Grundlage stehend, erlangt er die Vernichtung der Triebe. Aber wenn er die Vernichtung der Triebe nicht erlangt wegen dieser Dhamma-Begierde, dieser Dhamma-Freude, dann wird er mit der Zerstörung der fünf niederen Fesseln einer, der spontan (in den Reinen Bereichen) wiedererscheint und dort endgültiges Nibbāna erlangt, ohne jemals von jener Welt zurückzukehren.“
Diese Passage verdeutlicht zwei wichtige Aspekte: Erstens sind die Jhānas integrale Bestandteile des Weges zur Befreiung, eingebettet in einen Kontext von Ethik (sīla) und Weisheit (paññā).
Sie sind keine rein technischen Übungen, sondern Stufen auf einem umfassenden spirituellen Pfad. Zweitens hängt das Ergebnis der Jhāna-Praxis entscheidend davon ab, wie der Zustand reflektiert wird.
Die bloße Erfahrung von Freude und Sammlung führt nicht automatisch zur Befreiung.
Erst die Anwendung von Einsicht auf die Vergänglichkeit und Bedingtheit des Jhāna-Zustands selbst ermöglicht die Zerstörung der Triebe (āsavakkhaya) oder zumindest den Status eines Nichtwiederkehrers. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Sammlung (samādhi) mit Achtsamkeit (sati) und Weisheit (paññā) zu verbinden.
6. Weitere Erwähnungen im Palikanon
Die Lehre von den Jhānas, einschließlich des Dutiya Jhāna, ist ein wiederkehrendes Thema im gesamten Palikanon und beschränkt sich nicht nur auf die oben genannten Lehrreden.
Ihre Erwähnung in verschiedenen Sammlungen und Kontexten unterstreicht ihre zentrale Bedeutung.
- Samyutta Nikaya (SN): Innerhalb des Samyutta Nikaya gibt es ein eigenes Kapitel, das den Jhānas gewidmet ist: das Jhāna Saṃyutta (SN 53). Auch wenn Details zum Inhalt aus den vorliegenden Informationen begrenzt sind, deutet die Existenz dieses Kapitels darauf hin, dass es eine Sammlung von Lehrreden speziell zu diesem Thema enthält und somit eine wichtige Quelle für vertiefende Studien darstellt. Die Standardformeln der Jhānas finden sich auch in anderen Kapiteln des SN, beispielsweise in SN 16.9, wo der Buddha seine eigene Fähigkeit und die des Ehrwürdigen Mahākassapa beschreibt, nach Belieben in die Jhānas einzutreten, oder in SN 45.8 als Definition der Rechten Sammlung (sammā-samādhi), dem achten Glied des Edlen Achtfachen Pfades.
- Aṅguttara Nikāya (AN): Auch der Aṅguttara Nikāya enthält zahlreiche relevante Lehrreden. Besonders hervorzuheben sind:
- AN 4.123: Paṭhamanānākaraṇa Sutta (Der Unterschied 1): Diese oft zitierte Lehrrede erklärt sehr klar die unterschiedlichen karmischen Folgen, die sich aus der Erreichung der Jhānas für einen „gewöhnlichen Menschen“ (puthujjana) und einen „edlen Schüler des Buddha“ (bhagavato sāvako) ergeben. Während beide dieselben meditativen Zustände erreichen können, führt die Erfahrung für den gewöhnlichen Menschen lediglich zu einer günstigen, aber zeitlich begrenzten Wiedergeburt in entsprechenden Himmelswelten (z.B. der Welt der strahlenden Götter, ābhassarā deva, nach dem Zweiten Jhāna), von wo aus er potenziell wieder fallen kann. Der edle Schüler hingegen kann aufgrund seines Verständnisses der Lehre in ebenjener Existenz das endgültige Nibbāna (parinibbāna) erreichen. Diese Unterscheidung betont eindrücklich, dass die meditative Sammlung erst in Verbindung mit der Weisheit der buddhistischen Lehre zur endgültigen Befreiung führt.
- AN 9.36: Jhānasutta (Die Vertiefungen): Diese Lehrrede stellt fest, dass nicht nur die vier Rūpa-Jhānas, sondern auch die vier formlosen Bereiche (Arūpa-Bereiche) und sogar die „Erlöschung von Wahrnehmung und Gefühl“ (nirodha-samāpatti) als Grundlage für die Zerstörung der Triebe (āsavakkhaya) dienen können, wenn sie mit entsprechender Einsicht verbunden werden.
- AN 11.16: Enthält eine Parallele zur Aṭṭhakanāgara Sutta (MN 52).
Die vielfältigen Erwähnungen der Jhānas in allen großen Nikāyas zeigen ihre fundamentale Rolle im frühen Buddhismus als wesentliche Werkzeuge zur Geistesschulung und als Basis für befreiende Einsicht.
7. Zusammenfassung und Ausblick
Das Zweite Jhāna (Dutiya Jhāna) stellt eine bedeutende Stufe auf dem buddhistischen Meditationspfad dar.
Es ist gekennzeichnet durch die Beruhigung des anfänglichen und anhaltenden Denkens (vitakka und vicāra) und das Aufkommen von Verzückung und Glückseligkeit (pīti und sukha), die direkt aus der gefestigten Sammlung (samādhi) entstehen.
Tiefe innere Ruhe (ajjhattaṁ sampasādanaṁ) und unerschütterliche Einspitzigkeit des Geistes (ekaggatā) sind weitere zentrale Merkmale dieses Zustands.
Als zweite der vier Rūpa-Jhānas baut Dutiya Jhāna auf dem Ersten Jhāna auf und bereitet den Weg für die noch subtileren Zustände des Dritten und Vierten Jhāna vor.
Es ist ein Zustand tiefen inneren Friedens und Wohlbefindens, der durch das Loslassen diskursiver geistiger Aktivität erreicht wird.
Die Lehrreden des Palikanons, insbesondere in den Sammlungen Dīgha Nikāya, Majjhima Nikāya, Samyutta Nikaya und Aṅguttara Nikāya, betonen jedoch, dass die Jhāna-Erfahrung allein nicht das endgültige Ziel ist.
Sie ist vielmehr ein kraftvolles Werkzeug, das, wenn es mit Achtsamkeit (sati) und Weisheit (paññā) verbunden wird, zur endgültigen Befreiung vom Leiden (nibbāna) führen kann.
Die Reflexion über die Natur der Jhāna-Zustände selbst – ihre Bedingtheit und Vergänglichkeit – ist entscheidend für diesen transformativen Prozess.
Dieser Bericht kann nur eine Einführung bieten. Interessierte Leserinnen und Leser sind ermutigt, die genannten Lehrreden selbstständig auf suttacentral.net oder in anderen vertrauenswürdigen Übersetzungen zu studieren, um ein tieferes und persönlicheres Verständnis zu entwickeln.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die praktische Kultivierung der Jhānas eine anspruchsvolle meditative Übung darstellt, die idealerweise unter der Anleitung einer qualifizierten Lehrperson erfolgen sollte.
Das Studium der Texte bildet eine wertvolle Grundlage, kann aber die direkte Erfahrung und persönliche Führung nicht ersetzen.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
- Yogapedia: Definition Dutiya Jhana
- SuttaCentral
- Buddha Original Teachings Blogspot
- SuttaCentral Discourse Forum
- Dhamma Footsteps
- The Minding Centre
- Suttas.com
- Budsas.org
Weiter in diesem Bereich mit …
Drittes Jhāna (Tatiya)
Die dritte Stufe ist durch das Verblassen der aktiven Verzückung (pīti) gekennzeichnet. Hier erfährst du, wie ein Zustand tiefer, ruhiger Glückseligkeit (sukha) entsteht, der von einem wachen und klaren Geist begleitet wird, der durch Gleichmut (upekkhā), Achtsamkeit (sati) und Klarbewusstsein (sampajañña) geprägt ist. Lerne die besondere Qualität dieses „gleichmütig-glückseligen Verweilens“ kennen.