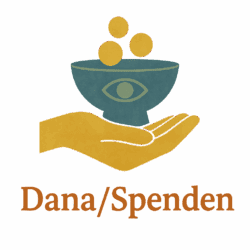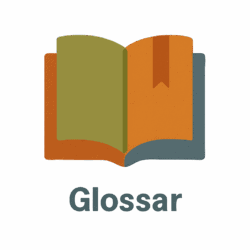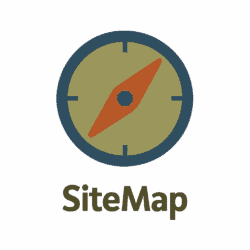Das Vierte Jhāna (Catuttha Jhāna): Gleichmut und reine Achtsamkeit im Palikanon
Eine Untersuchung der vierten und höchsten Stufe der Form-Vertiefungen im frühen Buddhismus
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Die meditativen Vertiefungen, im Pali als jhāna bezeichnet, stellen ein zentrales Element der buddhistischen Praxis dar.
Sie sind insbesondere mit dem achten Glied des Edlen Achtfachen Pfades, der Rechten Sammlung (sammā samādhi), verbunden. Diese tiefen Zustände geistiger Sammlung und Ruhe sind nicht nur für die Beruhigung des Geistes von Bedeutung, sondern bilden auch eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung befreiender Einsicht (vipassanā).
Innerhalb der Systematik der meditativen Errungenschaften nimmt das Catuttha Jhāna, das Vierte Jhāna, eine herausragende Stellung ein.
Es markiert den Höhepunkt der sogenannten Form-Vertiefungen (Rūpa-Jhānas). Dieser Bericht widmet sich der detaillierten Untersuchung dieses spezifischen Geisteszustandes.
Ziel ist es, eine klare Definition und Erklärung seiner charakteristischen Merkmale zu liefern, seinen Kontext innerhalb der vier Rūpa-Jhānas zu erläutern und wichtige Lehrreden (Suttas) aus den Kernsammlungen des Palikanons – dem Dīgha Nikāya (DN), Majjhima Nikāya (MN), Samyutta Nikāya (SN) und Aṅguttara Nikāya (AN) – vorzustellen, die das Vierte Jhāna schwerpunktmäßig behandeln oder definieren.
Dieser Text richtet sich an deutschsprachige Interessierte des Buddhismus. Er soll sowohl Lesern mit Grundkenntnissen der Pali-Terminologie und der Struktur der Nikāyas spezifische Verweise auf die Originaltexte (über SuttaCentral.net) zur Vertiefung ihres Verständnisses bieten, als auch Menschen ohne Vorkenntnisse einen fundierten Zugang zum Thema ermöglichen. Die korrekte Darstellung der Pali-Begriffe folgt dabei der IAST-Norm in UTF-8 Kodierung.
2. Das Vierte Jhāna (Catuttha Jhāna): Definition und Charakteristika
Das Catuttha Jhāna ist die vierte und höchste Stufe der vier Form-Vertiefungen (Rūpa-Jhānas). Es wird durch die Überwindung und das Loslassen der verbleibenden gröberen Faktoren der dritten Vertiefungsstufe erreicht.
Die Standardformel, wie sie in zahlreichen Lehrreden des Palikanons zu finden ist, beschreibt den Eintritt und das Verweilen im Vierten Jhāna wie folgt:
- Aufgeben von Freude und Schmerz: Der Meditierende hat sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā (das Aufgeben von [körperlichem] Wohlgefühl und Schmerz) verwirklicht.
- Früheres Schwinden von Frohsinn und Trübsinn: Ebenso sind pubbeva somanassadomanassānaṁ atthaṅgamā (durch das frühere Schwinden von [geistiger] Freude und Traurigkeit) die mentalen Polaritäten von Frohsinn und Trübsinn bereits überwunden.
- Erreichen des Zustands: Er tritt ein und verweilt in einem Zustand, der als adukkhamasukha (weder-schmerzhaft-noch-angenehm) beschrieben wird.
- Reinheit der Achtsamkeit durch Gleichmut: Dieser Zustand ist wesentlich gekennzeichnet durch upekkhāsatipārisuddhiṁ – eine durch Gleichmut vollkommen geläuterte Achtsamkeit.
Im Vierten Jhāna sind somit die Faktoren, die die ersten drei Stufen prägten – vitakka (Hinwendung), vicāra (Verweilen), pīti (Entzücken) und sukha (Wohlgefühl) – vollständig zur Ruhe gekommen und aufgegeben.
Die verbleibenden Kernqualitäten sind upekkhā (Gleichmut) und ekaggatā (Einspitzigkeit des Geistes, Konzentration).
Zur Klärung der zentralen Begriffe:
- Upekkhā (Gleichmut): Dieser Begriff bezeichnet im Kontext der Jhānas weit mehr als bloße Gleichgültigkeit. Es ist ein Zustand tiefer innerer Balance, Ausgeglichenheit und Stabilität des Geistes, frei von jeglichem Anhaften an Angenehmes oder Ablehnung von Unangenehmem. Im Vierten Jhāna erreicht dieser Gleichmut eine besondere Qualität der Reinheit (pārisuddhi), die ihn von dem im Dritten Jhāna vorhandenen Gleichmut unterscheidet, der noch mit einem subtilen Wohlgefühl (sukha) verbunden ist.
- Adukkhamasukha (Weder-schmerzhaft-noch-angenehm): Dies ist der spezifische neutrale Gefühlston (vedanā), der das Vierte Jhāna charakterisiert. Er liegt jenseits der üblichen Polarität von angenehm (sukha) und schmerzhaft/unangenehm (dukkha). Wichtig ist, dass dieser neutrale Ton nicht als Dumpfheit oder mangelnde Bewusstheit missverstanden wird, sondern als eine klare, bewusste Empfindung ohne hedonische Färbung.
- Upekkhāsatipārisuddhi (Durch Gleichmut geläuterte Achtsamkeit): Dies ist vielleicht das markanteste Merkmal. Die Achtsamkeit (sati) ist hier nicht mehr von subtilen positiven Gefühlen (wie dem sukha des Dritten Jhāna) beeinflusst oder gefärbt. Sie ist durch den tiefen, stabilen Gleichmut (upekkhā) vollkommen rein (pārisuddhi) und klar geworden. Dies deutet auf eine Bewusstseinsqualität hin, die nicht nur frei von Störungen ist, sondern aktiv klar, leuchtend und unverfälscht wahrnimmt. Die Läuterung (pārisuddhi) durch Gleichmut (upekkhā) hebt diesen Zustand über bloße Konzentration (ekaggatā) hinaus.
Die Lehrreden verwenden oft ein eindrückliches Gleichnis, um die Qualität dieses Zustandes zu veranschaulichen: Ein Mann sitzt von Kopf bis Fuß in ein makellos weißes Tuch gehüllt, sodass kein Teil seines Körpers unbedeckt bleibt.
Ebenso durchdringt den Meditierenden im Vierten Jhāna eine reine, klare Bewusstheit (parisuddhena cetasā pariyodātena), die den gesamten Geist-Körper-Komplex erfüllt.
Die explizite Erwähnung, dass nicht nur körperliches Wohlgefühl (sukha) und Schmerz (dukkha), sondern auch die bereits zuvor geschwundenen geistigen Zustände von Frohsinn (somanassa) und Trübsinn (domanassa) überwunden sind, unterstreicht die Tiefe der erreichten emotionalen Neutralität.
Während sukha und dukkha oft primär körperlich verstanden werden, beziehen sich somanassa und domanassa eindeutig auf mentale Freuden und Leiden. Das Dritte Jhāna ist noch von sukha geprägt.
Dass im Vierten Jhāna alle vier dieser affektiven Pole transzendiert sind, zeigt eine umfassende Beruhigung, die über das rein Körperliche hinausgeht und auch subtilste geistige Regungen in einen Zustand vollkommener Ausgeglichenheit (adukkhamasukha) überführt.
3. Einordnung: Die Stufenleiter der Form-Vertiefungen (Rūpa-Jhānas)
Das Vierte Jhāna ist Teil einer Sequenz von vier aufeinander aufbauenden meditativen Zuständen, den Rūpa-Jhānas oder Form-Vertiefungen. Sie werden so genannt, weil ihre Entwicklung typischerweise auf der Konzentration auf ein Objekt basiert, das als „Form“ (rūpa) klassifiziert wird.
Dieser Begriff rūpa ist vielschichtig und kann sich auf physische Objekte (wie eine Meditationsscheibe, kasiṇa), den Atem, aber auch auf subtilere mentale Erscheinungen oder Vorstellungen (nimitta) beziehen, die im Laufe der Meditation auftreten können. Diese vier Jhānas bilden den Kern der Entwicklung von Rechter Sammlung (sammā samādhi) im Rahmen des Achtfachen Pfades.
Die Entwicklung durch die Rūpa-Jhānas stellt einen systematischen Prozess der Verfeinerung des Bewusstseins dar, der durch das schrittweise Loslassen gröberer mentaler Faktoren gekennzeichnet ist:
- Erstes Jhāna (Pathama Jhāna): Wird erreicht durch geistige Abgeschiedenheit von Sinnesvergnügen (kāma) und unheilsamen Geisteszuständen (akusala dhamma). Es ist charakterisiert durch das Vorhandensein von fünf Faktoren: vitakka (die anfängliche Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt), vicāra (das anhaltende, prüfende Verweilen beim Objekt), pīti (freudiges Interesse, Entzücken), sukha (Glückseligkeit, Wohlgefühl) und ekaggatā (Einspitzigkeit des Geistes, Konzentration). Freude und Glück sind hier „aus der Abgeschiedenheit geboren“ (vivekaja).
- Zweites Jhāna (Dutiya Jhāna): Entsteht durch das Beruhigen und Überwinden von vitakka und vicāra. Die diskursive Beschäftigung mit dem Objekt tritt zurück. Es ist gekennzeichnet durch inneres Vertrauen und Beruhigung (sampasādana), die verbleibenden Faktoren pīti, sukha und ekaggatā. Freude und Glück sind hier „aus der Sammlung geboren“ (samādhija), was auf eine tiefere Stufe der Konzentration hinweist.
- Drittes Jhāna (Tatiya Jhāna): Wird erreicht durch das Schwinden (virāga) der intensiven Freude (pīti). Der Geist wird ruhiger und subtiler. Diese Stufe ist gekennzeichnet durch upekkhā (Gleichmut), sati (Achtsamkeit), sampajañña (klares Verstehen), das verbleibende, nun aber ruhigere sukha (Wohlgefühl, das explizit als körperlich erfahren beschrieben wird) und ekaggatā. Die Suttas beschreiben den Meditierenden hier als jemanden, der „gleichmütig, achtsam, glückselig verweilt“ – eine Formel, die die besondere Qualität dieses Zustandes hervorhebt.
- Viertes Jhāna (Catuttha Jhāna): Entsteht durch das vollständige Aufgeben von sukha und dukkha (sowie dem früheren Schwinden von somanassa und domanassa). Es ist, wie oben beschrieben, durch upekkhāsatipārisuddhi (durch Gleichmut geläuterte Achtsamkeit) und ekaggatā gekennzeichnet, in einem Zustand von adukkhamasukha (Weder-schmerzhaft-noch-angenehm).
Diese Abfolge verdeutlicht einen gezielten Prozess der Läuterung: Zuerst werden die gröbsten Ablenkungen (Sinnesvergnügen, unheilsame Zustände) überwunden, dann das aktive Denken (vitakka/vicāra), gefolgt von der aufgeregteren Freude (pīti) und schließlich auch das subtilere Wohlgefühl (sukha).
Das Vierte Jhāna stellt somit den Gipfel dieser Verfeinerung innerhalb des Bereichs der formbezogenen Meditation dar.
Nach dem Vierten Jhāna beschreiben die Texte vier weitere meditative Errungenschaften, die als Arūpa-Jhānas (Formlose Vertiefungen) oder Āruppas (formlose Bereiche) bekannt sind. Diese basieren nicht mehr auf einem Form-Objekt, sondern auf der Ausrichtung des Geistes auf zunehmend subtilere Konzepte: die Unendlichkeit des Raumes (ākāsānañcāyatana), die Unendlichkeit des Bewusstseins (viññāṇañcāyatana), die Nichtsheit (ākiñcaññāyatana) und den Zustand des Weder-Wahrnehmens-noch-Nichtwahrnehmens (nevasaññānāsaññāyatana).
Der Eintritt in diese formlosen Bereiche setzt die Meisterschaft des Vierten Jhāna voraus und beginnt explizit mit dem „vollständigen Überwinden der Formwahrnehmungen“ (sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā). Dies markiert eine fundamentale Schwelle: Das Vierte Jhāna ist der stabilste und reinste Zustand, der noch eine Verbindung zur Sphäre der „Form“ (rūpa) hat, auch wenn diese Wahrnehmung hier bereits extrem subtil geworden sein mag. Es bildet die notwendige Plattform für den Übergang in die gänzlich formfreien Dimensionen der Meditation.
4. Zugehörige Konzepte und Debatten
Das Vierte Jhāna steht nicht isoliert da, sondern ist in ein Netz wichtiger buddhistischer Konzepte eingebettet und Gegenstand von Diskussionen:
- Samādhi (Sammlung/Konzentration): Wie bereits erwähnt, bilden die vier Rūpa-Jhānas die kanonische Definition für Rechte Sammlung (sammā samādhi), den achten Faktor des Edlen Achtfachen Pfades. Das Vierte Jhāna repräsentiert dabei die höchste Stufe dieser Form der Sammlung, gekennzeichnet durch unerschütterliche Einspitzigkeit (ekaggatā) und vollkommene geistige Ausgeglichenheit (upekkhā).
- Āsavas (Triebe/Befleckungen/Fermentationen): Ein zentrales Anliegen der buddhistischen Praxis ist die Überwindung der Āsavas – der tiefsitzenden Neigungen oder „Fermentationen“ des Geistes, die uns im Kreislauf des Leidens (Saṃsāra) gefangen halten. Traditionell werden drei oder vier genannt: der Sinnensucht-Trieb (kāmāsava), der Werde-Trieb (bhavāsava), der Ansichten-Trieb (diṭṭhāsava, manchmal weggelassen oder unter bhavāsava subsumiert) und der Nichtwissen-Trieb (avijjāsava). Die Jhānas, einschließlich des Vierten, werden im Palikanon als eine entscheidende Grundlage (nissāya) für die endgültige Zerstörung (khaya) dieser Triebe betrachtet. Die Lehrrede AN 9.36 ist hier von besonderer Bedeutung, da sie explizit darlegt, wie die Praxis der Einsicht (vipassanā) auf der Basis jedes einzelnen Jhāna-Zustandes zur Befreiung von den Āsavas führen kann.
- Vipassanā (Einsicht): Obwohl die Jhānas primär der Entwicklung von geistiger Ruhe und Sammlung (samatha) dienen, ist diese Sammlung kein Selbstzweck. Die im Jhāna, insbesondere im Vierten Jhāna mit seiner Klarheit und Stabilität, erreichte Qualität des Geistes wird als ideale Voraussetzung für die Entwicklung von Vipassanā angesehen – der direkten, durchdringenden Einsicht in die wahre Natur aller Phänomene: ihre Vergänglichkeit (anicca), Leidhaftigkeit (dukkha) und Nicht-Selbst-Natur (anattā). AN 9.36 beschreibt, wie der Meditierende die im jeweiligen Jhāna-Zustand vorhandenen geistigen Faktoren (wie Gefühl, Wahrnehmung etc.) eben dieser Einsicht unterzieht und den Geist auf das „Todlose Element“ (Nibbāna) ausrichtet. Dies deutet stark darauf hin, dass Samatha und Vipassanā im buddhistischen Pfad nicht als strikt getrennte, nacheinander zu absolvierende Praktiken verstanden werden müssen, sondern als sich gegenseitig unterstützende und durchdringende Aspekte der Geistesschulung. Die Aussage in AN 9.36, dass jedes der vier Jhānas (und sogar die formlosen Bereiche) eine Basis zur Beendigung der Triebe sein kann, wenn Einsicht angewendet wird, widerspricht einer Sichtweise, die Jhāna lediglich als vorbereitenden Schritt betrachtet, der abgeschlossen sein muss, bevor die eigentliche Einsichtsarbeit beginnt.
- Debatten („Jhāna Wars“): Gerade im modernen, insbesondere westlichen Buddhismus gibt es teils intensive Debatten über die Natur und Tiefe der Jhānas. Fragen, die diskutiert werden, sind unter anderem: Wie tief muss die Konzentration sein? Hören äußere Sinneswahrnehmungen (wie Hören oder Körperempfindungen) in den Jhānas vollständig auf? Welche Rolle spielen die späteren Kommentare, insbesondere der Visuddhimagga von Buddhaghosa, im Vergleich zu den Aussagen der frühen Lehrreden (Suttas)?. Die Suttas selbst enthalten Passagen, die unterschiedlich interpretiert werden können. Beispielsweise wird im Dritten Jhāna das Wohlgefühl (sukha) als „mit dem Körper erfahren“ beschrieben, was manche als Hinweis auf verbleibendes Körperbewusstsein deuten, während andere argumentieren, dass „Körper“ (kāya) hier den „mentalen Körper“ (nāmakāya) meint. Ähnlich wird diskutiert, ob der Atem im Vierten Jhāna tatsächlich physisch aufhört, wie es SN 36.11 nahelegt, oder ob dies metaphorisch zu verstehen ist. Die Existenz dieser Debatten und die Mehrdeutigkeit mancher Sutta-Stellen unterstreichen, dass die Jhāna-Erfahrungen äußerst subtil sind und ihre sprachliche Beschreibung an Grenzen stößt. Dies legt nahe, dass eine dogmatische Festlegung schwierig ist und die persönliche Erforschung unter Bezugnahme auf die vielfältigen Hinweise im Kanon, idealerweise unter qualifizierter Anleitung, im Vordergrund stehen sollte.
5. Schlüssel-Lehrreden (Suttas) zum Vierten Jhāna
Die folgenden Lehrreden aus den vier Haupt-Nikāyas des Palikanons sind besonders relevant für das Verständnis des Vierten Jhāna.
Sie enthalten entweder die Standarddefinition oder behandeln diesen Zustand in einem wichtigen Lehrkontext.
Die Referenzen verweisen auf SuttaCentral.net, eine umfassende Quelle für buddhistische Texte.
Dīgha Nikāya (DN) – Die Längere Sammlung
DN 2: Sāmaññaphala Sutta (Die Früchte des Asketenlebens)
- Referenz: https://suttacentral.net/dn2/de/sabbamitta
- Deutscher Titel: Die Früchte des Asketenlebens
- Relevanz: Dieses bedeutende Sutta präsentiert eine umfassende Darstellung des buddhistischen Übungsweges als Antwort auf die Frage von König Ajātasattu nach den sichtbaren Früchten eines Asketenlebens. Es enthält die Standardformeln für alle vier Rūpa-Jhānas. Das Vierte Jhāna wird hier als eine hohe Stufe der geistigen Läuterung beschrieben, die den Geist „rein und klar, makellos, frei von Fehlern, geschmeidig, handhabbar, stetig und zur Unerschütterlichkeit gelangt“ macht – eine Basis für die Entwicklung höherer Erkenntnisse (abhiññā) wie das Wissen um frühere Leben oder das göttliche Auge.
- Pali-Auszug (4. Jhāna): So sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṁ atthaṅgamā adukkhamasukhaṁ upekkhāsatipārisuddhiṁ catutthaṁ jhānaṁ upasampajja viharati. (Die Formel ist Standard und wird in Suttas wie diesem erwartet, die den Pfad detailliert beschreiben).
Majjhima Nikāya (MN) – Die Mittlere Sammlung
MN 39: Mahāassapura Sutta (Die große Lehrrede in Assapura)
- Referenz: https://suttacentral.net/mn39/de/sabbamitta
- Deutscher Titel: Die große Lehrrede in Assapura (oder Assapura I)
- Relevanz: In dieser Lehrrede ermahnt der Buddha die Mönche, den wahren Anforderungen und dem Geist des Asketentums gerecht zu werden (samaṇakaraṇīya dhamma). Auch hier werden die vier Jhānas mit ihren Standardformeln als integraler Bestandteil dieses Weges der Läuterung und Verwirklichung aufgeführt.
- Pali-Auszug (4. Jhāna): So sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṁ atthaṅgamā adukkhamasukhaṁ upekkhāsatipārisuddhiṁ catutthaṁ jhānaṁ upasampajja viharati. (Auch hier ist die Standardformel Teil der Beschreibung des fortgeschrittenen Pfades).
Samyutta Nikāya (SN) – Die Gruppierte Sammlung
SN 34: Jhāna Saṃyutta (Gruppierte Lehrreden über die Vertiefungen)
- Referenz: https://suttacentral.net/sn34
- Deutscher Titel: Gruppierte Lehrreden über Jhānas (oder Meditation)
- Relevanz: Dieses gesamte Kapitel (saṃyutta) ist ausschließlich den Jhānas gewidmet. Es besteht aus 55 kurzen Suttas, die verschiedene Aspekte der Jhāna-Praxis beleuchten, z.B. unterschiedliche Arten von Praktizierenden oder den Zweck der Jhāna-Entwicklung (wie in SN 53.54 [Anmerkung: Referenz vermutlich SN 34.54 gemeint], wo sie mit der Überwindung der höheren Fesseln verbunden werden). Die Existenz eines eigenen Saṃyutta unterstreicht die zentrale Bedeutung der Jhānas in der Lehre des Buddha.
SN 45.8: Vibhaṅgasutta (Lehrrede über die Analyse [des Pfades])
- Referenz: https://suttacentral.net/sn45.8/de/sabbamitta
- Deutscher Titel: Analyse (des Achtfachen Pfades)
- Relevanz: Dieses Sutta liefert die kanonische Definition der acht Glieder des Edlen Achtfachen Pfades. Rechte Sammlung (sammā samādhi) wird hier unmissverständlich und ausschließlich durch die Standardformeln der vier Rūpa-Jhānas definiert. Dies verankert das Vierte Jhāna fest als integralen Bestandteil und Höhepunkt der Rechten Sammlung im Kern der buddhistischen Lehre.
- Pali-Auszug (4. Jhāna in Definition von Sammā Samādhi): … sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṁ atthaṅgamā adukkhamasukhaṁ upekkhāsatipārisuddhiṁ catutthaṁ jhānaṁ upasampajja viharati. Ayaṁ vuccati, bhikkhave, sammāsamādhi.
Aṅguttara Nikāya (AN) – Die Angereihte Sammlung
AN 9.36: Jhānasutta (Lehrrede über die Vertiefungen)
- Referenz: https://suttacentral.net/an9.36/de/nyanatiloka
- Deutscher Titel: Lehrrede über die Vertiefungen (oder Abhängig von Vertiefung)
- Relevanz: Dies ist eine außerordentlich wichtige und häufig zitierte Lehrrede, die die Bedeutung der Jhānas (einschließlich der vier formlosen Bereiche) für das Endziel der Befreiung hervorhebt. Der Buddha erklärt hier explizit, dass die Beendigung der Triebe (āsavānaṁ khayaṁ) von den meditativen Vertiefungen abhängt (nissāya). Entscheidend ist die Beschreibung, wie aus dem jeweiligen Zustand heraus Einsicht (vipassanā) in die Natur der beteiligten geistigen Faktoren geübt wird, was dann zur Befreiung oder zumindest zur Nichtwiederkehr führt.
- Pali-Auszug (Relevanz 4. Jhāna): Catutthampāhaṁ, bhikkhave, jhānaṁ nissāya āsavānaṁ khayaṁ vadāmi… (Ich sage, Mönche, dass die Beendigung der Triebe vom vierten Jhāna abhängt…).
Die durchgängige Präsenz der Jhāna-Formeln, insbesondere der des Vierten Jhāna, in den verschiedenen Nikāyas und in unterschiedlichen Lehrkontexten – sei es als Frucht des Asketenlebens (DN 2), als Teil der idealen Mönchspraxis (MN 39), als Definition der Rechten Sammlung (SN 45.8) oder als Basis für die endgültige Befreiung (AN 9.36) – unterstreicht ihre fundamentale und fest etablierte Stellung im Kern der frühen buddhistischen Lehre. Es handelt sich nicht um eine nebensächliche oder spätere Hinzufügung, sondern um einen integralen Bestandteil des vom Buddha gelehrten Weges.
Darüber hinaus positionieren diese Lehrreden das Vierte Jhāna nicht nur als Kulminationspunkt der Form-Meditationen, sondern auch als kraftvolles Sprungbrett für weitere spirituelle Entwicklungen.
Es dient als Ausgangspunkt für die formlosen Meditationen (Arūpa-Jhānas), als Basis für die Entfaltung höherer geistiger Fähigkeiten (abhiññā, erwähnt in DN 2) und, in Verbindung mit Einsicht, als Grundlage für die vollständige Zerstörung der geistigen Triebe (Āsavas) und die Erlangung von Nibbāna (wie in AN 9.36 dargelegt).
6. Tabelle: Ausgewählte Lehrreden zum Vierten Jhāna
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten im Bericht genannten Lehrreden zusammen und bietet einen schnellen Überblick sowie direkten Zugang zu den Texten auf SuttaCentral.net.
| Nikāya | Sutta Nr. | Pali-Name | Deutscher Titel (gängig) | Kurze Relevanz für Catuttha Jhāna | SuttaCentral Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 2 | Sāmaññaphala Sutta | Die Früchte des Asketenlebens | Enthält Standardformel als Frucht des Weges | https://suttacentral.net/dn2/de/sabbamitta |
| MN | 39 | Mahāassapura Sutta | Die große Lehrrede in Assapura | Enthält Standardformel im Kontext der Mönchspflichten | https://suttacentral.net/mn39/de/sabbamitta |
| SN | 34 | Jhāna Saṃyutta | Gruppierte Lehrreden über Jhānas | Ganzes Kapitel den Jhānas gewidmet | https://suttacentral.net/sn34 |
| SN | 45.8 | Vibhaṅgasutta | Analyse (des Achtfachen Pfades) | Definiert Sammā Samādhi über die 4 Jhānas | https://suttacentral.net/sn45.8/de/sabbamitta |
| AN | 9.36 | Jhānasutta | Lehrrede über die Vertiefungen | Verbindet Jhānas direkt mit der Beendigung der Āsavas | https://suttacentral.net/an9.36/de/nyanatiloka |
7. Zusammenfassung und Ausblick
Das Vierte Jhāna (Catuttha Jhāna) stellt einen hochentwickelten Zustand meditativer Vertiefung dar, der durch vollkommenen Gleichmut (upekkhā) und eine dadurch geläuterte, klare Achtsamkeit (satipārisuddhi) gekennzeichnet ist.
Es transzendiert die Polaritäten von körperlichem Wohlgefühl und Schmerz sowie von geistigem Frohsinn und Trübsinn und mündet in einem Zustand des Weder-schmerzhaft-noch-angenehmen (adukkhamasukha).
Als Höhepunkt der vier Form-Vertiefungen (Rūpa-Jhānas) ist es ein integraler Bestandteil der Rechten Sammlung (sammā samādhi) im Edlen Achtfachen Pfad.
Die Bedeutung des Vierten Jhāna liegt nicht nur in der tiefen Ruhe und Stabilität, die es bietet, sondern vor allem in seiner Funktion als kraftvolle Basis für weiterführende spirituelle Entwicklungen.
Wie insbesondere das Jhānasutta (AN 9.36) hervorhebt, kann die in diesem Zustand erreichte Klarheit und Sammlung genutzt werden, um durch Einsicht (vipassanā) in die wahre Natur der Phänomene die tiefsten geistigen Trübungen (āsavas) zu überwinden und Befreiung zu erlangen.
Es ist somit ein entscheidender Zustand auf dem Weg zur Beendigung des Leidens.
Die in diesem Bericht vorgestellten Lehrreden bieten authentische Einblicke in die Lehre des Buddha über das Vierte Jhāna.
Es sei allen Lesern empfohlen, diese Texte auf SuttaCentral.net selbst zu studieren, um ihr Verständnis zu vertiefen.
Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Praxis der Meditation, insbesondere das Erreichen solch tiefer Zustände, komplex ist und idealerweise unter der Anleitung erfahrener Lehrer erfolgen sollte.
Die anhaltenden Diskussionen und unterschiedlichen Interpretationen selbst unter Praktizierenden und Gelehrten („Jhāna Wars“) zeigen, dass das Verständnis dieser tiefen Dimensionen des Geistes ein fortwährender Prozess der Erforschung und Klärung bleibt.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
- Access to Insight: Jhana
- SuttaCentral
- Buddhismus Aktuell: Ein klarer Geist, frei von Hindernissen
- Buddhist Publication Society: The Jhānas
- Yogapedia: Catuttha Jhana
- Wisdom Library: Fourth jhana
- Wikipedia (de): Dhyana
- AnthroWiki: Jhana
Weiter in diesem Bereich mit …
Jhāna (Meditative Vertiefungen)
Was genau sind die Jhānas? Hier erhältst du einen grundlegenden Überblick über diese fortgeschrittenen Zustände meditativer Vertiefung. Erfahre mehr über die Bedeutung des Begriffs, die acht Hauptstufen – unterteilt in die vier Form-Vertiefungen (Rūpa-Jhānas) und die vier Formlosen Vertiefungen (Arūpa-Jhānas) – und ihre zentrale Rolle im buddhistischen Pfad als Grundlage für Sammlung (Samādhi) und Einsicht (Vipassanā).