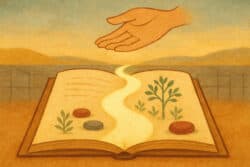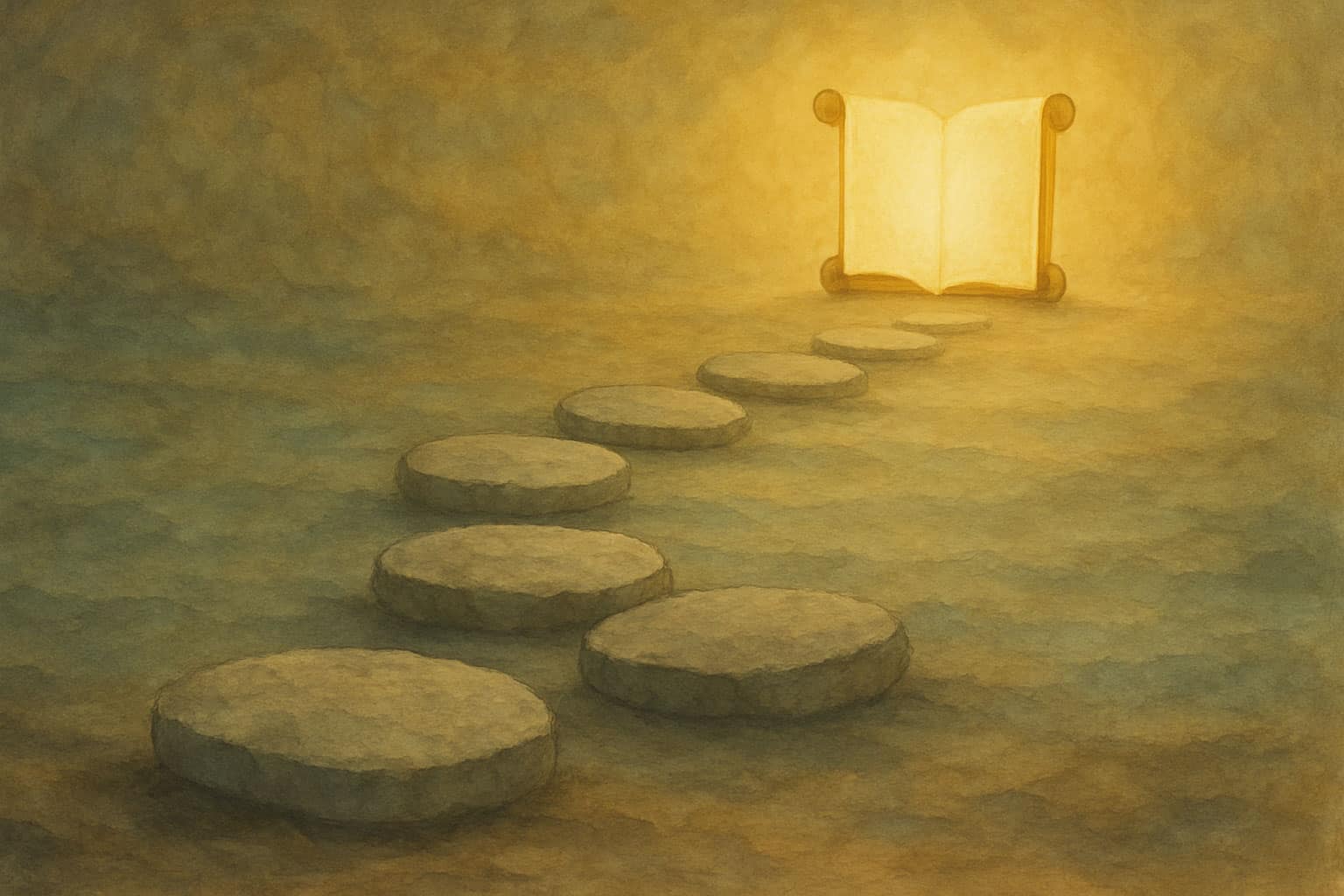
Zugänglichkeit und Übersetzungen
Übersetzungen, digitale Ressourcen und die Rolle der Kommentare für das Verständnis
Inhaltsverzeichnis
Der Zugang zum Pāli-Kanon stellt für Interessierte heute trotz seiner historischen Bedeutung einige Herausforderungen dar, aber gleichzeitig gibt es mehr Ressourcen als je zuvor, um diese zu überwinden.
5.1. Herausforderungen des Zugangs
Drei Hauptfaktoren erschweren den direkten Zugang zum Pāli-Kanon:
- Sprachbarriere: Pāli ist eine alte indische Sprache, die heute nicht mehr gesprochen wird und sich deutlich von modernen Sprachen unterscheidet. Ein Verständnis der Originaltexte erfordert spezialisierte Sprachkenntnisse. Daher sind die meisten Menschen auf Übersetzungen angewiesen.
- Umfang: Das Tipiṭaka ist eine gewaltige Textsammlung. Allein der Pāli-Text umfasst fast 2,7 Millionen Wörter. In gedruckten Übersetzungen füllt der Kanon viele tausend Seiten, verteilt auf Dutzende von Bänden. Dieser immense Umfang macht es schwierig, einen Überblick zu gewinnen oder den Kanon vollständig zu lesen.
- Stil: Wie unter „Textformen & Stil“ beschrieben, ist der Stil des Kanons stark von der mündlichen Überlieferung geprägt. Die häufigen Wiederholungen und die formelhafte Sprache können für moderne Leser ungewohnt und manchmal ermüdend sein, auch wenn sie ursprünglich mnemotechnische und didaktische Zwecke erfüllten.
5.2. Deutsche Übersetzungen: Ein Überblick
Eine vollständige, einheitliche und moderne deutsche Übersetzung des gesamten Pāli-Kanons existiert derzeit nicht. Es gibt jedoch Übersetzungen wichtiger Teile von verschiedenen Übersetzern aus unterschiedlichen Epochen:
Pioniere:
- Karl Eugen Neumann (1865–1915): Er legte die erste vollständige deutsche Übersetzung der vier Haupt-Nikāyas (Dīgha, Majjhima, Saṃyutta, Aṅguttara) sowie von Teilen des Khuddaka Nikāya vor. Seine Übersetzungen sind für ihre poetische Sprache bekannt, gelten aber heute teilweise als philologisch überholt und von seiner eigenen Interpretation (beeinflusst durch Schopenhauer) geprägt.
- Nyanatiloka Mahathera (1878–1957): Der erste deutsche buddhistische Mönch übersetzte wichtige Teile des Kanons, insbesondere den Aṅguttara Nikāya und Teile des Khuddaka Nikāya, und verfasste grundlegende systematische Werke wie „Das Wort des Buddha“ und das „Buddhistische Wörterbuch“, die bis heute Standardwerke sind.
- Karl Seidenstücker (1876–1938): Ein weiterer früher Übersetzer, der unter anderem das Udāna und das Itivuttaka übertrug.
Neuere Übersetzer und Ausgaben:
- Hellmuth Hecker (1923–2017): Übersetzte mehrere Bücher des Khuddaka Nikāya (Itivuttaka, Vimānavatthu, Petavatthu) sowie Teile des Saṃyutta und Aṅguttara Nikāya. Er war auch an der Herausgabe der Geiger-Übersetzung des SN beteiligt.
- Wilhelm Geiger (1856–1943): Bedeutender Indologe, übersetzte große Teile des Saṃyutta Nikāya ins Deutsche.
- Kay Zumwinkel: Seine Übersetzung des Majjhima Nikāya wird oft für ihre gute Lesbarkeit und Zuverlässigkeit gelobt und als Einstieg empfohlen.
- Weitere: Es gibt diverse Anthologien und Übersetzungen einzelner Texte von Autoren wie Helmuth von Glasenapp, Raimund Hopf, Paul Köppler oder in neuerer Zeit durch Projekte wie SuttaCentral (Übersetzungen von Sabbamitta u. a.).
Die Übersetzungen sind bei verschiedenen Verlagen erschienen (z. B. Beyerlein & Steinschulte, Jhana Verlag, Reclam).
5.3. Englische Übersetzungen und die Pāli Text Society (PTS)
Im englischsprachigen Raum ist die Verfügbarkeit von Übersetzungen umfassender, maßgeblich gefördert durch die Pāli Text Society (PTS). Gegründet 1881 von T. W. Rhys Davids, hat die PTS Pionierarbeit bei der Edition des gesamten Pāli-Kanons in lateinischer Schrift (romanisiertes Pāli) und dessen Übersetzung ins Englische geleistet. Ihre Ausgaben und Übersetzungen sind bis heute wichtige Referenzwerke für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Kanon.
Zu den bedeutendsten englischen Übersetzern gehören:
- Bhikkhu Bodhi: Ein amerikanischer Mönchsgelehrter, dessen Übersetzungen des Majjhima Nikāya, Saṃyutta Nikāya und Aṅguttara Nikāya sowie seine Anthologie „In the Buddha’s Words“ weithin als Standardwerke gelten, die philologische Genauigkeit mit guter Lesbarkeit verbinden.
- Thanissaro Bhikkhu: Ein weiterer amerikanischer Mönch, der einen Großteil des Kanons übersetzt hat und seine Arbeiten kostenlos online auf dhammatalks.org zur Verfügung stellt. Seine Übersetzungen sind bekannt für ihre Präzision und ihren Praxisbezug.
- Weitere wichtige Übersetzer: Maurice Walshe (Dīgha Nikāya), I. B. Horner (Vinaya Piṭaka, Teile des Majjhima Nikāya), K. R. Norman (Sutta Nipāta, Theragāthā, Therīgāthā), C. A. F. Rhys Davids (Mitbegründerin der PTS, viele frühe Übersetzungen).
5.4. Leseempfehlungen für Einsteiger
Angesichts des Umfangs des Kanons ist es für Anfänger ratsam, mit ausgewählten Texten oder Sammlungen zu beginnen:
- Anthologien: Thematisch geordnete Sammlungen von Suttas bieten einen guten ersten Überblick über die Bandbreite der Lehren. Empfehlenswert sind z. B. „In the Buddha’s Words“ von Bhikkhu Bodhi (englisch), „Das Wort des Buddha“ von Nyanatiloka (deutsch) oder „Reden des Buddha“ herausgegeben von Helmuth von Glasenapp (deutsch).
- Kürzere Texte aus dem Khuddaka Nikāya: Diese sind oft zugänglicher und enthalten einige der bekanntesten buddhistischen Texte:
- Dhammapada: Eine Sammlung von 423 prägnanten Versen über Ethik und Weisheit, sehr populär und oft übersetzt.
- Sutta Nipāta: Enthält einige der ältesten Lehrdichtungen, darunter das Mettā Sutta und das Maṅgala Sutta.
- Udāna und Itivuttaka: Sammlungen kurzer Lehrreden in Prosa und Versform.
- Zentrale Lehrreden:
- Systematischer Einstieg: Der Majjhima Nikāya (Mittlere Sammlung) wird oft empfohlen, da er eine gute Balance zwischen Länge und thematischer Breite bietet und viele Kernlehren enthält. Die deutsche Übersetzung von Kay Zumwinkel gilt als gut zugänglich.
5.5. Die Rolle der Kommentare (Aṭṭhakathā) und Subkommentare (Ṭīkā)
Neben dem Kanon selbst spielt die Kommentarliteratur eine wichtige Rolle im Theravāda-Buddhismus.
- Aṭṭhakathā (Kommentare): Dies sind umfangreiche Werke, die die kanonischen Texte Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt erklären. Sie gehen auf sehr alte mündliche und später in Singhalesisch verfasste Kommentare zurück, die heute verloren sind. Der Großteil der heute bekannten Pāli-Kommentare wurde im 5. Jahrhundert n. Chr. von dem berühmten indischen Gelehrten Buddhaghosa in Sri Lanka verfasst oder kompiliert. Buddhaghosa ist auch der Autor des Visuddhimagga („Weg zur Reinheit“), einer monumentalen, enzyklopädischen Darstellung des gesamten buddhistischen Pfades gemäß der Mahāvihāra-Tradition, die zwar kein direkter Kanon-Kommentar ist, aber als Schlüsselwerk zum Verständnis des Theravāda gilt. Die Kommentare erfüllen wichtige Funktionen: Sie erläutern schwierige Begriffe und Passagen, liefern grammatikalische Analysen, geben Hintergrundinformationen (z. B. die Geschichten zu den Jātakas oder den Anlass für bestimmte Regeln im Vinaya), definieren Schlüsselbegriffe und präsentieren die orthodoxe Interpretation der Lehre aus Sicht der Theravāda-Schule.
- Ṭīkā (Subkommentare): Später entstanden weitere Kommentare, die Ṭīkās genannt werden. Diese kommentieren wiederum die Aṭṭhakathās und bieten noch detailliertere Analysen und Erklärungen. Die Tradition der Subkommentare begann in Sri Lanka im 12. Jahrhundert mit Gelehrten wie Sāriputta Thera.
Es ist entscheidend, zwischen dem Kanon (Pāli) als dem ursprünglichen „Wort des Buddha“ und der späteren Kommentarliteratur (Aṭṭhakathā, Ṭīkā) zu unterscheiden. Obwohl die Kommentare für das traditionelle Verständnis unverzichtbar sind, repräsentieren sie eine spätere Interpretationsschicht. Sie sind eine unschätzbare Hilfe zum Verständnis, können aber auch eine bestimmte orthodoxe Sichtweise prägen, die nicht immer die einzig mögliche Lesart des Kanons darstellt oder mit modernen Erkenntnissen übereinstimmt. Beispielsweise wird Buddhaghosas Interpretation von Ānāpānasati im Visuddhimagga oft als reine Konzentrationsübung auf den Atem dargestellt, was von manchen als Verengung gegenüber der breiteren Achtsamkeitspraxis in den Suttas kritisiert wird.
5.6. Digitale Ressourcen
Die digitale Technologie hat den Zugang zum Pāli-Kanon revolutioniert:
Webseiten:
- SuttaCentral.net: Eine herausragende, nicht-kommerzielle Webseite, die den Pāli-Kanon in Pāli sowie in zahlreichen Übersetzungen (darunter viele deutsche Übersetzungen von Sabbamitta und anderen) kostenlos anbietet. Sie ermöglicht den Vergleich von Übersetzungen, zeigt Parallelen zu Texten anderer buddhistischer Schulen und bietet umfangreiche Suchfunktionen.
- Palikanon.com: Eine deutschsprachige Ressource mit vielen Übersetzungen von Suttas, einem Online-Wörterbuch und weiteren Materialien.
- AccessToInsight.org: Eine umfangreiche englischsprachige Bibliothek mit über tausend Sutta-Übersetzungen (hauptsächlich von Thanissaro Bhikkhu), Artikeln und Studienhilfen.
- Weitere: Dhamma-dana.de (deutsche Texte und Studiengruppen), Website der Pāli Text Society (Informationen zu Publikationen).
Apps und Software:
- Digital Pāli Reader (DPR): Eine leistungsstarke (webbasierte oder installierbare) Anwendung für das vertiefte Studium. Bietet den Pāli-Text mit integrierten Wörterbüchern (Pāli-Englisch), Grammatikanalysen, Suchfunktionen und der Möglichkeit, Kommentare und Subkommentare parallel anzuzeigen.
- Tipitaka Pāli Reader: Eine mobile App (Android/iOS), die den Pāli-Text, Wörterbücher und Suchfunktionen für unterwegs bietet.
- Weitere Apps: Es gibt spezialisierte Apps, z. B. für das Rezitieren von Schutztexten (Paritta), oder Apps, die den burmesischen Kanon zugänglich machen (z. B. Pāli Nissaya). SuttaCentral selbst kann als Offline-Web-App genutzt werden.
Online-Wörterbücher: Verschiedene Online-Wörterbücher (z. B. das PTS Dictionary, integrierte Wörterbücher in DPR oder auf Palikanon.com) erleichtern das Nachschlagen von Pāli-Begriffen.
5.7. Einsichten und Implikationen
Die Auseinandersetzung mit der Zugänglichkeit des Pāli-Kanons führt zu wichtigen Erkenntnissen. Erstens wird deutlich, dass Übersetzung immer Interpretation ist. Da es keine perfekte 1:1-Entsprechung zwischen Pāli und modernen Sprachen gibt, müssen Übersetzer Entscheidungen treffen, die von ihrem sprachlichen, kulturellen und oft auch spirituellen Hintergrund geprägt sind. Unterschiedliche Übersetzer (wie der philologisch-poetische Neumann, der Mönchsgelehrte Nyanatiloka oder modernere Übersetzer wie Bodhi oder Zumwinkel) wählen unterschiedliche Formulierungen und betonen möglicherweise verschiedene Aspekte der Lehre. Für ein tieferes Verständnis ist es daher oft hilfreich, verschiedene Übersetzungen zu vergleichen oder sich zumindest der Interpretationsleistung bewusst zu sein, die jede Übersetzung darstellt. Die ultimative Genauigkeit erfordert das Studium des Pāli-Originals.
Zweitens haben digitale Ressourcen den Zugang zum Kanon demokratisiert und transformiert. Was früher nur Spezialisten über teure und schwer erhältliche Buchausgaben zugänglich war, ist heute oft kostenlos online verfügbar. Plattformen wie SuttaCentral oder Werkzeuge wie der Digital Pāli Reader ermöglichen nicht nur das Lesen von Übersetzungen, sondern auch den direkten Zugriff auf den Pāli-Text, integrierte Wörterbücher, Konkordanzen und Parallelstellenanalysen. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für das Selbststudium, die vergleichende Forschung und das vertiefte Verständnis des Kanons, auch für Laien ohne formale akademische Ausbildung.
Drittens bleibt die Kommentarliteratur (Aṭṭhakathā und Ṭīkā) eine unverzichtbare Brücke zum traditionellen Verständnis des Theravāda, insbesondere die Werke Buddhaghosas. Sie erklären Kontexte, definieren Begriffe und legen die orthodoxe Interpretation fest. Gleichzeitig fungieren sie aber auch als Filter, der eine bestimmte Sichtweise tradiert, die nicht immer die einzig mögliche Lesart des Kanons ist und manchmal kritisch hinterfragt werden muss. Ein mündiger Umgang mit dem Kanon erfordert daher die Fähigkeit, zwischen der ursprünglichen Lehrrede (Pāli) und ihrer späteren Auslegung (Aṭṭhakathā) zu unterscheiden und beides in seinem jeweiligen Wert und Kontext zu würdigen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Einstieg in das Lesen des Pāli-Kanons für Laien
Der Pāli-Kanon kann auf den ersten Blick überwältigend wirken. Doch keine Sorge: Diese Seite ist dein praxisnaher Wegweiser, um die ursprünglichen Lehren des Buddha für dich zu erschließen. Wir begleiten dich mit einer handverlesenen Auswahl zentraler Suttas, die besonders für Einsteiger*innen geeignet sind, und geben dir konkrete Tipps, wie du dich in diesem reichen Schatz orientieren, lesen und die Lehren in deinen Alltag integrieren kannst.