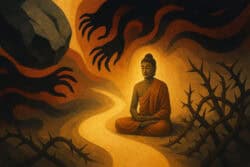Laienanhänger & Unterstützer
Wichtige Unterstützer und Praktizierende außerhalb des Ordens
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der frühe Buddhismus war keine rein monastische Bewegung. Von Anfang an spielte die Gemeinschaft der Laienanhänger – Männer (Upāsaka) und Frauen (Upāsikā) – eine entscheidende und unverzichtbare Rolle. Sie waren es, die den Buddha und die wachsende Gemeinschaft der Mönche und Nonnen (Saṅgha) mit den vier Notwendigkeiten versorgten: Nahrung, Kleidung (Roben), Unterkunft (Klöster, Wohnstätten) und Medizin. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre das Überleben und die Verbreitung der Lehre kaum möglich gewesen.
Doch die Rolle der Laien beschränkte sich nicht auf materielle Gaben (Dāna). Viele Laienanhänger waren tief im Dhamma verwurzelt, praktizierten regelmäßig Meditation, hörten aufmerksam die Lehrreden des Buddha und seiner Schüler und erreichten selbst hohe Stufen spiritueller Verwirklichung, bis hin zur Nichtwiederkehr (Anāgāmī). Der Buddha gab auch Laien spezifische ethische Richtlinien (die Fünf Übungsregeln (Pañcasīla)) und lehrte sie Wege zur Entwicklung von Weisheit und Mitgefühl im alltäglichen Leben.
Der Pāli-Kanon würdigt zahlreiche Laienanhänger für ihre herausragenden Qualitäten. Anāthapiṇḍika und Visākhā gelten als die größten männlichen bzw. weiblichen Förderer, berühmt für ihre beispiellose Großzügigkeit. Citta der Hausvater und Hatthaka von Āḷavī werden für ihre tiefe Weisheit, ihre Lehrfähigkeit und ihre organisatorischen Talente gelobt. Sujātā ging als diejenige in die Geschichte ein, die dem Bodhisatta die entscheidende Mahlzeit vor seiner Erleuchtung darbrachte. Die Tatsache, dass Laien wie Citta sogar vom Buddha als die Vordersten (Etadagga) im Lehren des Dhamma bezeichnet wurden, unterstreicht, dass tiefes Verständnis und die Fähigkeit zur Weitergabe der Lehre nicht auf Ordinierte beschränkt waren. Diese Laienanhänger sind somit nicht nur historische Figuren, sondern auch zeitlose Vorbilder dafür, wie der buddhistische Pfad inmitten der Verpflichtungen und Herausforderungen des weltlichen Lebens erfolgreich beschritten werden kann. Ihre Geschichten zeigen, dass Großzügigkeit, ethisches Verhalten und Weisheit die Säulen eines erfüllten buddhistischen Lebens sind, unabhängig davon, ob man eine Robe trägt oder nicht.
Visākhā – Bedeutendste weibliche Wohltäterin
Biografie: Visākhā war eine der prominentesten und wohlhabendsten Laienanhängerinnen des Buddha. Sie stammte aus einer reichen Familie in Bhaddiya im Lande Aṅga; ihr Vater war Dhanañjaya, ihr Großvater der berühmte Schatzmeister Meṇḍaka. Bereits im Alter von sieben Jahren begegnete sie dem Buddha bei dessen Besuch in ihrer Heimatstadt und erreichte nach dem Hören seiner Lehrrede die erste Stufe der Heiligkeit, den Stromeintritt (Sotāpatti). Später zog ihre Familie auf Wunsch von König Pasenadi nach Sāketa im Reich Kosala. Mit sechzehn Jahren heiratete sie Puṇṇavaddhana, den Sohn des reichen Schatzmeisters Migāra aus Sāvatthi, und zog dorthin. Ihr Schwiegervater Migāra war zunächst ein Anhänger der Nigaṇṭhas (Jainas) und stand Visākhās buddhistischem Glauben ablehnend gegenüber. Es kam zu Konflikten, doch Visākhā konnte durch ihre Weisheit und Standhaftigkeit ihren Schwiegervater überzeugen. Nachdem Migāra eine Lehrrede des Buddha gehört hatte, wurde er ebenfalls Sotāpanna. Aus Dankbarkeit bezeichnete er Visākhā fortan als seine „Mutter“, weshalb sie den Beinamen Migāramātā („Migāras Mutter“) erhielt. Visākhā hatte ein langes Leben, gebar zehn Söhne und zehn Töchter, und erlebte zahlreiche Enkel und Urenkel. Sie starb im Alter von 120 Jahren.
Rolle und Bedeutung: Visākhā gilt neben Anāthapiṇḍika als die wichtigste Förderin des Buddha und seiner Saṅgha. Der Buddha selbst bezeichnete sie als die Vorderste (Etadagga) unter allen weiblichen Laienanhängern in Bezug auf Großzügigkeit (Dāyikānaṃ) (AN 1.260). Ihre Freigebigkeit war legendär. Sie versorgte täglich eine große Anzahl von Mönchen (deren symbolisch zu verstehenden Anzahl zwischen 500 und 2000 schwankt) in ihrem Haus mit Speisen. Sie besuchte regelmäßig das Kloster, hörte die Lehrreden und kümmerte sich um die Bedürfnisse der Mönche und Nonnen. Ihr größtes Werk war die Errichtung des prächtigen Klosters im Pubbārāma (Östlicher Park) bei Sāvatthi, das als Migāramātupāsāda („Palast der Migāramātā“) bekannt wurde. Sie finanzierte den Bau durch den Verkauf eines äußerst kostbaren Schmuckstücks (Mahālatāpasādhana), das sie zur Hochzeit erhalten hatte. Dieses Kloster wurde neben dem Jetavana zu einem der Hauptaufenthaltsorte des Buddha in Sāvatthi. Visākhā erbat und erhielt vom Buddha acht besondere Gaben (Vara) oder Privilegien, die ihr erlaubten, die Saṅgha auf spezifische Weise lebenslang zu unterstützen: Sie durfte Regenroben spenden, Essen für ankommende, abreisende und kranke Mönche sowie deren Pfleger bereitstellen, Medizin für Kranke stiften, einen ständigen Vorrat an Reisbrei unterhalten und Badetücher für die Nonnen zur Verfügung stellen. Visākhā verkörpert das Ideal der großzügigen, weisen und engagierten Laienanhängerin, deren Unterstützung essentiell für das Gedeihen der buddhistischen Gemeinschaft war.
Sutta-Referenzen: Visākhās Großzügigkeit und ihre Beziehung zum Buddha werden in mehreren Texten gewürdigt.
- AN 1.260 (Sattamavagga): Ernennung zur Vordersten unter den weiblichen Gebenden (Dāyikānaṃ).
- Ud 8.8 (Visākhā Sutta): Ein bewegendes Gespräch zwischen Visākhā und dem Buddha nach dem Tod ihres geliebten Enkels. Der Buddha erklärt ihr, dass Anhaftung an Geliebtes zu Leiden führt („Wer Hundert Liebes hat, hat hundert Leiden… Wer nichts Liebes hat, hat kein Leiden“).
- Vinaya Mahāvagga VIII.15: Enthält den Bericht über die acht Gaben, die Visākhā vom Buddha erbat.
Anāthapiṇḍika – Größter männlicher Förderer, Stifter von Jetavana
Biografie: Anāthapiṇḍika, dessen Geburtsname Sudatta war, war ein äußerst wohlhabender Kaufmann und Bankier aus Sāvatthi, der Hauptstadt des Königreichs Kosala. Den Beinamen Anāthapiṇḍika, der „Speiser der Schutzlosen“ oder „Versorger der Armen“ bedeutet, erhielt er aufgrund seiner außergewöhnlichen Großzügigkeit, die er schon vor seiner Begegnung mit dem Buddha praktizierte. Er war verheiratet mit Puññalakkhanā und hatte mehrere Kinder.
Rolle und Bedeutung: Anāthapiṇḍika traf den Buddha zum ersten Mal in Rājagaha, als er dort geschäftlich unterwegs war und seinen Schwager besuchte, der bereits ein Anhänger des Buddha war. Begeistert von der Nachricht, dass ein Erleuchteter in der Welt erschienen war, suchte er den Buddha auf. Nach einer Unterweisung über die Vier Edlen Wahrheiten erreichte er die erste Stufe der Heiligkeit, den Stromeintritt (Sotāpatti). Er lud den Buddha und seine Mönche zum Essen ein und bat den Buddha, die nächste Regenzeit in seiner Heimatstadt Sāvatthi zu verbringen, wozu er ein geeignetes Kloster stiften wollte.
Zurück in Sāvatthi fand er einen geeigneten Park, den Jetavana („Hain des Prinzen Jeta“), der jedoch Prinz Jeta gehörte. Der Prinz war zunächst nicht bereit zu verkaufen und nannte scherzhaft einen exorbitanten Preis: Anāthapiṇḍika müsse den gesamten Boden des Parks mit Goldmünzen bedecken. Zu Jetas Erstaunen nahm Anāthapiṇḍika die Bedingung an und begann, den Park mit Goldstücken auszulegen, die er auf Karren herbeischaffen ließ. Beeindruckt von dieser Entschlossenheit und um selbst am Verdienst teilzuhaben, erklärte Prinz Jeta, dass der noch unbedeckte Bereich am Tor und die Bäume sein Geschenk seien. Er stiftete auch das Eingangstor und Baumaterial. Anāthapiṇḍika ließ daraufhin auf dem Gelände ein prächtiges Kloster mit zahlreichen Gebäuden errichten. Dieses Jetavana-Kloster wurde zu einem der wichtigsten Zentren des frühen Buddhismus; der Buddha verbrachte dort 19 Regenzeitklausuren, mehr als an jedem anderen Ort.
Anāthapiṇḍika wurde vom Buddha zusammen mit Visākhā zum wichtigsten männlichen Laienförderer ernannt und als der Vorderste (Etadagga) unter den männlichen Gebenden (Dāyakānaṃ) bezeichnet (AN 1.249). Er unterstützte die Saṅgha unermüdlich mit Almosen, Medizin und anderen Notwendigkeiten und besuchte den Buddha regelmäßig, wenn dieser in Sāvatthi weilte. Auch als er später durch eine Flut einen Großteil seines Vermögens verlor, setzte er seine Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten fort und erlangte später durch die Hilfe eines Deva seinen Reichtum zurück. Auf dem Sterbebett erhielt er eine tiefgründige Unterweisung über Nicht-Anhaften von Sāriputta und Ānanda (MN 143). Nach seinem Tod wurde er als Deva im Tusita-Himmel wiedergeboren. Anāthapiṇḍika verkörpert das Ideal des großzügigen und weisen Laienanhängers, dessen Unterstützung die materielle Grundlage für die Verbreitung des Dhamma sicherte.
Sutta-Referenzen: Seine Großzügigkeit und seine Beziehung zum Buddha sind Thema vieler Texte.
- AN 1.249 (Chaṭṭhavagga): Ernennung zum Vordersten unter den männlichen Gebenden (Dāyakānaṃ).
- MN 143 (Anāthapiṇḍikovāda Sutta): Die Lehrrede, die Sāriputta ihm am Sterbebett hielt.
- SN 10.8 (Sudatta Sutta): Bericht über seine erste Begegnung mit dem Buddha und seine Bekehrung.
- AN 9.20 (Velāma Sutta): Der Buddha erwähnt Anāthapiṇḍikas Großzügigkeit im Vergleich zu anderen großen Spenden.
- Vinaya Cullavagga VI: Detaillierte Beschreibung des Kaufs des Jetavana-Hains.
- Jātakas und Dhammapada-Kommentar: Enthalten zahlreiche Geschichten über seine Großzügigkeit und seine Interaktionen mit dem Buddha und den Mönchen (z.B. die Geschichte von Kāḷakaṇṇī).
Citta der Hausvater – Vorbildlicher Laie
Biografie: Citta war ein wohlhabender Hausvater (Gahapati) und Schatzmeister aus der Stadt Macchikāsaṇḍa im Land Magadha. Sein Name, der „bunt“ oder „vielfältig“ bedeutet, soll daher rühren, dass bei seiner Geburt die ganze Stadt knietief mit bunten Blumen bedeckt war. Er wurde ein Anhänger des Buddha, nachdem er den Ehrwürdigen Mahānāma, einen der ersten fünf Schüler, getroffen hatte. Beeindruckt von Mahānāmas Gelassenheit, lud Citta ihn in seinen Mangohain (Ambātakārāma) ein, erbaute dort ein Kloster für ihn und versorgte ihn. Mahānāma lehrte ihn den Dhamma, insbesondere über die sechs Sinnesgrundlagen (Saḷāyatana), woraufhin Citta die dritte Stufe der Heiligkeit, die Nichtwiederkehr (Anāgāmī), erreichte.
Rolle und Bedeutung: Citta zeichnete sich nicht nur durch seine Großzügigkeit gegenüber der Saṅgha aus – viele Mönche besuchten sein Kloster und genossen seine Gastfreundschaft –, sondern vor allem durch sein tiefes Verständnis des Dhamma und seine außergewöhnliche Fähigkeit, diesen zu lehren. Der Buddha selbst ernannte ihn zum Vordersten (Etadagga) unter den Laienanhängern, die den Dhamma verkünden (Dhammakathikānaṃ) (AN 1.250). Die ihm gewidmete Sammlung im Saṃyutta Nikāya (SN 41, Citta Saṃyutta) belegt eindrucksvoll seine Lehrkompetenz. Dort führt er tiefgründige Gespräche mit verschiedenen angesehenen Mönchen wie Isidatta, Mahaka, Kāmabhū und Godatta über komplexe Themen wie die „Vielfalt der Elemente“ (Dhātu-Nānatta), die Entstehung der Persönlichkeitsansicht (Sakkāya-Diṭṭhi) und verschiedene meditative Zustände. Er widerlegte auch die Ansichten von Anhängern anderer Schulen wie Nigaṇṭha Nātaputta (Mahāvīra). Seine Fragen und Antworten zeugen von einer Weisheit, die der von erfahrenen Mönchen ebenbürtig war.
Obwohl er ein Anāgāmī war und somit noch nicht die volle Arahatschaft erreicht hatte, besaß er bereits die vier analytischen Wissen (Paṭisambhidā). Selbst auf dem Sterbebett unterwies er noch seine Verwandten und anwesende Devas im Dhamma und ermahnte sie, Vertrauen in die Drei Juwelen zu entwickeln und Großzügigkeit zu praktizieren. Citta ist somit das herausragende Beispiel eines Laien, der nicht nur materiell unterstützte, sondern aktiv am Diskurs über den Dhamma teilnahm und diesen meisterhaft lehren konnte.
Sutta-Referenzen: Seine Lehrfähigkeit und Weisheit stehen im Mittelpunkt der ihm gewidmeten Texte.
- AN 1.250 (Chaṭṭhavagga): Ernennung zum Vordersten unter den Laien, die den Dhamma lehren (Dhammakathikānaṃ).
- SN 41 (Citta Saṃyutta): Eine Sammlung von zehn Suttas, die seine Gespräche mit Mönchen und seine eigenen Lehrdarlegungen enthalten. Beispiele:
- SN 41.8: Gespräch mit Nigaṇṭha Nātaputta über Jhāna ohne Vitakka und Vicāra.
- SN 41.2 & 41.3: Gespräche mit Isidatta über die Vielfalt der Elemente und Persönlichkeitsansicht.
- SN 41.4: Begegnung mit Mahaka und dessen Wunder.
- SN 41.6: Gespräch mit Kāmabhū über verschiedene Arten von Geistesformationen (Saṅkhāra).
- SN 41.7: Gespräch mit Godatta über die Arten der Geistesbefreiung.
- SN 41.10: Seine letzte Unterweisung auf dem Sterbebett an Verwandte und Devas.
Hatthaka von Āḷavī – Organisator & spiritueller Laie
Biografie: Hatthaka stammte aus Āḷavī. Sein Name könnte mit dem Wort Hasta (Hand) zusammenhängen, doch die genaue Herkunft ist unklar. In späterer Überlieferung wird eine Verbindung zum Yakṣa Āḷavaka angenommen, bei der der Buddha ein Kind rettet – dies ist aber nicht eindeutig Hatthaka zuzuordnen.
Rolle und Bedeutung: Hatthaka war ein weiterer herausragender männlicher Laienanhänger des Buddha, bekannt für seine Fähigkeit, Menschen für den Dhamma zu gewinnen und eine Gemeinschaft um sich zu sammeln. Der Buddha ernannte ihn zum Vordersten (Etadagga) unter den Laien, die eine Anhängerschaft durch die „vier Grundlagen des Mitgefühls“ oder „vier Arten der Zusammenführung“ (Catu Saṅgahavatthu) gewinnen konnten (AN 1.251). Diese vier Grundlagen sind: Geben (Dāna), freundliche Rede (Piyavacana), hilfreiches Handeln (Atthacariyā) und Gleichbehandlung/Gemeinschaftlichkeit (Samānattatā). Hatthaka erklärte dem Buddha selbst, wie er diese Prinzipien anwandte, um seine große Anhängerschaft (angeblich 500 Laien, die ihn stets begleiteten) zu gewinnen und zu halten.
Neben dieser organisatorischen Fähigkeit wurde Hatthaka vom Buddha auch für seine tiefen spirituellen Qualitäten gelobt. Der Buddha beschrieb ihn als jemanden, der acht „erstaunliche und erstaunenswerte“ Eigenschaften besaß: Vertrauen (Saddhā), Tugend (Sīla), Gewissenhaftigkeit (Hiri), Furcht vor Tadel (Ottappa), Gelehrsamkeit (Bahussuta), Großzügigkeit (Cāga), Weisheit (Paññā) und Bescheidenheit (Appicchatā). Die letzte Eigenschaft, Bescheidenheit, fügte der Buddha hinzu, nachdem ein Mönch berichtete, dass Hatthaka nicht wollte, dass seine guten Eigenschaften öffentlich bekannt werden. Hatthaka erreichte die hohe spirituelle Stufe des Nichtwiederkehrers (Anāgāmī) und wurde nach seinem Tod in den Reinen Gefilden (Aviha-Himmel) wiedergeboren. Als Deva besuchte er den Buddha, war aber zunächst von dessen Ausstrahlung überwältigt. Er berichtete, dass er auch als Deva von anderen Göttern um Dhamma-Unterweisungen gebeten wurde und dass er mit drei Bedauern gestorben sei: den Buddha nicht genug gesehen, den Dhamma nicht genug gehört und der Saṅgha nicht genug gedient zu haben. Hatthaka ist somit ein Vorbild für einen engagierten, organisierten und spirituell tief verankerten Laienanhänger.
Sutta-Referenzen: Seine Qualitäten und Begegnungen sind im Aṅguttara Nikāya festgehalten.
- AN 1.251 (Chaṭṭhavagga): Ernennung zum Vordersten unter den Laien, die mittels der vier Grundlagen der Zusammenführung eine Anhängerschaft sammeln (Catūhi Saṅgahavatthūhi Parisaṃ Saṅgaṇhantānaṃ).
- AN 8.23 (Hatthaka Sutta 1): Der Buddha preist die sieben erstaunlichen Qualitäten Hatthakas (Vertrauen, Tugend, Hiri, Ottappa, Gelehrsamkeit, Großzügigkeit, Weisheit). Als ein Mönch Hatthaka davon berichtet und dieser bescheiden reagiert, fügt der Buddha Bescheidenheit als achte Qualität hinzu.
- AN 8.24 (Hatthaka Sutta 2): Hatthaka erklärt dem Buddha, wie er seine große Anhängerschaft durch die vier Grundlagen der Zusammenführung gewonnen hat. Der Buddha bestätigt dies und lobt erneut seine acht Qualitäten.
- AN 3.35 (Hatthaka Sutta): Ein Gespräch zwischen dem Buddha und Hatthaka über das Wohlbefinden im Schlaf. Der Buddha erklärt, dass wahres Wohlbefinden nicht von äußeren Umständen (wie einem bequemen Bett), sondern von der inneren Befreiung von Gier, Hass und Verblendung abhängt.
Sujātā – Spenderin des Milchreises vor Buddhas Erleuchtung
Biografie: Sujātā war die Tochter eines wohlhabenden Landbesitzers namens Senānī aus dem Dorf Senānīgāma nahe Uruvelā, dem Ort, an dem der Bodhisatta seine jahrelangen asketischen Übungen praktizierte.
Rolle und Bedeutung: Sujātās entscheidende Rolle in der Lebensgeschichte des Buddha liegt in ihrer Spende von Milchreis (Kheer oder Pāyāsa) an den Bodhisatta kurz vor dessen Erleuchtung. Nachdem der Bodhisatta die extremen Askeseübungen als fruchtlos erkannt hatte und beschloss, wieder feste Nahrung zu sich zu nehmen, um seinen Körper zu stärken, saß er geschwächt unter einem Banyanbaum. Sujātā hatte dem Baumgeist dieses Baumes eine Opfergabe versprochen, sollte sie einen Sohn gebären. Als ihr Wunsch in Erfüllung ging, bereitete sie einen besonders nahrhaften Milchreis zu. Ihre Dienerin Puṇṇā, die den Platz vorbereiten sollte, sah den meditierenden Bodhisatta unter dem Baum sitzen und hielt ihn in seiner Ausstrahlung für den Baumgeist selbst. Freudig berichtete sie dies Sujātā, die daraufhin mit dem Milchreis in einer goldenen Schale zum Baum kam und ihn dem Bodhisatta ehrfürchtig darbrachte.
Diese Mahlzeit war die erste feste Nahrung, die der Bodhisatta nach langer Zeit zu sich nahm. Sie gab ihm die nötige körperliche Kraft, um in der folgenden Nacht unter dem Bodhi-Baum die letzte Phase seiner Meditation aufzunehmen und die volle Erleuchtung zu erlangen. Die goldene Schale soll er nach dem Essen in den Fluss Nerañjarā geworfen haben, wo sie gegen den Strom schwamm – ein Zeichen für seine bevorstehende Buddhaschaft.
Sujātā wird im Aṅguttara Nikāya (AN 1.264) vom Buddha als die Vorderste (Etadagga) unter den weiblichen Laienanhängern genannt, die als Erste Zuflucht nahmen (Paṭhamaṃ Saraṇaṃ Gacchantīnaṃ). Dies bezieht sich möglicherweise auf eine frühere Begegnung oder darauf, dass ihre Gabe symbolisch für die erste Unterstützung des zukünftigen Buddha nach Aufgabe der Askese steht. Ihre Tat wird als essentieller Beitrag auf dem Weg zur Erleuchtung gewürdigt.
Sutta-Referenzen: Die Geschichte von Sujātās Milchreisspende ist ein fester Bestandteil der traditionellen Buddha-Biografie, findet sich aber nicht explizit in den ältesten Suttas des Dīgha oder Majjhima Nikāya, sondern eher in späteren kanonischen Texten und Kommentaren.
- AN 1.264 (Sattamavagga): Ernennung zur Vordersten unter den Laiinnen, die als Erste Zuflucht nahmen (Paṭhamaṃ Saraṇaṃ Gacchantīnaṃ).
- Jātaka-Einleitung (Nidānakathā): Enthält eine ausführliche Darstellung der Geschichte von Sujātās Opfergabe.
- Vinaya Mahāvagga I: Beschreibt die Ereignisse nach der Erleuchtung, erwähnt aber die Milchreisspende möglicherweise im Kontext der vorherigen Ereignisse.
- Udāna 1.1–3: Beschreibt die erste Woche nach der Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum, impliziert die vorherige Stärkung.
- Kommentare (z.B. zum Dhammapada, Buddhavaṃsa): Enthalten ebenfalls Versionen der Geschichte.
Weiter in diesem Bereich mit …
Gegenspieler & spirituelle Prüfungen
Der Weg zur Befreiung ist nicht ohne Hindernisse. Begegne hier den Gegenspielern und Herausforderungen, denen sich der Buddha und seine Anhänger stellen mussten. Lerne Devadatta kennen, den ehrgeizigen Cousin, der versuchte, die Gemeinschaft zu spalten (sanghabheda). Erforsche die Bedeutung von Māra, der Personifikation von Begierde und Tod. Und sieh, wie selbst Figuren wie der Mörder Aṅgulimāla durch die Kraft des Dhamma transformiert werden konnten.