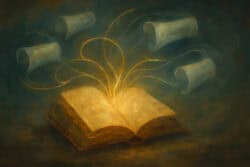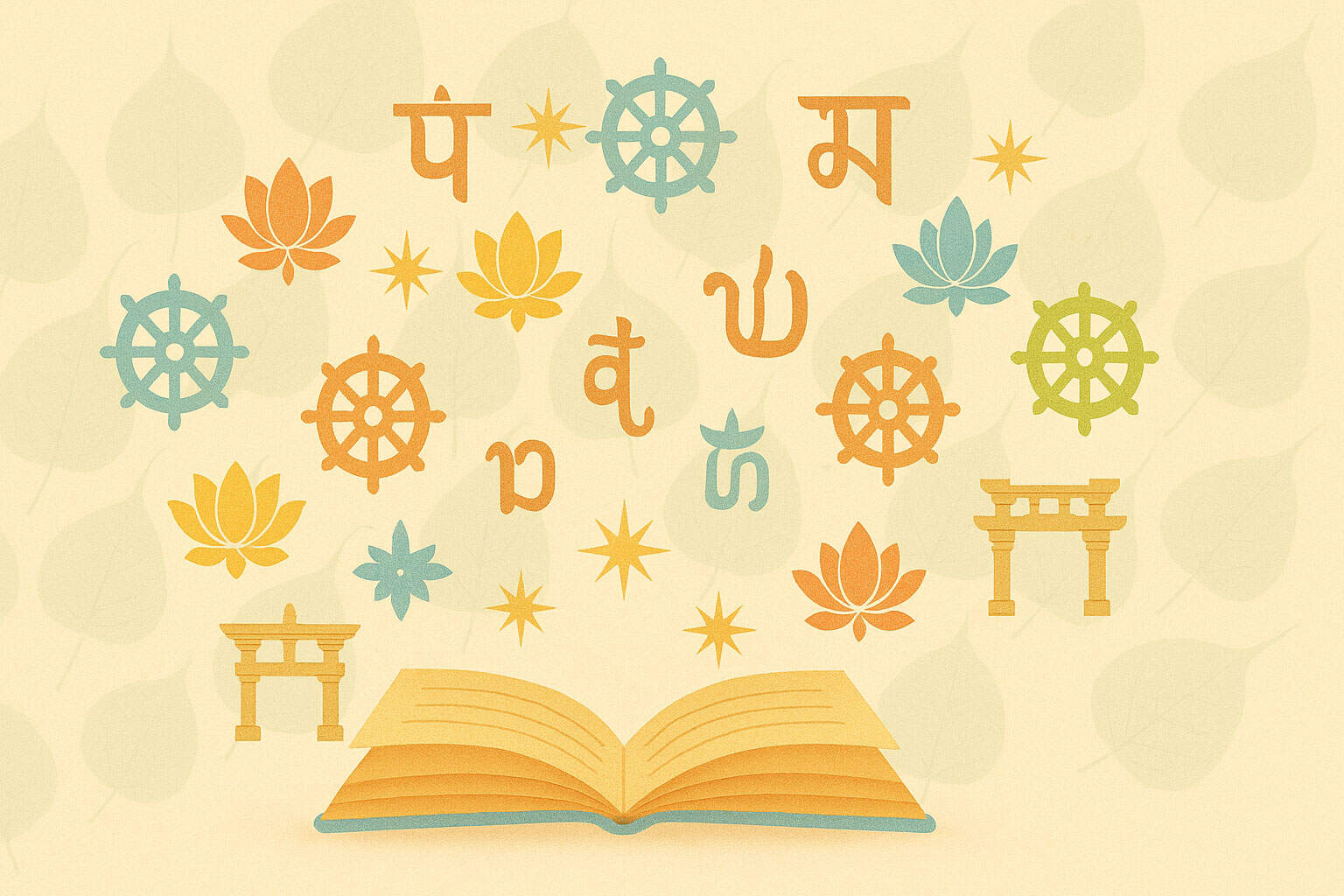
Fragen und Antworten zum Pāli-Kanon
Ein umfassender Leitfaden zu Ursprung, Struktur und Inhalt der heiligen Schriften des Theravāda-Buddhismus
Der Pāli-Kanon, auch bekannt als Tipiṭaka oder „Drei Körbe“, bildet das Fundament des Theravāda-Buddhismus und gilt als die älteste vollständig überlieferte Sammlung der Lehren des Buddha Siddhattha Gotama. Dieses umfangreiche Kompendium, das über Jahrhunderte mündlich weitergegeben und schließlich in Sri Lanka niedergeschrieben wurde, ist nicht nur eine religiöse Schrift, sondern auch ein unschätzbares historisches Dokument. Es gewährt dir tiefe Einblicke in die philosophischen, ethischen und meditativen Grundlagen des frühen Buddhismus. Dieser Leitfaden beantwortet die häufigsten Fragen zu seiner Entstehung, seiner Sprache, seiner komplexen Struktur und den Inhalten seiner drei Hauptteile: dem Vinaya Piṭaka (Ordensregeln), dem Sutta Piṭaka (Lehrreden) und dem Abhidhamma Piṭaka (Höhere Lehre). Entdecke die faszinierende Welt dieser alten Texte und ihre bis heute andauernde Relevanz.
Inhaltsverzeichnis
 Der Pāli-Kanon: Ursprung und Struktur
Der Pāli-Kanon: Ursprung und Struktur
Was ist der Pāli-Kanon?
Der Pāli-Kanon ist die Standard-Sammlung der heiligen Schriften in der Theravāda-buddhistischen Tradition. Er gilt als die älteste zusammenhängend überlieferte Sammlung von Lehrreden des Buddha Siddhattha Gotama und seiner Hauptschüler. Der Name „Pāli-Kanon“ dient zur Unterscheidung von anderen buddhistischen Kanons, die beispielsweise in Sanskrit oder Chinesisch verfasst wurden. Obwohl er traditionell als Buddhavacana, das „Wort des Buddha“, bezeichnet wird, enthält er auch Lehren und Erläuterungen von dessen Schülern.
In welcher Sprache ist der Pāli-Kanon verfasst?
Der Pāli-Kanon ist in Pāli verfasst, einer mittelindischen Prākrit-Sprache. Pāli war wahrscheinlich keine gesprochene Alltagssprache im Sinne eines Dialekts einer bestimmten Region, sondern eher eine Lingua franca oder eine literarische Sprache, die für die Aufzeichnung religiöser Texte verwendet wurde. Obwohl die Theravāda-Tradition Pāli oft mit Māgadhī, der Sprache des Königreichs Magadha, die der Buddha gesprochen haben soll, gleichsetzt, deuten linguistische Forschungen darauf hin, dass Pāli enger mit westindischen Prākrits verwandt ist. Es wird vermutet, dass die Lehren Buddhas ursprünglich in einer ostindischen Sprache aufgezeichnet und später, möglicherweise vor der Aśoka-Zeit, in die westindische Vorläufersprache des Pāli transponiert wurden.
Wie wurde der Pāli-Kanon ursprünglich überliefert?
Vor seiner schriftlichen Niederlegung wurde der Pāli-Kanon über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr., ausschließlich mündlich überliefert. Diese mündliche Tradierung wurde durch regelmäßige gemeinschaftliche Rezitationen gesichert, bei denen Mönche die Texte gemeinsam aufsagten und so deren genaue Weitergabe gewährleisteten. Zur Lebenszeit Buddhas war es in Indien unüblich, religiöse Texte schriftlich niederzulegen; das Auswendiglernen und Wiederholen war die gängige Methode.
Welche Rolle spielten die buddhistischen Konzilien bei der Entstehung des Kanons?
Buddhistische Konzilien dienten der Beratung, Abklärung und Sicherung der authentischen Lehren Buddhas sowie ihrer wortgetreuen Weitergabe und Fassung in kanonischer Form. Das Erste Konzil, das der Überlieferung nach kurz nach Buddhas Tod in Rājagaha stattfand, war entscheidend für die erste Zusammenstellung der Lehren. Hier sollen der Korb der Lehrreden (Sutta Piṭaka), rezitiert von Ānanda, und der Korb der Ordensregeln (Vinaya Piṭaka), rezitiert von Upāli, festgelegt worden sein. Dies legte den Grundstein für den späteren Kanon. Das Zweite Konzil in Vesālī, etwa 110 Jahre später, befasste sich mit Kontroversen um die Ordensdisziplin. Diese führten zur Spaltung des Saṅgha in die Mahāsaṅghikas und die Theras (Sanskrit: Sthaviras; Vorläufer des Theravāda), was als ein früher Schritt in Richtung der späteren Mahāyāna-Bewegung gesehen wird. Das Dritte Konzil in Pāṭaliputta, unter der Schirmherrschaft von König Aśoka (ca. 250 v. Chr.), hatte zum Ziel, den Saṅgha von abweichenden Ansichten zu „säubern“ und die Lehre zu konsolidieren. Auf diesem Konzil sollen letzte Ergänzungen zum Kanon vorgenommen worden sein, insbesondere die Aufnahme des Abhidhamma Piṭaka bzw. die Festlegung des Kathāvatthu aus dem Abhidhamma.
Wann und wo wurde der Pāli-Kanon erstmals schriftlich niedergelegt?
Der Pāli-Kanon wurde erstmals in Sri Lanka im Āluvihāra-Tempel in Matale schriftlich niedergelegt. Dies geschah während der Regentschaft von König Vaṭṭagāmaṇī Abhaya, nicht früher als zwischen 29 und 17 v. Chr. Zuvor waren die Texte auf Palmblättern oder dünnen Holzstücken geschrieben und in Körben aufbewahrt worden, was zur Bezeichnung Tipiṭaka („Drei Körbe“) führte.
Wie wurde der Kanon nach seiner Niederschrift weiter tradiert und verbreitet?
Auch nach der ersten schriftlichen Fixierung blieb die handschriftliche Überlieferung auf Palmblättern in den Theravāda-Ländern wie Ceylon (Sri Lanka), Burma (Myanmar), Thailand, Kambodscha und Laos die Norm. Diese Manuskripte mussten immer wieder sorgfältig abgeschrieben werden, um ihre Erhaltung zu sichern. Spätere Konzile, wie das fünfte Konzil 1871 in Mandalay (Burma), bei dem der Kanon auf 729 Marmortafeln eingemeißelt wurde, und das sechste Konzil 1954–56 in Rangun (Burma), dienten der Textbereinigung und Festlegung einer autoritativen Version. Gedruckt wurde der Pāli-Kanon erstmals im späten 19. Jahrhundert, angeregt durch das Interesse europäischer Forscher.
Ist der Pāli-Kanon ein statisches, vom Buddha diktiertes Werk?
Nein, der Pāli-Kanon ist kein monolithisches, direkt vom Buddha diktiertes Werk. Er ist vielmehr das Ergebnis eines jahrhundertelangen Prozesses der Sammlung, mündlichen Überlieferung, redaktionellen Bearbeitung auf Konzilien und schließlich der schriftlichen Fixierung. Dieser Prozess schloss auch spätere Ergänzungen und Interpretationen durch die Schülerschaft mit ein. Beispielsweise wird der Abhidhamma Piṭaka als eine spätere Hinzufügung betrachtet, und selbst innerhalb des Sutta Piṭaka und Vinaya Piṭaka erkennen Gelehrte verschiedene Textschichten, die auf eine allmähliche Entwicklung hindeuten. Die traditionelle Bezeichnung als „Wort des Buddha“ drückt den Glauben an die Authentizität des Kerns der Lehren aus, schließt aber eine historische Entwicklung nicht aus.
Welche Bedeutung hatte die materielle Form der Überlieferung (z. B. Palmblätter) für den Kanon?
Die materielle Form der Überlieferung, primär auf Palmblattmanuskripten, hatte erhebliche Auswirkungen. Palmblätter sind in tropischen Klimazonen anfällig für Verfall und Zerstörung durch Insekten oder Feuchtigkeit. Dies machte das wiederholte und sorgfältige Abschreiben der Texte notwendig, um ihre Erhaltung über Jahrhunderte zu gewährleisten. Dieser manuelle Kopiervorgang barg jedoch auch die Gefahr von Schreibfehlern oder dem Einfließen lokaler Varianten. Die physische Begrenztheit der Palmblätter (schmale Streifen) könnte auch die Struktur und Länge einiger Texte beeinflusst haben. Erst die Erfindung des Buchdrucks und die Drucklegung des Kanons ab dem späten 19. Jahrhundert ermöglichten eine breitere Standardisierung und Verbreitung der Texte und reduzierten die Risiken der manuellen Überlieferung.
Ist der Pāli-Kanon der einzig wahre buddhistische Kanon?
Die Behauptung, der Pāli-Kanon sei der ursprüngliche oder einzig richtige buddhistische Kanon, ist ein Irrtum, der teilweise auf frühe europäische Indologen zurückgeht. Es gab und gibt auch andere buddhistische Kanons, die in anderen Sprachen wie Sanskrit (z. B. der Sarvāstivāda-Schule) oder Chinesisch und Tibetisch (die umfangreiche Sammlungen von Mahāyāna-Sūtras und anderen Texten enthalten) überliefert sind. Viele dieser nicht-pālischen Kanons sind jedoch nur fragmentarisch oder in Übersetzungen erhalten, während der Pāli-Kanon der Theravāda-Schule der einzige ist, der vollständig in einer mittelindischen Sprache überliefert wurde. Dies unterstreicht seine immense historische Bedeutung für das Verständnis des frühen Buddhismus, relativiert aber seine Exklusivität im Gesamtpanorama der buddhistischen Literaturen.
Was bedeutet Tipiṭaka und wie ist der Pāli-Kanon aufgebaut?
Tipiṭaka (Pāli) oder Tripiṭaka (Sanskrit) bedeutet wörtlich „Drei Körbe“. Dieser Name bezieht sich auf die traditionelle Aufbewahrung der Palmblattmanuskripte in drei verschiedenen Körben und symbolisiert die dreifache Gliederung des Pāli-Kanons. Diese drei Hauptteile oder „Körbe“ sind:
- Vinaya Piṭaka: Der Korb der Ordensdisziplin.
- Sutta Piṭaka: Der Korb der Lehrreden.
- Abhidhamma Piṭaka: Der Korb der Höheren Lehre oder Philosophie.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über diese Struktur:
| Piṭaka (Korb) | Hauptinhalt/Bedeutung | Wichtige Unterteilungen/Beispiele |
|---|---|---|
| Vinaya Piṭaka (Korb der Ordensdisziplin) | Enthält die Regeln und Vorschriften für das monastische Leben der buddhistischen Mönche (Bhikkhu) und Nonnen (Bhikkhunī), Geschichten über die Entstehung dieser Regeln sowie Richtlinien für die Organisation und das Zusammenleben der Ordensgemeinschaft (Saṅgha). | Suttavibhaṅga (Analyse der Regeln, unterteilt in Mahāvibhaṅga für Mönche und Bhikkhunī-Vibhaṅga für Nonnen, enthält das Pātimokkha), Khandhaka (unterteilt in Mahāvagga und Cullavagga, behandelt u. a. Ordination, Zeremonien, Geschichte des Ordens), Parivāra (Zusammenfassungen und Analysen der Regeln). |
| Sutta Piṭaka (Korb der Lehrreden) | Umfasst die Diskurse und Lehrreden, die dem Buddha selbst oder seinen direkten Hauptschülern zugeschrieben werden. Er behandelt eine breite Palette von Themen, darunter ethische Prinzipien, meditative Praktiken, philosophische Einsichten und Erzählungen aus dem Leben des Buddha und seiner Anhänger. | Unterteilt in fünf Nikāyas (Sammlungen): Dīgha Nikāya (Längere Lehrreden), Majjhima Nikāya (Mittlere Lehrreden), Saṃyutta Nikāya (Gruppierte Lehrreden), Aṅguttara Nikāya (Angereihte Lehrreden), Khuddaka Nikāya (Kürzere Texte, enthält u. a. Dhammapada, Sutta Nipāta, Jātaka, Theragāthā, Therīgāthā). |
| Abhidhamma Piṭaka (Korb der Höheren Lehre) | Stellt eine systematische, philosophische und psychologische Analyse der im Sutta Piṭaka enthaltenen Lehren dar. Er untersucht die Natur der Realität, des Bewusstseins und der mentalen Prozesse in Form von abstrakten Kategorien und Definitionen. | Besteht aus sieben Büchern: Dhammasaṅgaṇī (Aufzählung der Daseinsfaktoren), Vibhaṅga (Buch der Analyse), Dhātukathā (Diskurs über die Elemente), Puggalapaññatti (Beschreibung der Persönlichkeiten), Kathāvatthu (Streitpunkte), Yamaka (Buch der Paare), Paṭṭhāna (Buch der Bedingungszusammenhänge). |
Diese dreiteilige Struktur ist fundamental für das Verständnis des Pāli-Kanons und spiegelt die verschiedenen Aspekte der buddhistischen Lehre und Praxis wider: Disziplin, Lehre und tiefere Analyse.
 Der Vinaya Piṭaka: Die Ordensdisziplin
Der Vinaya Piṭaka: Die Ordensdisziplin
Was ist der Vinaya Piṭaka und welchen Zweck erfüllt er?
Der Vinaya Piṭaka, wörtlich der „Korb der Disziplin“, ist der erste der drei Hauptteile des Pāli-Kanons. Er bildet die Grundlage für das buddhistische Mönchtum und enthält die detaillierten Ordensregeln für Mönche (Bhikkhu) und Nonnen (Bhikkhunī). Sein Zweck ist es, einen Rahmen für den Tagesablauf und das Verhalten der Ordinierten zu schaffen, der ein harmonisches Zusammenleben sowohl innerhalb der Klostergemeinschaft (Saṅgha) als auch zwischen dem Orden und der Laiengemeinschaft gewährleistet. Der Vinaya soll die Bedingungen für eine erfolgreiche spirituelle Praxis schaffen, indem er Ablenkungen reduziert und ethisches Verhalten fördert.
Was ist das Suttavibhaṅga?
Das Suttavibhaṅga ist der Kern des Vinaya Piṭaka und stellt das eigentliche monastische Regelwerk dar. Es enthält die detaillierten Regeln für Mönche und Nonnen sowie die jeweiligen Entstehungsgeschichten dieser Regeln, die oft auf spezifische Vorfälle in der frühen Ordensgemeinschaft zurückgehen. Es ist unterteilt in das Mahā-Vibhaṅga, das die Regeln für die Mönche behandelt, und das Bhikkhunī-Vibhaṅga, das die Regeln für die Nonnen darlegt. Innerhalb dieser Abschnitte werden Vergehen nach ihrer Schwere kategorisiert, wie z. B. Pārājika (Vergehen, die zum Ausschluss aus dem Orden führen) und Pācittiya (Vergehen, die eine Sühne erfordern).
Was ist das Pātimokkha und in welcher Beziehung steht es zum Suttavibhaṅga?
Das Pātimokkha ist ein Extrakt der grundlegenden Ordensregeln aus dem Suttavibhaṅga und dient als eine Art „Beichtformular“ oder Kodex, der von den Mönchen und Nonnen regelmäßig (alle zwei Wochen am Uposatha-Tag) in Gemeinschaft rezitiert wird. Obwohl es aus dem Suttavibhaṅga abgeleitet ist, wird das Pātimokkha selbst oft als ein separater Text betrachtet und ist formal kein direkter Bestandteil des Vinaya Piṭaka im Sinne eines der fünf Bücher, sondern vielmehr dessen Essenz für die rituelle Praxis.
Was sind die Khandhakas und welche Informationen enthalten sie?
Die Khandhakas, wörtlich „Gruppen“ oder „Abschnitte“, sind ein weiterer Hauptteil des Vinaya Piṭaka, der die Ordensregeln thematisch geordnet darlegt. Sie enthalten neben den Regeln auch viele narrative Elemente und gelten als wichtige historische Quelle für Informationen über die Entstehung und Entwicklung des buddhistischen Mönchs- und Nonnenordens sowie über die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse in Indien. Die Khandhakas sind unterteilt in:
- Mahāvagga („Große Gruppe“): Dieser Teil besteht aus zehn Abschnitten und behandelt Themen wie die Erleuchtung Buddhas, die Bekehrung der ersten Schüler, die Gründung des Mönchsordens, die Ordinationsprozeduren und den Erlass vieler grundlegender Vorschriften.
- Cullavagga („Kleine Gruppe“): Dieser Teil umfasst zwölf Abschnitte, von denen die ersten zehn als ursprünglicher Kern gelten. Er behandelt verschiedene Kategorien von Vergehen, organisatorische Angelegenheiten des Klosterlebens, Fragen zur Unterkunft, die erste Spaltung des Ordens (durch Devadatta), die Pflichten der Ordinierten, die Gründung des Nonnenordens und Berichte über die ersten beiden buddhistischen Konzile.
Was ist der Parivāra?
Der Parivāra, wörtlich „Begleitung“ oder „Gefolge“, ist der letzte und jüngste Teil des Vinaya Piṭaka. Er dient als eine Art Anhang oder Zusammenfassung und analysiert die Regeln des Vinaya aus verschiedenen Blickwinkeln, oft in Form von Fragen und Antworten oder Listen, die an den Stil des Abhidhamma Piṭaka erinnern. Er listet Begriffe aus dem Regelwerk nach verschiedenen Schemata auf und enthält teilweise achtsilbige Verse.
Welche Bedeutung wird dem Vinaya für die Erhaltung der Lehre Buddhas beigemessen?
Dem Vinaya wird eine fundamentale Bedeutung für die Erhaltung der Lehre Buddhas (Dhamma) beigemessen. Ein bekannter Grundsatz besagt: „Und würde auch die Lehre selber und gleicherweise der Abhidhamma vergessen werden – solange der Vinaya nicht verloren geht, bleibt die Lehre bestehen.“ Dies unterstreicht die Ansicht, dass die disziplinarische Struktur und die ethischen Richtlinien des Ordens die notwendige Grundlage für die Praxis, das Studium und die Weitergabe des Dhamma bilden. Der Buddha selbst bezeichnete die von ihm gegründete Religion als Dhamma-Vinaya – „die Lehre und Disziplin“, was die untrennbare Verbindung dieser beiden Aspekte hervorhebt.
Wie hat sich der Vinaya entwickelt? War er von Anfang an eine statische Gesetzessammlung?
Der Vinaya ist nicht als eine von Anfang an feststehende, statische Gesetzessammlung entstanden. Vielmehr entwickelte er sich dynamisch aus konkreten Situationen, Vorfällen und Bedürfnissen innerhalb der frühen buddhistischen Ordensgemeinschaft. Das Suttavibhaṅga enthält explizit die „Ursprungsgeschichten“ (Nidāna) vieler Regeln, die erläutern, welcher spezifische Anlass zur Formulierung einer bestimmten Regel führte. Dieser entstehungsgeschichtliche Aspekt zeigt einen pragmatischen Ansatz zur Regelsetzung, der auf Erfahrung und der Notwendigkeit basierte, das harmonische Zusammenleben und die spirituelle Integrität des Saṅgha zu wahren. Die Regeln wurden also oft reaktiv auf bestimmte Verhaltensweisen oder Probleme hin erlassen und im Laufe der Zeit ergänzt oder präzisiert.
Gibt es Unterschiede in den Vinaya-Regeln verschiedener buddhistischer Traditionen?
Ja, es gibt Unterschiede in den Vinaya-Regelwerken und der Anzahl der Regeln in verschiedenen buddhistischen Traditionen, auch wenn der Kern oft ähnlich bleibt. Die Theravāda-Tradition beispielsweise zählt 227 Regeln für Mönche (Bhikkhu) und 311 für Nonnen (Bhikkhunī). In der sino-japanischen Tradition, die oft auf dem Dharmaguptaka-Vinaya basiert, gelten etwa 250 Regeln für Mönche und 348 für Nonnen. Die tibeto-mongolische Tradition folgt dem Mūlasarvāstivāda-Vinaya mit 253 Regeln für Mönche und 364 für Nonnen. Diese Unterschiede deuten auf eine gewisse Anpassungsfähigkeit und regionale Entwicklung des Vinaya im Laufe der Jahrhunderte hin, bedingt durch unterschiedliche Interpretationen, kulturelle Kontexte oder spätere Ergänzungen in den jeweiligen Übertragungslinien.
 Der Sutta Piṭaka: Die Lehrreden des Buddha
Der Sutta Piṭaka: Die Lehrreden des Buddha
Was ist der Sutta Piṭaka und was bedeutet „Sutta“?
Der Sutta Piṭaka, wörtlich der „Korb der Lehrreden“, ist der zweite der drei Hauptteile des Pāli-Kanons. Er enthält die Diskurse oder Lehrreden (Suttas), die dem Buddha selbst oder einigen seiner erleuchteten Hauptschüler zugeschrieben werden. Das Wort Sutta (Sanskrit: Sūtra) bedeutet wörtlich „Faden“, was möglicherweise auf die Art und Weise hinweist, wie die Lehren aneinandergereiht oder als verbindende Richtschnur für die Praxis verstanden wurden. Der Sutta Piṭaka umfasst eine immense Bandbreite an Lehren, ethischen Richtlinien, meditativen Anleitungen und philosophischen Konzepten und gilt als die primäre Quelle für das Verständnis der ursprünglichen Lehren des Buddha. Es sind über 10.000 Suttas in dieser Sammlung enthalten.
Wie ist der Sutta Piṭaka unterteilt?
Der Sutta Piṭaka ist in fünf Hauptsammlungen unterteilt, die als Nikāyas bezeichnet werden:
- Dīgha Nikāya (DN): Die Sammlung der „Längeren Lehrreden“.
- Majjhima Nikāya (MN): Die Sammlung der „Mittleren Lehrreden“.
- Saṃyutta Nikāya (SN): Die Sammlung der „Gruppierten“ oder „Verbundenen Lehrreden“.
- Aṅguttara Nikāya (AN): Die Sammlung der „Angereihten“ oder „Numerischen Lehrreden“.
- Khuddaka Nikāya (KN): Die Sammlung der „Kürzeren Texte“ oder „Kleineren Sammlung“.
Diese Gliederung scheint einer bewussten pädagogischen Strategie zu folgen, die Lehren für unterschiedliche Lerntypen und Erinnerungsbedürfnisse zugänglich zu machen, was in einer primär mündlichen Überlieferungskultur von großer Bedeutung war.
Was charakterisiert den Dīgha Nikāya (DN)?
Der Dīgha Nikāya (DN) oder die „Sammlung der Längeren Lehrreden“ enthält 34 Suttas, die sich durch ihre beträchtliche Länge auszeichnen. Diese langen Diskurse behandeln eine Vielzahl von Themen in ausführlicher Weise. Zu den bekanntesten Suttas des DN gehören das Mahāsatipaṭṭhāna Sutta (Die Große Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit), das Mahānidāna Sutta (Die Große Lehrrede über die Ursachen, die das bedingte Entstehen erläutert), das Brahmajāla Sutta (Die Lehrrede vom Allumfassenden Netz der Ansichten, das verschiedene philosophische Spekulationen behandelt) und das Mahāparinibbāna Sutta (Die Große Lehrrede vom endgültigen Verlöschen des Buddha, die seine letzten Tage, Unterweisungen und sein Parinibbāna beschreibt).
Worum geht es im Majjhima Nikāya (MN)?
Der Majjhima Nikāya (MN) oder die „Sammlung der Mittleren Lehrreden“ umfasst 152 Suttas von mittlerer Länge. Diese Sammlung gilt als besonders reich an detaillierten Darlegungen der Kernlehren des Buddhismus und wird von vielen Gelehrten als eine der zuverlässigsten Quellen für die ursprünglichen Lehren des historischen Buddha angesehen. Der MN enthält eine große Vielfalt an Themen und Dialogen Buddhas mit Mönchen, Nonnen, Laienanhängern und Vertretern anderer philosophischer Schulen. Wichtige Suttas sind beispielsweise das Māluṅkyaputta Sutta (MN 63, über metaphysische Fragen und das Gleichnis vom vergifteten Pfeil), das Alagaddūpama Sutta (MN 22, mit dem Gleichnis vom Floß) und das Kakacūpama Sutta (MN 21, das Gleichnis von der Säge über radikale Gewaltlosigkeit).
Was ist das Besondere am Saṃyutta Nikāya (SN)?
Der Saṃyutta Nikāya (SN) oder die „Sammlung der Gruppierten Lehrreden“ enthält Tausende von kürzeren Suttas, die thematisch in 56 Gruppen (Saṃyuttas) geordnet sind. Das Besondere an dieser Sammlung ist, dass sie verwandte Diskurse zu spezifischen Themen oder Personen zusammenfasst. So gibt es beispielsweise Saṃyuttas, die sich mit den fünf Aggregaten, dem bedingten Entstehen, dem Edlen Achtfachen Pfad, verschiedenen Gottheiten (Devatā) oder wichtigen Schülern Buddhas befassen. Diese thematische Gliederung ermöglicht ein vertieftes Studium spezifischer Lehraspekte. Das Devatā-Saṃyutta enthält beispielsweise Verse, in denen Gottheiten dem Buddha Fragen stellen.
Wie sind die Lehrreden im Aṅguttara Nikāya (AN) organisiert?
Der Aṅguttara Nikāya (AN) oder die „Sammlung der Angereihten Lehrreden“ organisiert seine Tausenden von Suttas nach einem numerischen Prinzip. Die Suttas sind in elf Abschnitte (Nipātas) unterteilt, wobei jeder Abschnitt Lehrreden enthält, die sich auf eine bestimmte Anzahl von Lehrpunkten beziehen – beginnend mit Lehrreden über einen einzelnen Punkt (Einer-Nipāta) bis hin zu Lehrreden über elf Punkte (Elfer-Nipāta). Diese numerische Anordnung diente wahrscheinlich als mnemotechnische Hilfe für das Auswendiglernen und die Weitergabe der Lehren. Ein bekanntes Sutta aus dem AN ist das Kālāma Sutta (AN 3.65), das zum kritischen Denken auffordert.
Welche Art von Texten findet man im Khuddaka Nikāya (KN)?
Der Khuddaka Nikāya (KN), die „Sammlung der Kürzeren Texte“, ist die fünfte und heterogenste Sammlung des Sutta Piṭaka. Sie wird im nächsten Hauptabschnitt detailliert behandelt.
Sind die Suttas nur philosophische Abhandlungen?
Nein, die Suttas sind nicht nur rein philosophische oder dogmatische Abhandlungen. Viele von ihnen sind in narrativer oder dialogischer Form verfasst und betten die Lehren in konkrete Lebenssituationen und Interaktionen Buddhas (oder seiner Schüler) mit verschiedensten Menschen ein – darunter Könige, Bauern, Asketen anderer Schulen, Gottheiten und gewöhnliche Laienanhänger. Diese Darstellungsweise macht die Lehren lebendig, praktisch anwendbar und zeigt ihre Relevanz für unterschiedliche Lebenskontexte. Sie offenbaren oft auch die Persönlichkeit Buddhas – seine Sanftmut, sein Mitgefühl, seine Geduld und seine pädagogische Weisheit.
Welche Bedeutung haben die Suttas für das Verständnis des frühen Buddhismus?
Die Suttas des Pāli-Kanons gelten allgemein als die früheste und authentischste Aufzeichnung der Lehren des historischen Buddha Siddhattha Gotama. Sie sind daher von unschätzbarem Wert für das Verständnis des frühen Buddhismus, seiner Kernprinzipien, ethischen Richtlinien und meditativen Praktiken, bevor sich spätere scholastische Ausarbeitungen (wie im Abhidhamma Piṭaka) oder schulenspezifische Interpretationen und Erweiterungen (wie im Mahāyāna-Buddhismus) entwickelten. Ihre Betonung von persönlicher Erfahrung, Achtsamkeit und dem Weg zur Befreiung durch eigene Anstrengung bildet einen Kernaspekt, der den Buddhismus von vielen anderen zeitgenössischen indischen Traditionen unterschied.
 Der Khuddaka Nikāya: Die Sammlung kurzer Texte
Der Khuddaka Nikāya: Die Sammlung kurzer Texte
Was ist der Khuddaka Nikāya und was zeichnet ihn aus?
Der Khuddaka Nikāya (KN), wörtlich die „Sammlung der Kürzeren Texte“ oder die „Kleinere Sammlung“, ist die fünfte und letzte der fünf Hauptsammlungen (Nikāyas) des Sutta Piṭaka im Pāli-Kanon. Ihn zeichnet eine außerordentliche Vielfalt an literarischen Formen und Inhalten aus. Er ist eine Mischung aus Aphorismen, Liedern, Gedichten, Lehrreden, erbaulichen Geschichten, Märchen und Fabeln, die in traditionell 15 unabhängigen Büchern zusammengetragen wurden (die burmesische Tradition zählt 18 Bücher, indem sie drei weitere Texte einschließt). Diese Sammlung ergänzt die oft systematischeren und längeren Lehrreden der anderen vier Nikāyas und spielte eine wichtige Rolle bei der Bewahrung mündlicher Traditionen und der Zugänglichmachung buddhistischer Lehren für Laienanhänger.
Welche sind die bekanntesten Bücher des Khuddaka Nikāya?
- Khuddakapāṭha (Kurze Lesestücke)
- Dhammapada (Worte der Lehre/Wahrheit)
- Udāna (Inspirierte Aussprüche)
- Itivuttaka („So-wurde-gesagt“-Diskurse)
- Sutta Nipāta (Sammlung von Lehrreden in Versen und Prosa)
- Vimānavatthu (Geschichten über himmlische Wohnstätten)
- Petavatthu (Geschichten über unglückliche Geister)
- Theragāthā (Verse der älteren Mönche)
- Therīgāthā (Verse der älteren Nonnen)
- Jātaka (Geschichten früherer Leben Buddhas)
Was ist das Khuddakapāṭha?
Das Khuddakapāṭha, wörtlich „Kurze Lesestücke“ oder „Kleine Texte“, ist das erste Buch des Khuddaka Nikāya. Es enthält eine Sammlung von neun kurzen, aber grundlegenden Texten, die oft von Novizen und Laien rezitiert und studiert werden. Dazu gehören die Formel der Dreifachen Zuflucht (zu Buddha, Dhamma, Saṅgha), die Zehn Tugendregeln für Novizen, eine Betrachtung über die 32 Teile des Körpers (zur Förderung der Nicht-Anhaftung), die zehn Fragen eines Novizen sowie einige wichtige kurze Suttas wie das Maṅgala Sutta (über wahres Glück und Segen), das Ratana Sutta (über die Qualitäten der Drei Juwelen) und das Mettā Sutta (Karaṇīyamettā Sutta, über die Praxis der liebenden Güte).
Welche Bedeutung hat das Dhammapada?
Das Dhammapada, oft übersetzt als „Worte der Lehre“, „Verse der Wahrheit“ oder „Pfad des Dhamma“, ist eines der bekanntesten, am häufigsten übersetzten und beliebtesten Bücher des gesamten Pāli-Kanons. Es besteht aus 423 prägnanten Versen, die in 26 thematische Kapitel unterteilt sind und eine breite Palette ethischer und spiritueller Lehren des Buddhismus abdecken. Das Dhammapada gilt als eine Quintessenz der buddhistischen Weisheit, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Praktizierende zugänglich und inspirierend ist. Es betont Tugenden wie Achtsamkeit, Weisheit, Selbstbeherrschung und Mitgefühl und warnt vor den Gefahren von Gier, Hass und Verblendung. Ein Beispielvers ist: „Jine kadariyaṃ dānena“ – „Überwinde den Geiz durch Geben“ (Dhp 223).
Worum handelt es sich beim Udāna und Itivuttaka?
Das Udāna, wörtlich „Inspirierte Aussprüche“ oder „Ausrufe“, ist eine Sammlung von 80 feierlichen Versen, die der Buddha bei besonderen Gelegenheiten spontan geäußert haben soll, oft als Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Einsichten. Jede dieser Äußerungen wird von einer kurzen Prosaerzählung begleitet, die den Kontext erläutert. Das Udāna enthält beispielsweise das berühmte Gleichnis von den Blinden und dem Elefanten (Ud 6.4). Das Itivuttaka, was „So wurde gesagt“ bedeutet, ist eine Sammlung von 112 kurzen Lehrreden. Jede dieser Lehrreden beginnt mit der Formel „Vuttaṃ hetaṃ Bhagavatā, vuttam arahatā ti me sutaṃ“ – „So wurde es vom Erhabenen gesagt, so wurde es vom Arahant gesagt, so habe ich gehört.“ Die Suttas sind thematisch in vier Nipātas (Abschnitte) unterteilt, je nachdem, ob sie einen, zwei, drei oder vier Lehrpunkte behandeln. Sie enthalten prägnante ethische und spirituelle Unterweisungen.
Was ist das Sutta Nipāta?
Das Sutta Nipāta, oft übersetzt als „Sammlung von Lehrreden“ oder „Bruchstücke von Suttas“, ist eine der ältesten und ehrwürdigsten Sammlungen innerhalb des Pāli-Kanons. Es besteht aus 71 Suttas, die in fünf Kapitel (Vaggas) unterteilt sind und sowohl Verse als auch Prosa enthalten. Viele Texte des Sutta Nipāta gelten als sehr alt und spiegeln möglicherweise eine frühe Phase der buddhistischen Lehre wider. Sie behandeln eine Vielzahl von Themen, darunter ethisches Verhalten, die Natur der Erleuchtung, Kritik an brahmanischen Ritualen und Anleitungen für das Leben von Mönchen und Laien, oft in einer sehr direkten und poetischen Sprache.
Was sind Vimānavatthu und Petavatthu?
Das Vimānavatthu („Geschichten über himmlische Wohnstätten“ oder „Götterpalastgeschichten“) und das Petavatthu („Geschichten über unglückliche Geister“ oder „Gespenstergeschichten“) sind zwei Sammlungen, die das Prinzip von Kamma und Wiedergeburt durch Erzählungen illustrieren. Das Vimānavatthu enthält 85 (oder 83) Geschichten in Versform, die beschreiben, wie bestimmte Individuen aufgrund ihrer guten Taten in früheren Leben in himmlischen Welten (Vimānas) wiedergeboren wurden und dort Glück und Freuden genießen. Das Petavatthu hingegen enthält 51 Geschichten, ebenfalls meist in Versform, die das Leiden von Wesen (Petas) in unglücklichen Geisterwelten darstellen, als Folge ihrer unheilsamen Taten in früheren Existenzen. Beide Werke dienen dazu, die moralischen Konsequenzen von Handlungen zu verdeutlichen und zu ethischem Verhalten zu ermutigen.
Wer sind die Autoren der Theragāthā und Therīgāthā und was ist der Inhalt dieser Werke?
Die Theragāthā („Verse der älteren Mönche“) und die Therīgāthā („Verse der älteren Nonnen“) sind einzigartige Sammlungen von Gedichten, die von frühen buddhistischen Mönchen (Theras) und Nonnen (Therīs) verfasst wurden, die die Erleuchtung (Arahant-Schaft) erlangt hatten. Die Theragāthā enthält 1279 Verse, die 264 verschiedenen Mönchen zugeschrieben werden. Die Therīgāthā umfasst 522 Verse von 73 verschiedenen Nonnen. Diese Verse sind sehr persönliche und oft tief bewegende Zeugnisse ihrer spirituellen Reise, ihrer Kämpfe, Einsichten und der Freude über die erlangte Befreiung. Sie geben einen unmittelbaren Einblick in das religiöse Erleben und die spirituellen Errungenschaften dieser frühen Praktizierenden. Insbesondere die Therīgāthā ist ein seltenes und kostbares Dokument weiblicher Spiritualität in der antiken Welt und widerlegt die Vorstellung, Frauen hätten im frühen Buddhismus keine bedeutenden spirituellen Rollen innegehabt oder keine Erleuchtung erlangen können. Die Geschichte von Kisāgotamī und ihrem Weg zur Erleuchtung findet sich beispielsweise in der Therīgāthā (Thig 10.1).
Was sind die Jātakas?
Die Jātakas sind eine umfangreiche Sammlung von 547 „Wiedergeburtsgeschichten“. Sie erzählen von den früheren Leben des Buddha Siddhattha Gotama, als er noch ein Bodhisatta (ein nach Erleuchtung strebendes Wesen) war und über unzählige Existenzen hinweg die verschiedenen Vollkommenheiten (Pāramīs) kultivierte. Die Geschichten sind oft in Form von Fabeln und Märchen gehalten, in denen der Bodhisatta als Mensch, Tier oder Gottheit erscheint und ethische Tugenden wie Großzügigkeit, Geduld, Weisheit und Mitgefühl demonstriert. Das berühmteste Jātaka ist das Vessantara Jātaka, das die Vollkommenheit des Gebens (Dāna) illustriert. Die Verse in den Jātakas dienten oft als Merksätze, die von einem Erzähler mit der entsprechenden Rahmenerzählung ausgeschmückt wurden. Sie waren ein populäres Mittel zur Vermittlung buddhistischer Ethik und Werte.
Welche weiteren wichtigen Texte gehören zum Khuddaka Nikāya?
Neben den bereits genannten gehören weitere wichtige Texte zum Khuddaka Nikāya:
- Niddesa (Nid): Ein alter Kommentar zu Teilen des Sutta Nipāta, traditionell dem Hauptschüler Sāriputta zugeschrieben.
- Paṭisambhidāmagga (Paṭis): „Der Weg der Analyse“; ein komplexer und systematischer Text, der sich mit verschiedenen Aspekten der buddhistischen Lehre und Praxis befasst, insbesondere mit den analytischen Fähigkeiten und Erkenntnissen, die auf dem Weg zur Erleuchtung entwickelt werden. Er erinnert in seiner Struktur oft an den Abhidhamma und wird ebenfalls Sāriputta zugeschrieben.
- Apadāna: „Heldengeschichten“ oder „Legenden“; eine Sammlung von Verserzählungen über die früheren Leben und karmischen Verdienste von Buddha, erleuchteten Mönchen (Therāpadāna) und Nonnen (Therīapadāna).
- Buddhavaṃsa: „Die Chronik der Buddhas“; ein späterer Text, der in Versform die Lebensgeschichten der 24 Buddhas beschreibt, die Siddhattha Gotama vorausgingen, sowie die Geschichte von Gotama Buddha selbst.
- Cariyāpiṭaka: „Der Korb des rechten Wandels“; eine Sammlung von 35 Jātaka-Geschichten in Versform, die illustrieren, wie der Bodhisatta in früheren Leben die zehn Vollkommenheiten (Pāramīs) praktizierte.
In der burmesischen Ausgabe des Pāli-Kanons werden zusätzlich das Nettipakaraṇa, das Peṭakopadesa und das Milindapañhā („Die Fragen des Königs Milinda“, ein Dialog zwischen dem griechisch-baktrischen König Menandros und dem buddhistischen Mönch Nāgasena) zum Khuddaka Nikāya gezählt.
Welche Rolle spielte der Khuddaka Nikāya für die Verbreitung des Buddhismus?
Der Khuddaka Nikāya spielte mit seiner Vielfalt an literarischen Gattungen eine entscheidende Rolle dabei, buddhistische Lehren, ethische Werte und inspirierende Geschichten einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen, einschließlich Laien, die möglicherweise keinen direkten Zugang zu den komplexeren philosophischen Diskursen der längeren Nikāyas hatten. Die narrativen und poetischen Formen, wie sie in den Jātakas, dem Dhammapada oder den Theragāthā und Therīgāthā zu finden sind, eigneten sich hervorragend für die mündliche Weitergabe, das Memorieren und das emotionale Ansprechen der Zuhörer. Sie halfen, die buddhistischen Ideale im kulturellen Gedächtnis zu verankern und die Lehre populär zu machen. Die heterogene Natur dieser Sammlung und die Tatsache, dass ihre genaue Zusammensetzung in verschiedenen Traditionen leicht variiert, deutet darauf hin, dass dieser „Korb“ möglicherweise offener für spätere Ergänzungen war oder regionale Unterschiede in der Kanonbildung widerspiegelt.
 Der Abhidhamma Piṭaka: Die Höhere Lehre
Der Abhidhamma Piṭaka: Die Höhere Lehre
Was ist der Abhidhamma Piṭaka und was bedeutet „Abhidhamma“?
Der Abhidhamma Piṭaka ist der dritte und letzte der drei „Körbe“ (Piṭaka) des Pāli-Kanons. Der Begriff Abhidhamma wird oft als „Höherer Dhamma“ oder „Besonderer Dhamma“ übersetzt. Er stellt eine systematische, philosophische und psychologische Ausarbeitung und Begründung der Lehren dar, die im Sutta Piṭaka oft in diskursiverer oder narrativerer Form präsentiert werden. Der Abhidhamma zielt darauf ab, die Natur der Realität, des Bewusstseins und der mentalen Prozesse in Begriffen der „letztendlichen Wirklichkeit“ (Paramattha-Dhamma) zu analysieren, im Gegensatz zur konventionellen oder begrifflichen Realität (Sammuti-Sacca).
Wann und wie entstand der Abhidhamma Piṭaka?
Der Abhidhamma Piṭaka gilt als eine spätere Entwicklung innerhalb des Kanons und wurde dem Kanon wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha hinzugefügt. Die Tradition schreibt seine Ursprünge oft der analytischen Brillanz des Hauptschülers Sāriputta zu, oder zumindest die Inspiration dazu. Die endgültige Form und Aufnahme in den Kanon, insbesondere des Buches Kathāvatthu, wird mit dem Dritten Buddhistischen Konzil unter König Aśoka im 3. Jahrhundert v. Chr. in Verbindung gebracht, wo es von Moggaliputta Tissa Thera verfasst worden sein soll, um „häretische“ Ansichten anderer Schulen zu widerlegen.
Was ist der Hauptinhalt und die Methode des Abhidhamma?
Der Hauptinhalt des Abhidhamma ist eine detaillierte Analyse der erfahrbaren Welt, die in ihre grundlegenden psychophysischen Bestandteile zerlegt wird: Materie (Rūpa) und Geist bzw. Bewusstsein (Nāma). Seine Methode ist primär analytisch und klassifikatorisch. Er untersucht und kategorisiert systematisch:
- Bewusstseinszustände (Citta): Verschiedene Arten von heilsamem, unheilsamem und neutralem Bewusstsein.
- Mentale Faktoren (Cetasika): Die spezifischen geistigen Begleiterscheinungen, die mit jedem Bewusstseinsmoment auftreten (z. B. Gefühl, Wahrnehmung, Wille, Gier, Hasslosigkeit).
- Materie (Rūpa): Die verschiedenen Formen materieller Phänomene.
- Nibbāna: Das letztendliche Ziel, das als unbedingt und unerschaffen gilt.
Der Abhidhamma basiert auf dem Erfahrungswissen Buddhas und zielt darauf ab, die Dinge so darzustellen, „wie sie wirklich sind“, oft durch Einsichtsmeditation (Samatha-Vipassanā) erlangt. Er bietet eine detaillierte „Landkarte“ des Geistes und der Realität, die im Sutta Piṭaka verstreut zu finden sind.
Aus welchen Büchern besteht der Abhidhamma Piṭaka?
Der Abhidhamma Piṭaka der Theravāda-Tradition besteht aus sieben Büchern:
- Dhammasaṅgaṇī (Dhs): „Aufzählung der Daseinsfaktoren“ oder „Klassifikation der Dhammas“. Dieses Buch analysiert und klassifiziert alle existierenden Phänomene (Dhammas), insbesondere Bewusstseinszustände und ihre begleitenden mentalen Faktoren sowie materielle Phänomene.
- Vibhaṅga (Vibh): „Das Buch der Analyse“ oder „Abhandlungen“. Es bietet detailliertere Analysen zu achtzehn verschiedenen Themen, die bereits im Dhammasaṅgaṇī eingeführt wurden, wie z. B. die fünf Aggregate (Khandhā), die Sinnesgrundlagen (Āyatana), die Elemente (Dhātu), die Vier Edlen Wahrheiten und das Bedingte Entstehen (Paṭiccasamuppāda).
- Dhātukathā: „Diskurs über die Elemente“. Dieses Buch untersucht die Beziehungen zwischen den im Dhammasaṅgaṇī und Vibhaṅga behandelten Phänomenen in Bezug auf die Aggregate, Sinnesgrundlagen und Elemente.
- Puggalapaññatti (Pug): „Beschreibung der Persönlichkeiten“ oder „Konzepte von Individuen“. Im Gegensatz zu den anderen Abhidhamma-Büchern, die sich auf die letztendliche Realität konzentrieren, behandelt dieses Buch konventionelle Beschreibungen verschiedener Arten von Individuen entsprechend ihrer Charaktereigenschaften und spirituellen Entwicklungsstufen.
- Kathāvatthu (Kvu): „Streitpunkte“ oder „Diskussionspunkte“. Dieses Buch, das traditionell Moggaliputta Tissa Thera zugeschrieben wird, widerlegt systematisch über 200 „häretische“ Ansichten, die von verschiedenen nicht-theravādischen buddhistischen Schulen zur Zeit des Dritten Konzils vertreten wurden.
- Yamaka (Yam): „Das Buch der Paare“. Es verwendet eine Methode der logischen Analyse durch Fragen und Antworten in Paaren, um die präzise Anwendung und den Umfang verschiedener buddhistischer Begriffe zu klären und Missverständnisse zu vermeiden.
- Paṭṭhāna (Paṭṭh): „Das Buch der Bedingungszusammenhänge“ oder „Relationale Bedingungen“. Dies ist das umfangreichste und wohl komplexeste Buch des Abhidhamma. Es untersucht und klassifiziert die 24 Arten von kausalen Beziehungen oder Bedingungen (Paccaya), durch die alle mentalen und physischen Phänomene miteinander verbunden sind und voneinander abhängen.
In welchem Verhältnis steht der Abhidhamma Piṭaka zum Sutta Piṭaka?
Der Abhidhamma Piṭaka wird oft als eine systematische und detailliertere Ausarbeitung der Lehren betrachtet, die im Sutta Piṭaka in einer eher diskursiven und kontextbezogenen Weise dargelegt sind. Während die Suttas die Lehre oft durch Gleichnisse, Dialoge und Erzählungen vermitteln, zielt der Abhidhamma auf eine präzise, abstrakte und analytische Darstellung der zugrundeliegenden Prinzipien ab. Ein bekanntes Bild vergleicht den Abhidhamma mit einer genauen Analyse der Inhaltsstoffe einer Arznei, während die aus den Suttas gewonnene Erkenntnis und Praxis die Medizin selbst ist, die das Leiden heilt. Es wird betont, dass der Abhidhamma ohne praktische Anwendung und ohne das Fundament der Sutta-Kenntnis ein starres System toter Begriffe bleiben kann. Die Entwicklung des Abhidhamma könnte durch die Notwendigkeit vorangetrieben worden sein, eine detaillierte „Landkarte“ des Geistes und der Realität für fortgeschrittene Meditierende zu schaffen, um die in der Einsichtsmeditation (Vipassanā) gewonnenen Erfahrungen präzise zu verstehen und zu kategorisieren.
Gibt es Abhidhamma-Traditionen außerhalb des Theravāda?
Ja, auch andere frühe buddhistische Schulen entwickelten ihre eigenen Abhidharma-Literaturen (Sanskrit: Abhidharma, Pāli: Abhidhamma). Ein bekanntes Beispiel ist der Abhidharmakośa von Vasubandhu, der auf den Lehren der Sarvāstivāda-Schule basiert und inhaltlich vom Abhidhamma Piṭaka der Theravādins abweicht. Diese verschiedenen Abhidharma-Traditionen zeigen, dass das Bestreben nach einer systematischen philosophischen und psychologischen Analyse der Lehre ein verbreitetes Phänomen im frühen Buddhismus war, auch wenn sich die spezifischen Ausarbeitungen unterschieden.
Weiter in diesem Bereich mit …
Wichtige nachkanonische Texte
Der Pāli-Kanon bildet das Fundament des Theravāda-Buddhismus, doch was geschah danach? Tauche ein in die Welt der wichtigen Kommentare und nachkanonischen Texte, die über Jahrhunderte entstanden sind. Entdecke, wie Werke wie der systematische Visuddhimagga, die dialogreichen Milindapañhā und die tiefgründigen Abhidhamma-Kompendien die Lehren des Buddha vertiefen, klären und für die Praxis zugänglich machen.