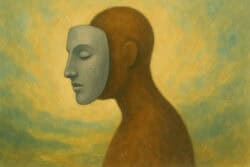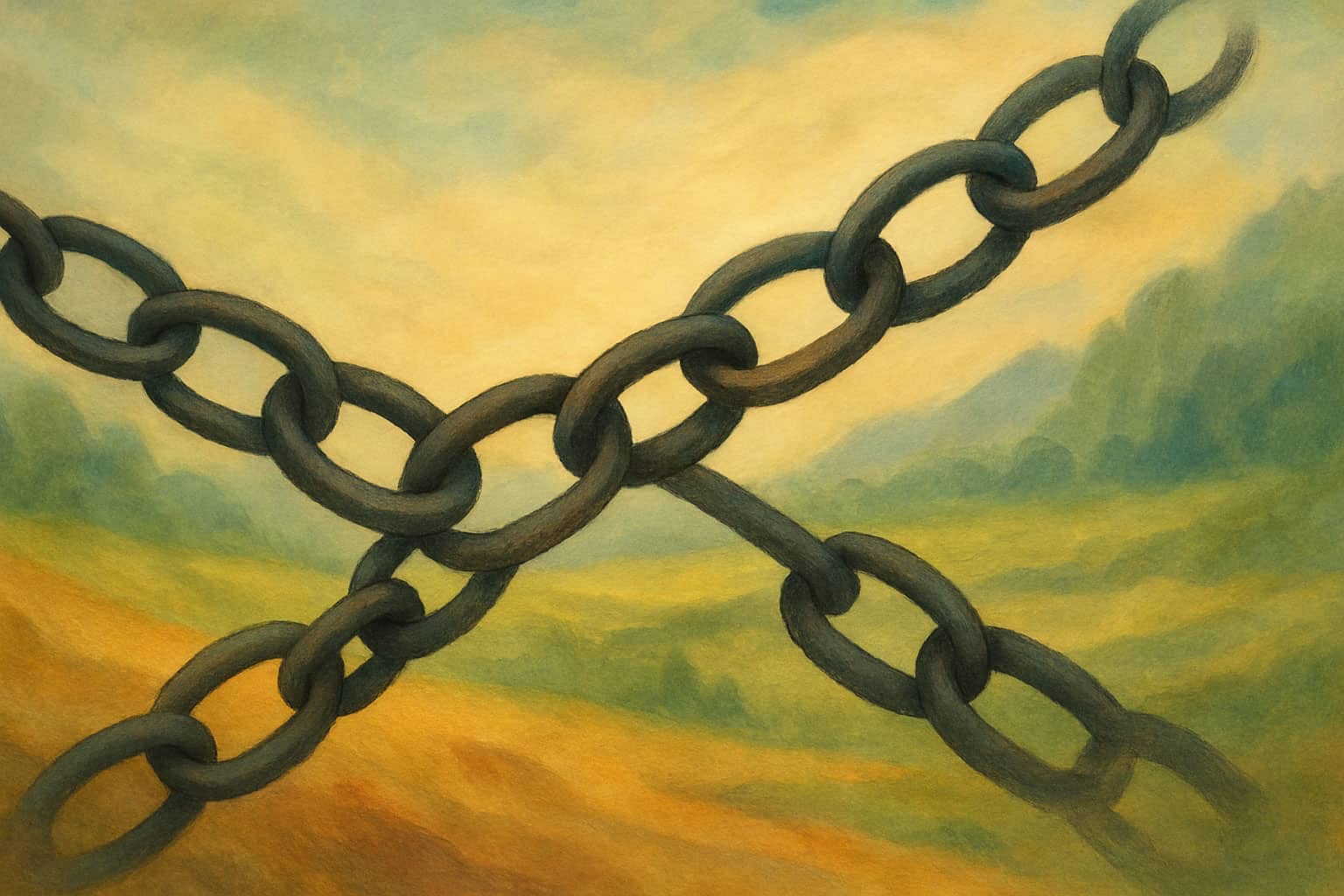
Bericht: Die Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni) – Hindernisse und Wegmarken zur Befreiung im Buddhismus
Verständnis der Bindungen, die uns im Saṃsāra halten
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Zehn Fesseln – Hindernisse auf dem Weg zur Befreiung
- Die Liste der Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni)
- Niedere und Höhere Fesseln: Stufen der Bindung
- Die Fesseln und der Pfad zur Erwachung: Die Stufen der Heiligkeit
- Die Lehre von den Fesseln im Pālikanon: Zentrale Lehrreden
- Zusammenfassung und Ausblick
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung: Die Zehn Fesseln – Hindernisse auf dem Weg zur Befreiung
Im Herzen der buddhistischen Lehre (Dhamma) steht der Weg zur Befreiung vom leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten, bekannt als Saṃsāra. Ein zentrales Konzept zum Verständnis dieses Weges sind die Dasa Saṃyojanāni (sprich: Da-sa San-jo-dscha-naa-ni), die „Zehn Fesseln“. Diese Fesseln repräsentieren tief verwurzelte psychologische und existenzielle Hindernisse, die Lebewesen an diesen Kreislauf binden und das Erreichen der endgültigen Befreiung, Nibbāna (Sanskrit: Nirvāṇa), verhindern. Das Erkennen, Verstehen und schrittweise Überwinden dieser Fesseln ist daher ein wesentlicher Bestandteil der buddhistischen Praxis.
Der Pāli-Begriff Saṃyojana (Sanskrit: Saṃyojana) setzt sich zusammen aus saṃ („zusammen“) und der Wurzel yuj („jochen“, „binden“). Wörtlich bedeutet es „Zusammenbindung“ oder „Anjochung“. Im buddhistischen Kontext wird es meist als „Fessel“ übersetzt und bezeichnet mentale Faktoren, Neigungen oder Verunreinigungen (Kilesa), die den Geist binden und gefangen halten. Die vollständige Durchtrennung oder Auflösung aller zehn Fesseln ist gleichbedeutend mit der Erlangung der Arahantschaft, dem Zustand vollkommener Heiligkeit und Befreiung.
Es ist jedoch hilfreich zu verstehen, dass die Übersetzung „Fessel“ auch irreführend sein kann. Während eine Fessel oft mit einem einzigen Schnitt durchtrennt werden kann, handelt es sich bei den Saṃyojanāni eher um tief eingewurzelte „Verstrickungen“, „Gewohnheiten“ oder „Anjochungen“. Diese binden uns auf vielfältige Weise durch subtile und oft unbewusste Bewertungen und Anhaftungen. Ihre Überwindung ist daher weniger ein einzelner Akt als vielmehr ein gradueller Prozess des Erkennens, Loslassens und der Kultivierung heilsamer Geisteszustände.
Das Pāli-Wort dasa in Dasa Saṃyojanāni bedeutet schlicht „zehn“. Es steht in keinem Zusammenhang mit dem Wort dāsa, das in anderen Kontexten des Pāli oder Sanskrit „Sklave“, „Diener“ oder „Anhänger“ bedeuten kann.
Dieser Bericht zielt darauf ab, die zehn Fesseln gemäß der frühen buddhistischen Überlieferung im Pālikanon klar und strukturiert darzustellen. Er erläutert ihre Bedeutung, ihre Einteilung in niedere und höhere Fesseln, ihren direkten Zusammenhang mit den Stufen des Erwachens (Ariya-Puggala) und verweist auf zentrale Lehrreden (Suttas) aus den vier Hauptsammlungen des Sutta Piṭaka.
Die Liste der Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni)
Die Lehre von den zehn Fesseln findet sich in verschiedenen Lehrreden des Pālikanons. Die am häufigsten zitierte und als Standard geltende Liste, oft als „Suttanta-Methode“ bezeichnet, umfasst die folgenden zehn mentalen Bindungen.
Tabelle 1: Die Zehn Fesseln (Dasa Saṃyojanāni) im Überblick
| Nr. | Pāli-Begriff | Deutsche Übersetzung | Kurze Erklärung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sakkāya-Diṭṭhi | Persönlichkeitsglaube | Falsche Ansicht eines permanenten, unabhängigen Selbst oder einer Seele (Attā) in den fünf Daseinsgruppen (Khandha). |
| 2 | Vicikicchā | Zweifel, Zweifelsucht | Lähmender Zweifel am Buddha, seiner Lehre (Dhamma), der Gemeinschaft (Saṅgha) oder dem Übungsweg. |
| 3 | Sīlabbata-Parāmāsa | Hängen an Regeln & Riten | Glaube, dass bloße Regeln, Rituale oder äußere Praktiken allein zur Befreiung führen, ohne inneres Verständnis oder ethische Motivation. |
| 4 | Kāma-Rāga | Sinnliches Begehren | Gier und Anhaftung an angenehme Sinnesobjekte und Erfahrungen in der Sinnenwelt (Kāma-Loka). |
| 5 | Byāpāda (Vyāpāda) | Groll, Übelwollen | Hass, Ärger, Widerwille oder Feindseligkeit gegenüber unangenehmen Erfahrungen, Personen oder Objekten. |
| 6 | Rūpa-Rāga | Begehren nach Form | Verlangen nach Wiedergeburt in feinstofflichen Formwelten (Rūpa-Loka), oft verbunden mit Anhaftung an meditative Errungenschaften. |
| 7 | Arūpa-Rāga | Begehren nach Formlosem | Verlangen nach Wiedergeburt in den formlosen Welten (Arūpa-Loka), verbunden mit Anhaftung an sehr subtile meditative Zustände. |
| 8 | Māna | Dünkel, Stolz | Subtile Einbildung oder Stolz bezüglich der eigenen Person, Fähigkeiten oder spirituellen Fortschritts (Über-, Unter-, Gleichheitsdünkel). |
| 9 | Uddhacca | Aufgeregtheit, Unruhe | Geistige Rastlosigkeit, Zerstreutheit, innere Aufgewühltheit, die Konzentration und Klarheit verhindert. |
| 10 | Avijjā | Unwissenheit | Fundamentales Nicht-Wissen der Vier Edlen Wahrheiten, der wahren Natur der Realität (Anicca, Dukkha, Anattā) und des Bedingten Entstehens. |
Detaillierte Erläuterung der einzelnen Fesseln:
- Sakkāya-Diṭṭhi (Persönlichkeitsglaube): Dies ist die grundlegende falsche Ansicht (Diṭṭhi), ein beständiges, unabhängiges „Ich“, eine „Seele“ oder ein „Selbst“ (Attā) zu besitzen, das getrennt von den sich ständig verändernden körperlichen und geistigen Prozessen existiert. Diese Ansicht manifestiert sich in der Identifikation mit den fünf Daseinsgruppen (Khandha) – Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein – als „Ich bin dies“ oder „Dies ist mein“. Im Sabbāsava Sutta (MN 2) wird diese Art von Ansicht als ein „Dickicht“ oder eine „Verzerrung“ beschrieben, die aus unweiser Betrachtung entsteht und den Geist fesselt. Die Überwindung dieser Fessel beginnt mit der Einsicht in das Nicht-Selbst (Anattā).
- Vicikicchā (Zweifel/Zweifelsucht): Diese Fessel bezieht sich auf einen tiefgreifenden, lähmenden Zweifel, der das Vertrauen (Saddhā) in die Kernaspekte des buddhistischen Weges untergräbt: Zweifel am Erwachen des Buddha, an der Wirksamkeit seiner Lehre (Dhamma), an der spirituellen Qualität der Gemeinschaft der Edlen (Saṅgha) und an der Notwendigkeit oder Durchführbarkeit der Übungspraxis (Regeln, Ethik, Meditation). Es ist kein konstruktiver, fragender Zweifel, sondern eine innere Unsicherheit, die den Praktizierenden davon abhält, sich dem Weg hinzugeben und Fortschritte zu machen.
- Sīlabbata-Parāmāsa (Hängen an Regeln und Riten): Dies bezeichnet das Festhalten an ethischen Regeln (Sīla) und asketischen Übungen oder Ritualen (Vata) in dem irrigen Glauben, dass deren bloße äußere Befolgung automatisch zur Befreiung führt. Es fehlt das Verständnis für den eigentlichen Zweck dieser Praktiken – nämlich die Läuterung des Geistes und die Entwicklung von Weisheit – oder die zugrundeliegende ethische Motivation. Diese Fessel beinhaltet die Gefahr, in magische Vorstellungen oder oberflächliche Religiosität abzurutschen.
- Kāma-Rāga (Sinnliches Begehren / Sinnenlust): Dies ist die Gier (Rāga) nach und die Anhaftung an angenehme Erfahrungen, die durch die sechs Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken als Sinnesorgan) in der Sinnenwelt (Kāma-Loka) entstehen. Es umfasst nicht nur grobe Begierden wie sexuelle Lust oder Völlerei, sondern auch subtilere Anhaftungen an Kunst, Musik, intellektuelle Beschäftigungen oder weltliche Vergnügungen. Im Citta Saṃyutta (SN 41.1) wird erklärt, dass die Fessel nicht im Sinnesorgan oder im Objekt selbst liegt, sondern in der Begierde und Gier (Chandarāga), die durch den Kontakt zwischen beiden entsteht.
- Byāpāda / Vyāpāda (Groll / Übelwollen): Diese Fessel umfasst alle Formen von Aversion, Hass, Ärger, Widerwillen und Feindseligkeit gegenüber unangenehmen oder unerwünschten Erfahrungen, Personen oder Situationen. Sie reicht von subtiler Gereiztheit bis zu starkem Hass und Boshaftigkeit. Vyāpāda ist das direkte Gegenteil von liebender Güte (Mettā) und Mitgefühl (Karuṇā).
- Rūpa-Rāga (Begehren nach Feinkörperlichkeit / Form-Gier): Dies ist eine subtilere Form der Begierde, nämlich das Verlangen nach Wiedergeburt in den sogenannten Formwelten (Rūpa-Loka) oder Brahma-Welten. Diese Welten werden als Ergebnis tiefer meditativer Konzentration (die ersten vier Jhānas) beschrieben und sind durch Glückseligkeit und feinstoffliche Körperlichkeit gekennzeichnet. Die Anhaftung an diese Zustände und die Sehnsucht nach einer Existenz in ihnen stellt eine Fessel dar.
- Arūpa-Rāga (Begehren nach dem Unkörperlichen / Formlos-Gier): Eine noch subtilere Fessel ist das Verlangen nach Wiedergeburt in den formlosen Welten (Arūpa-Loka). Diese Bereiche entsprechen den vier formlosen meditativen Vertiefungen (Arūpa-Jhānas), Zuständen reinen Bewusstseins ohne Formbezug. Auch die Anhaftung an diese höchsten meditativen Errungenschaften und die damit verbundene Existenz bindet an den Saṃsāra.
- Māna (Dünkel / Stolz / Einbildung): Māna ist eine subtile Form der Ich-Identifikation, die auch dann noch bestehen kann, wenn der grobe Persönlichkeitsglaube (Sakkāya-Diṭṭhi) überwunden ist. Es äußert sich als Stolz auf die eigenen Fähigkeiten, Errungenschaften oder den spirituellen Status und führt zu Vergleichen mit anderen (Überlegenheits-, Unterlegenheits- oder Gleichheitsdünkel). Es basiert auf einer subtilen „Ich-bin“-Empfindung.
- Uddhacca (Aufgeregtheit / Unruhe): Diese Fessel beschreibt einen Zustand geistiger Unruhe, Rastlosigkeit, Zerstreutheit und innerer Aufgewühltheit. Der Geist ist nicht gesammelt, springt von einem Gedanken zum nächsten und findet keine Stille. Diese Unruhe ist oft eng mit der Ich-Empfindung und unerfüllten Wünschen oder Ängsten verbunden.
- Avijjā (Unwissenheit / Verblendung): Dies ist die fundamentalste aller Fesseln und die Wurzel des gesamten Leidenszyklus. Avijjā ist das Nicht-Wissen oder die Verblendung hinsichtlich der wahren Natur der Wirklichkeit – insbesondere der Vier Edlen Wahrheiten, der drei Daseinsmerkmale (Vergänglichkeit – Anicca, Leidhaftigkeit/Unzulänglichkeit – Dukkha, Nicht-Selbst – Anattā) und des Gesetzes des Bedingten Entstehens (Paṭiccasamuppāda). Sie ist die Basis, auf der alle anderen Fesseln und Verunreinigungen gedeihen.
Es ist festzuhalten, dass es innerhalb der buddhistischen Tradition, insbesondere im Vergleich zwischen dem Sutta Piṭaka und dem späteren Abhidhamma Piṭaka, leichte Variationen in der genauen Auflistung und Benennung der zehn Fesseln geben kann. Solche Variationen können auf unterschiedliche Schwerpunkte oder eine historische Entwicklung in der Systematisierung der Lehre hindeuten.
Niedere und Höhere Fesseln: Stufen der Bindung
Die zehn Fesseln werden im Pālikanon systematisch in zwei Gruppen unterteilt, die unterschiedliche Ebenen der Bindung an den Saṃsāra repräsentieren:
- Die fünf niederen Fesseln (Orambhāgiya-Saṃyojana): Diese umfassen die ersten fünf Fesseln der oben genannten Liste:
- Sakkāya-Diṭṭhi (Persönlichkeitsglaube)
- Vicikicchā (Zweifel)
- Sīlabbata-Parāmāsa (Hängen an Regeln und Riten)
- Kāma-Rāga (Sinnliches Begehren)
- Vyāpāda (Groll)
- Die fünf höheren Fesseln (Uddhambhāgiya-Saṃyojana): Diese umfassen die letzten fünf Fesseln:
- Rūpa-Rāga (Begehren nach Form)
- Arūpa-Rāga (Begehren nach Formlosem)
- Māna (Dünkel)
- Uddhacca (Aufgeregtheit)
- Avijjā (Unwissenheit)
Die Bezeichnung „niedere“ (Orambhāgiya) und „höhere“ (Uddhambhāgiya) bezieht sich auf die Bereiche der Existenz, an die diese Fesseln primär binden. Die niederen Fesseln sind hauptsächlich verantwortlich für die Wiedergeburt in der Sinnenwelt (Kāma-Loka), der Welt der grobstofflichen Erfahrungen, die Menschen, Tiere und bestimmte Götterebenen umfasst. Wer diese fünf Fesseln vollständig überwunden hat, der Anāgāmī (Nichtwiederkehrer), wird nicht mehr in diese Sinnenwelt zurückkehren.
Die höheren Fesseln hingegen binden an die subtileren Existenzebenen der Formwelt (Rūpa-Loka) und der formlosen Welt (Arūpa-Loka), die durch hohe meditative Errungenschaften zugänglich sind. Selbst wenn die groben Anhaftungen an die Sinnenwelt überwunden sind, halten diese subtilen Begierden nach feinstofflicher oder formloser Existenz sowie Dünkel, Unruhe und die grundlegende Unwissenheit das Wesen noch im Saṃsāra gefangen. Erst der Arahat, der alle zehn Fesseln restlos beseitigt hat, ist vollständig frei.
Diese Einteilung verdeutlicht die graduelle Natur des buddhistischen Befreiungsweges. Die Praxis beginnt typischerweise mit der Auseinandersetzung mit den gröberen Hindernissen, die im alltäglichen Leben am präsentesten sind: die falsche Identifikation mit dem Selbst, grundlegende Zweifel, das Klammern an Äußerlichkeiten sowie die starken Emotionen von Gier und Hass. Erst wenn diese transformiert sind, kann die Aufmerksamkeit den subtileren Anhaftungen an meditative Zustände und den tiefsten Wurzeln der Ich-Anhaftung (Dünkel) und Verblendung (Unwissenheit) zugewandt werden. Dieser Fortschritt von grob zu fein ist charakteristisch für einen schrittweisen Übungsweg.
Die Fesseln und der Pfad zur Erwachung: Die Stufen der Heiligkeit
Das Konzept der zehn Fesseln ist im Theravāda-Buddhismus untrennbar mit den vier Stufen der überweltlichen Pfade (Lokuttara-Magga) und der entsprechenden Früchte (Phala) verbunden. Diese Stufen kennzeichnen den unumkehrbaren Fortschritt auf dem Weg zur Befreiung und werden durch die Überwindung spezifischer Fesseln definiert. Jede Stufe repräsentiert einen qualitativen Sprung im Verständnis und in der Läuterung des Geistes.
- Stromeingetretener (Sotāpanna): Der Eintritt in den „Strom“ (Sota), der unweigerlich zu Nibbāna führt, wird durch die vollständige Überwindung der ersten drei Fesseln erreicht: 1. Sakkāya-Diṭṭhi (Persönlichkeitsglaube), 2. Vicikicchā (Zweifel) und 3. Sīlabbata-Parāmāsa (Hängen an Regeln und Riten). Ein Sotāpanna hat die erste, irreversible Einsicht in die Vier Edlen Wahrheiten gewonnen und ist sicher vor Wiedergeburt in leidvollen niederen Daseinsbereichen (Tierwelt, Hungergeister, Höllen). Die volle Erleuchtung wird spätestens nach sieben weiteren Wiedergeburten in menschlichen oder göttlichen Welten erreicht.
- Einmalwiederkehrer (Sakadāgāmī): Diese Stufe wird erreicht, wenn zusätzlich zu den ersten drei Fesseln auch die vierte (sinnliches Begehren, Kāma-Rāga) und die fünfte Fessel (Groll, Vyāpāda) in ihren groben Ausprägungen signifikant abgeschwächt sind. Wie der Name sagt, kehrt ein Sakadāgāmī höchstens noch ein einziges Mal in die Sinnenwelt zurück, bevor er Nibbāna erlangt.
- Nichtwiederkehrer (Anāgāmī): Der Anāgāmī hat die ersten fünf Fesseln – die gesamten niederen Fesseln (Orambhāgiya-Saṃyojana) – vollständig und endgültig überwunden. Da er frei von sinnlichem Begehren und Groll ist, wird er nicht mehr in die Sinnenwelt wiedergeboren. Stattdessen erfolgt die Wiedergeburt in einer der „Reinen Gefilde“ (Suddhāvāsa), einer hohen Brahma-Welt, von wo aus er Nibbāna erreicht, ohne in niedere Welten zurückzukehren.
- Heiliger (Arahat): Der Arahat ist die höchste Stufe und bezeichnet jemanden, der alle zehn Fesseln restlos zerstört hat, einschließlich der fünf höheren Fesseln (Uddhambhāgiya-Saṃyojana). Der Arahat hat das Ziel erreicht, Nibbāna verwirklicht und ist vollständig vom Kreislauf der Wiedergeburten befreit. Er hat alle geistigen Verunreinigungen (Kilesa) und Triebe (Āsava) vernichtet.
Eng verwandt mit den Fesseln sind die Āsavas (wörtlich „Ausflüsse“, oft übersetzt als Triebe, Befleckungen oder Verderbnisse). Die vier Haupt-Āsavas sind der Sinnlichkeitstrieb (Kāmāsava), der Daseinstrieb (Bhavāsava), der Ansichtentrieb (Diṭṭhāsava) und der Unwissenheitstrieb (Avijjāsava). Sie gelten als die tiefsten Wurzeln der Bindung an den Saṃsāra. Avijjā (Unwissenheit) ist sowohl die zehnte Fessel als auch der vierte Āsava, was ihre fundamentale Bedeutung unterstreicht. Die vollständige Vernichtung der Āsavas (Āsavakkhaya) ist ein klassisches Synonym für die Arahantschaft. Das Sabbāsava Sutta (MN 2) widmet sich ausführlich den Methoden zur Überwindung dieser Āsavas, darunter Methoden des Sehens (der Realität), der Zurückhaltung (der Sinne), des richtigen Gebrauchs (von Notwendigkeiten), des Ertragens (von Schwierigkeiten), des Vermeidens (von Gefahren), des Beseitigens (unheilsamer Gedanken) und des Entfaltens (der Erleuchtungsglieder).
Die detaillierte Verknüpfung der Fesseln mit den Stufen der Heiligkeit zeigt, dass die Lehre von den Dasa Saṃyojanāni nicht nur eine Beschreibung psychologischer Hindernisse ist, sondern auch als ein diagnostisches Instrument dient. Der Grad der Überwindung spezifischer Fesseln wird zum Maßstab für den erreichten Fortschritt auf dem überweltlichen Pfad. Für Praktizierende kann die achtsame Reflexion über das Vorhandensein und die Stärke dieser Fesseln im eigenen Geist somit ein Mittel zur Selbsteinschätzung und zur Ausrichtung der Praxis sein. Es ist jedoch auch denkbar, dass die sehr systematische Verknüpfung der zehn Fesseln mit den vier exakt definierten Stufen der Heiligkeit eine gewisse historische Entwicklung innerhalb der buddhistischen Tradition widerspiegelt. Während die Konzepte selbst tief im frühen Buddhismus verwurzelt sind, könnte diese spezifische, klar strukturierte soteriologische Hierarchie in den späteren Schichten des Kanons, insbesondere im Abhidhamma und den Kommentaren, stärker ausgearbeitet und standardisiert worden sein als in den allerfrühesten Lehrreden, die mitunter vielfältigere Beschreibungen von Hindernissen und Befreiungswegen enthalten.
Die Lehre von den Fesseln im Pālikanon: Zentrale Lehrreden
Das Konzept der Saṃyojanāni ist ein integraler Bestandteil der Lehre und findet sich daher in allen vier Hauptsammlungen (Nikāyas) des Sutta Piṭaka. Die folgende Auswahl zentraler Lehrreden, referenziert über SuttaCentral.net, illustriert dies. Zusammenfassungen / Erklärungen zu den Lehrreden finden sich auch im Lehrreden-Verzeichnis dieser Seite.
- Dīgha Nikāya (DN) – Die Sammlung der langen Lehrreden:
- DN 33: Saṅgīti Sutta (Die Lehrrede über das gemeinsame Rezitieren / Das große Sammelwerk): In dieser Lehrrede fasst der Ehrwürdige Sāriputta auf Wunsch des Buddha zentrale Lehrpunkte systematisch nach Zahlen geordnet zusammen. Unter der Rubrik der „Zehner-Gruppen“ werden explizit die Dasa Saṁyojanāni (zehn Fesseln) aufgeführt, korrekt unterteilt in die fünf niederen (Orambhāgiya) und die fünf höheren (Uddhambhāgiya) Fesseln. DN 33 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- Majjhima Nikāya (MN) – Die Sammlung der mittleren Lehrreden:
- MN 2: Sabbāsava Sutta (Die Lehrrede von allen Trieben / Alle Befleckungen): Obwohl primär auf die Āsavas (Triebe/Befleckungen) fokussiert, ist dieses Sutta hoch relevant für das Verständnis der Fesseln. Es erklärt, wie falsche Ansichten (Micchā-Diṭṭhi), die Kern der ersten Fessel (Sakkāya-Diṭṭhi) sind, durch unweise Aufmerksamkeit (Ayoniso Manasikāra) entstehen und durch „Sehen“ – d. h., durch die Einsicht in die Vier Edlen Wahrheiten – überwunden werden. MN 2 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- MN 9: Sammādiṭṭhi Sutta (Die Lehrrede von der rechten Ansicht): Der Ehrwürdige Sāriputta erläutert hier umfassend die Rechte Ansicht (Sammā-Diṭṭhi), den ersten Faktor des Edlen Achtfachen Pfades. Rechte Ansicht ist das direkte Gegenmittel zu den Fesseln, die auf falschen Ansichten und Unwissenheit beruhen, insbesondere Sakkāya-Diṭṭhi (1), Vicikicchā (2) und Avijjā (10). MN 9 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- MN 64: Mahāmālukya Sutta (Die größere Lehrrede an Māluṅkyaputta): Dieses Sutta ist zentral für das Verständnis der niederen Fesseln. Der Buddha korrigiert hier das oberflächliche Verständnis des Mönchs Māluṅkyaputta und erklärt, dass die fünf niederen Fesseln als tief liegende „zugrundeliegende Neigungen“ (Anusaya) selbst dann vorhanden sind, wenn sie sich nicht aktiv im Bewusstsein manifestieren – illustriert am Beispiel eines Säuglings, der zwar keine bewusste Ich-Ansicht hat, aber die Neigung dazu in sich trägt. Der Buddha beschreibt dann detailliert den Pfad und die Praxis (Magga, Paṭipadā), die zur vollständigen Überwindung dieser fünf Fesseln und damit zur Nichtwiederkehr (Anāgāmitā) führen. MN 64 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- Saṃyutta Nikāya (SN) – Die Sammlung der gruppierten Lehrreden:
- Der Saṃyutta Nikāya ist thematisch in Kapitel (Saṃyuttas) gegliedert, die jeweils Lehrreden zu einem bestimmten Thema zusammenfassen. Eine Suche nach einem spezifischen Kapitel mit dem Titel „Saṁyojana Saṁyutta“, das sich ausschließlich und systematisch den zehn Fesseln widmet, bleibt jedoch erfolglos. Dies legt nahe, dass die Lehre von den Fesseln im SN eher thematisch in verschiedene Kontexte integriert ist, anstatt ein eigenes, abgegrenztes Hauptthema zu bilden.
- Dennoch gibt es relevante Suttas. Beispielsweise diskutiert SN 41.1 (Paṭhama Saṃyojana Sutta im Citta Saṃyutta) explizit die Beziehung zwischen der „Fessel“ (Saṃyojana) und den „Dingen, die zur Fesselung neigen“ (Saṃyojaniyā Dhammā). Anhand des Gleichnisses von zwei Ochsen, die durch ein Joch verbunden sind, wird erklärt, dass weder das Sinnesorgan (z. B. das Auge) noch das Sinnesobjekt (z. B. die Form) die Fessel ist, sondern die Begierde und Gier (Chandarāga), die aufgrund des Kontakts zwischen beiden entsteht.
- Darüber hinaus behandeln andere Kapitel des SN Themen, die in direktem Zusammenhang mit der Überwindung der Fesseln stehen, wie das Diṭṭhi Saṃyutta (SN 24) über Ansichten, das Khandha Saṃyutta (SN 22) über die Aggregate, das Saḷāyatana Saṃyutta (SN 35) über die Sinnesgrundlagen oder das Magga Saṃyutta (SN 45) über den Edlen Achtfachen Pfad. SN 22 | SN 24 | SN 35 | SN 45 – Zusammenfassungen der Kapitel im Lehrreden-Verzeichnis.
- Aṅguttara Nikāya (AN) – Die Sammlung der angereihten Lehrreden:
- Der Aṅguttara Nikāya ordnet Lehrreden numerisch nach der Anzahl der behandelten Punkte. Im „Zehner-Buch“ (Dasaka Nipāta) findet sich das AN 10.13: Saṃyojana Sutta (Die Lehrrede von den Fesseln). Dieses Sutta listet klar und prägnant die zehn Fesseln auf und teilt sie explizit in die fünf niederen und die fünf höheren Fesseln ein, genau wie im Saṅgīti Sutta (DN 33).
- Darüber hinaus enthält der AN zahlreiche weitere Suttas, die für das Verständnis und die Überwindung der Fesseln relevant sind. Dazu gehören Listen über unheilsame Geisteszustände wie Gier, Hass und Verblendung (die den Fesseln 4, 5 und 10 entsprechen), über die fünf Hindernisse (Nīvaraṇa, die eng mit den Fesseln verwandt sind) oder über die Faktoren des Edlen Achtfachen Pfades, der als der Weg zur Beseitigung aller Fesseln gilt.
Zusammenfassung und Ausblick
Die Dasa Saṃyojanāni, die Zehn Fesseln, sind ein zentrales Lehrkonzept im Buddhismus, das die mentalen und existenziellen Bindungen beschreibt, die Lebewesen im leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) gefangen halten. Sie reichen von groben Verblendungen wie dem Glauben an ein festes Selbst (Sakkāya-Diṭṭhi), Zweifel (Vicikicchā) und dem Hängen an Ritualen (Sīlabbata-Parāmāsa) über emotionale Verstrickungen wie sinnliches Begehren (Kāma-Rāga) und Groll (Vyāpāda) bis hin zu subtilen Anhaftungen an meditative Zustände (Rūpa-Rāga, Arūpa-Rāga), Dünkel (Māna), geistige Unruhe (Uddhacca) und der fundamentalen Unwissenheit (Avijjā).
Die kanonische Einteilung in fünf niedere und fünf höhere Fesseln verdeutlicht die Stufen der Bindung an verschiedene Existenzebenen (Sinnenwelt vs. Form- und formlose Welten) und spiegelt den graduellen Charakter des Befreiungsweges wider. Die Überwindung spezifischer Fesseln definiert die vier Stufen der Heiligkeit (Ariya-Puggala) – vom Stromeingetretenen (Sotāpanna) bis zum vollkommenen Heiligen (Arahat). Somit dienen die Fesseln nicht nur der Beschreibung von Hindernissen, sondern auch als Wegweiser und Maßstab für den spirituellen Fortschritt.
Das Verständnis der Zehn Fesseln ist für Praktizierende von großer Bedeutung. Es ermöglicht, die eigenen mentalen Muster und Verblendungen zu erkennen, die Leiden verursachen und die Befreiung verhindern. Die Auseinandersetzung mit den relevanten Lehrreden des Buddha, wie sie in den Nikāyas überliefert sind, und die achtsame Beobachtung dieser Fesseln im eigenen Geist durch Meditation und Reflexion bilden den Kern der buddhistischen Praxis, die auf das endgültige Loslassen aller Bindungen und die Verwirklichung von Nibbāna abzielt. Die Lehre von den Fesseln ist somit keine rein theoretische Abhandlung, sondern eine praktische Anleitung zur Transformation des Geistes und zur Befreiung von Dukkha.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.
- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.
- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.
- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.
- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.
- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Persönlichkeitsglaube (Sakkāya-diṭṭhi)
Hier entdeckst du die grundlegendste aller Fesseln: die tief sitzende, aber irrige Ansicht, ein festes, unabhängiges „Ich“ oder eine „Seele“ (Attā) zu besitzen, getrennt von den sich ständig wandelnden Prozessen deines Körpers und Geistes. Du erfährst, wie diese Identifikation mit den fünf Daseinsgruppen (Khandha) entsteht und warum ihre Überwindung durch die Einsicht in das
Nicht-Selbst (Anattā) der erste Schritt zur Befreiung ist.
Mehr zum Thema dieser Seite …
Die Vier Stufen der Erleuchtung
Was bedeutet es, den Strom zu betreten oder „nicht wiederzukehren“? Hier erfährst du, wie der Buddhismus den Weg zur Befreiung in vier klare Stufen unterteilt. Entdecke, welche inneren Fesseln auf jeder Ebene abgelegt werden – von der ersten Überwindung des Zweifels bis zur endgültigen Freiheit eines Arahant. Dieser Weg ist nicht nur ein Ziel, sondern ein schrittweiser Prozess der Befreiung, der dich lehrt, den Geist zu verstehen und zu reinigen.
Der Pfad zum Stromeintritt
Der Stromeintritt (Sotāpatti) ist der entscheidende Wendepunkt auf dem buddhistischen Weg – der unumkehrbare Schritt in Richtung Freiheit. Doch wie erreicht man dieses Ziel? Der Buddha selbst gab eine klare Antwort in Form von vier fundamentalen Faktoren. Dieser Leitfaden erklärt diese vier Säulen des Erwachens auf eine praxisnahe Weise.
Anattā (Nicht-Selbst)
Anattā ist das Merkmal des Nicht-Selbst. Es besagt, dass es in keinem Phänomen – weder in den bedingten Dingen noch im unbedingten Nibbāna – ein festes, unabhängiges, unveränderliches „Ich“ oder eine „Seele“ gibt. Was du als dein Selbst wahrnimmst, ist ein sich ständig wandelnder Strom voneinander abhängiger Prozesse (die fünf Khandha). Vertiefe hier dein Verständnis dieser herausfordernden, aber zutiefst befreienden Lehre, die die Wurzel des Ego-Anhaftens durchtrennt.