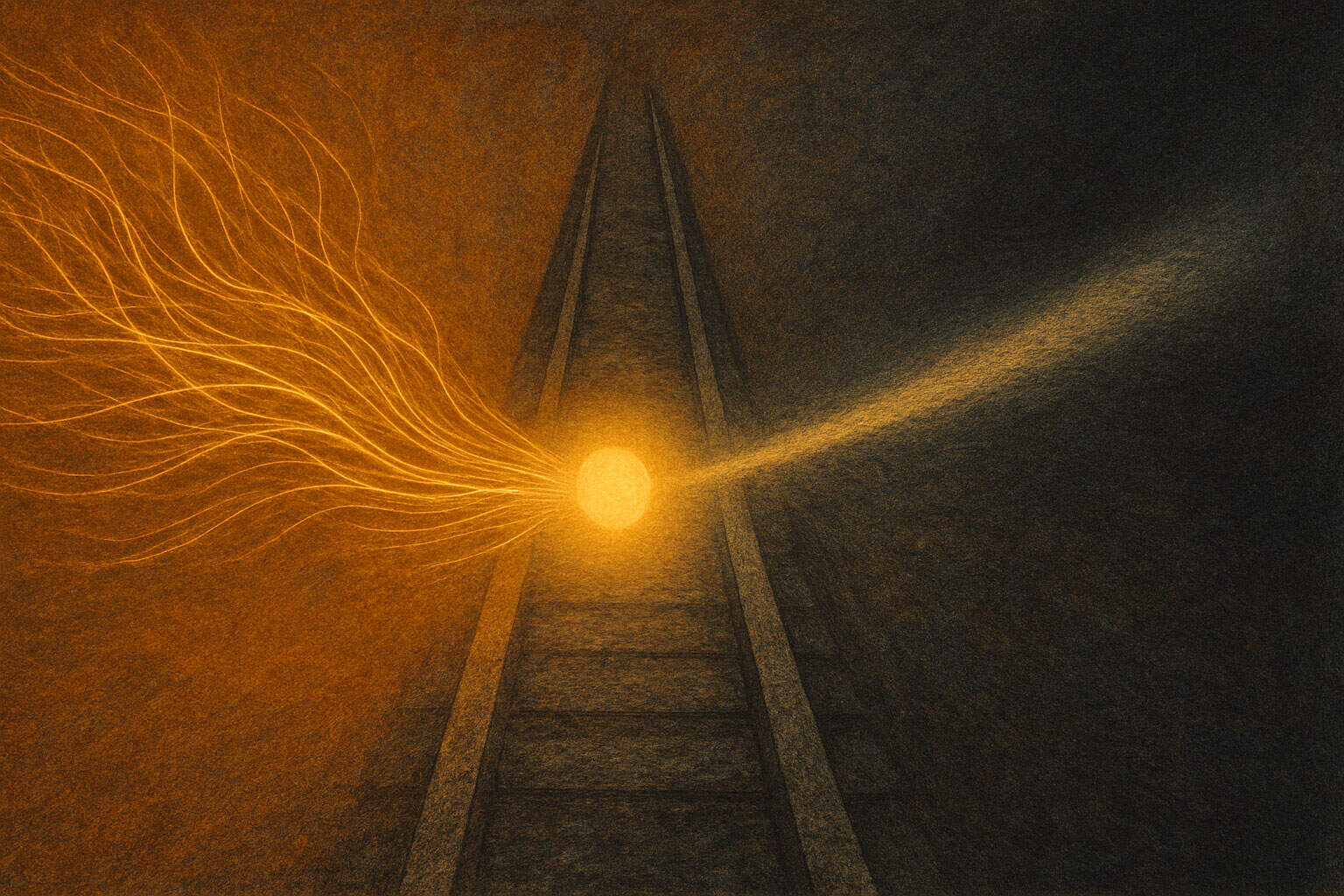
Freier Wille statt Schicksal: Das buddhistische Kamma-Verständnis im Streit mit Fatalismus und Materialismus
Eine philosophische Analyse basierend auf der Samaññaphala Sutta
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die philosophische Arena Altindiens und die Suche des Königs
- Das Prinzip der Selbstgestaltung: Die buddhistische Lehre von Kamma und Cetanā
- Die Lehren der Verneinung: Fatalismus, Materialismus und Amoralismus
- Vergleichende Analyse: Die Implikationen der Weltbilder
- Fazit: Kamma als befreiendes Handlungsprinzip
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung: Die philosophische Arena Altindiens und die Suche des Königs
Im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war der indische Subkontinent ein brodelnder Kessel intellektueller und spiritueller Gärung. Neben der etablierten brahmanischen Priesterreligion, die auf den heiligen Veden und komplexen Opferritualen basierte, entstand eine kraftvolle Gegenbewegung: die der Samaṇas. Diese „Wanderasketen“ oder „Strebenden“ verließen das häusliche Leben, um auf eigene Faust nach der Wahrheit und einem Weg zur Befreiung (Mokkha) aus dem Kreislauf von Geburt und Tod (Saṃsāra) zu suchen. In dieser pluralistischen und oft polemischen Landschaft, in der Denker von radikalen Materialisten bis hin zu extremen Asketen um Anhänger warben, trat auch Siddhattha Gotama, der Buddha, auf die Bühne – nicht als isolierter Weiser, sondern als aktiver Teilnehmer an den großen Debatten seiner Zeit.
Ein einzigartiges Fenster in diese Welt öffnet die Samaññaphala Sutta („Die Lehrrede über die Früchte des Asketenlebens“), die zweite Rede in der Längeren Sammlung (Dīgha Nikāya) des Pāli-Kanons. Der Text ist nicht nur eine philosophische Abhandlung, sondern auch ein psychologisches Drama mit einem prominenten Protagonisten: König Ajātasattu von Magadha. Seine Suche nach Wahrheit ist keine abstrakte intellektuelle Übung, sondern entspringt tiefem persönlichem Leid. Ajātasattu hatte seinen eigenen Vater, den gerechten König Bimbisāra, ermorden lassen, um den Thron an sich zu reißen, und wird nun von Schuldgefühlen und Furcht zerfressen. In einer mondhellen Nacht, unfähig, Frieden zu finden, stellt er seinen Ministern die verzweifelte Frage: „Gibt es irgendeinen Asketen oder Brahmanen, den wir heute Abend aufsuchen könnten, der meinem Geist Frieden bringen könnte?“
Seine Minister schlagen ihm nacheinander sechs der berühmtesten Lehrer der damaligen Zeit vor, darunter Pūraṇa Kassapa, Makkhali Gosāla und Ajita Kesakambalī. Doch nach jedem Vorschlag verharrt der König in Schweigen, ein Zeichen seiner tiefen Unzufriedenheit mit den Lehren, die ihm bereits bekannt sind. Schließlich willigt er ein, den Buddha zu besuchen. Seine zentrale Frage, die er an all diese Meister richtet, ist von pragmatischer Natur: Was ist die greifbare, in diesem Leben sichtbare „Frucht“ (Phala) des Asketenlebens, vergleichbar mit dem Nutzen, den Handwerker und Berufstätige aus ihrer Arbeit ziehen?
Die Dramaturgie der Sutta ist der Schlüssel zu ihrem philosophischen Gehalt. Ajātasattus Vatermord ist ein extremes Beispiel für eine unheilsame Handlung (Akusala Kamma). Sein daraus resultierendes seelisches Leid ist die unmittelbare Konsequenz (Vipāka) dieser Tat. Die abstrakte Frage nach moralischer Kausalität wird für ihn zu einer brennenden, existenziellen Notwendigkeit. Jede Philosophie, die sein Leid nicht erklären oder ihm einen Weg zur Transformation aufzeigen kann, muss für ihn unbefriedigend bleiben. Dies bereitet die Bühne für die Lehre des Buddha, die sich nicht nur als theoretisch überlegen, sondern als psychologisch wirksam und praktisch anwendbar erweisen wird. Die Geschichte verdeutlicht die hohen Einsätze der philosophischen Debatte: Es geht um nichts Geringeres als die Möglichkeit, mit der eigenen Vergangenheit zu leben und die Zukunft aktiv zu gestalten.
Das Prinzip der Selbstgestaltung: Die buddhistische Lehre von Kamma und Cetanā
Um die revolutionäre Natur der buddhistischen Ethik zu verstehen, muss man zunächst mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen. Das Pāli-Wort Kamma (Sanskrit: Karma) bedeutet wörtlich „Handlung“ oder „Tat“. Es beschreibt kein unabänderliches Schicksal oder eine kosmische Bestrafung durch eine externe Instanz, sondern ein dynamisches, unpersönliches Naturgesetz von Ursache und Wirkung, das durch unsere eigenen Taten in Gang gesetzt wird.
Cetanā: Der Motor von Kamma
Das Herzstück dieser Lehre, das sie von allen anderen abhebt, ist die zentrale Rolle der Absicht. Der Buddha erklärte dies unmissverständlich in einer berühmten Passage: „Cetanāhaṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi. Cetayitvā kammaṃ karoti, kāyena, vācāya, manasā.“ – „Den Willen (die Absicht), ihr Mönche, nenne ich Kamma. Nachdem man gewollt hat, handelt man durch Körper, Rede oder Geist.“ Cetanā – übersetzbar als Absicht, Wille oder Volition – ist der entscheidende geistige Faktor (Cetasika), der den Geist auf ein Ziel ausrichtet und ihn zum Handeln antreibt. Diese absichtsvolle Ausrichtung ist der eigentliche Schöpfer von Kamma. Sie ist keine abstrakte Kraft, sondern ein mentaler Prozess, der in jedem Moment durch unsere sechs Sinneskanäle – die fünf äußeren Sinne und den Geist als inneren Sinn – wirksam wird und unsere Erfahrungen formt. Die Lehre unterscheidet dabei zwischen der einfachen, in jedem Bewusstseinsmoment vorhandenen Intention (Cetanā) und der moralisch bedeutsamen, karmisch wirksamen Absicht (Sañcetanā), die bewusst mit heilsamen oder unheilsamen Qualitäten aufgeladen ist.
Die drei Tore der Handlung und ihre moralische Qualität
Karmisch wirksame Handlungen werden durch drei „Tore“ ausgeführt:
- Körperliche Handlungen (Kāya-Kamma)
- Verbale Handlungen (Vacī-Kamma)
- Geistige Handlungen (Mano-Kamma), wie Wünsche, Gedanken und Absichten.
Die moralische Qualität dieser Handlungen – und damit die Art der Früchte, die sie hervorbringen – hängt ausschließlich von der zugrundeliegenden Absicht ab. Sie werden klassifiziert als:
- Heilsam (Kusala): Handlungen, die in den heilsamen Wurzeln von Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Verblendung (Weisheit) verankert sind. Sie führen zu angenehmen und günstigen Ergebnissen (Vipāka).
- Unheilsam (Akusala): Handlungen, die in den unheilsamen Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung wurzeln. Sie führen zu leidvollen und ungünstigen Ergebnissen.
- Neutral (kammisch neutral): Handlungen ohne starke moralische Färbung, wie das Gehen oder das Schneiden von Gemüse, die keine signifikanten zukünftigen Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Betonung von Cetanā stellt eine radikale Verinnerlichung der ethischen Verantwortung dar. Im Gegensatz zum brahmanischen Ritualismus, bei dem die korrekte Ausführung einer äußeren Zeremonie zählte, oder zu fatalistischen Lehren, die jegliche Handlung für bedeutungslos erklärten, verlegt der Buddha das moralische Zentrum des Universums direkt in den menschlichen Geist. Dies ist eine Botschaft der Ermächtigung: Der Mensch ist nicht das Opfer von Schicksal, göttlicher Willkür oder sozialen Umständen, sondern der Architekt seines eigenen Lebens. Die Zukunft ist kein geschriebenes Buch; sie wird in jedem Augenblick durch die Qualität unserer Absichten neu geschaffen. Genau hier liegt die Grundlage für die Möglichkeit der Befreiung (Nibbāna). Wenn Leid durch unheilsame Absichten entsteht, kann es durch die Kultivierung heilsamer Absichten beendet werden. Dies schafft das Fundament für den gesamten buddhistischen Weg der Ethik (Sīla), der geistigen Sammlung (Samādhi) und der Weisheit (Paññā) – genau jenen Weg, den der Buddha König Ajātasattu als Antwort auf seine quälende Frage aufzeigen wird.
Die Lehren der Verneinung: Fatalismus, Materialismus und Amoralismus
Die Samaññaphala Sutta stellt die Lehre des Buddha in direkten Kontrast zu den damals populären Weltanschauungen. Die Antworten der anderen Meister auf die Frage des Königs offenbaren Philosophien, die dem gequälten Herrscher keine Hoffnung und keinen gangbaren Weg bieten konnten.
3.1. Makkhali Gosāla und der Fatalismus (Niyativāda)
Makkhali Gosāla, der Anführer der Ājīvika-Schule, vertrat eine Lehre des radikalen Determinismus, des Niyativāda (Lehre vom Schicksal). Seine zentrale These war, dass es keine Ursache (Ahetu) und keine Bedingung (Appaccayā) für die Läuterung oder Verderbtheit der Lebewesen gibt. Alles ist durch eine unpersönliche, kosmische Notwendigkeit oder ein Schicksal (Niyati) vorherbestimmt.
- Leugnung des freien Willens: Menschliche Anstrengung, Wille und Tatkraft (Purisakāra) sind nach Gosāla eine Illusion. Alle Wesen sind machtlos. Ihre Erfahrungen von Freude und Leid sind wie mit einem Messbecher vorab bemessen und unabänderlich.
- Automatische Erlösung: Die Befreiung ist kein Ziel, das durch spirituelle Praxis erreicht wird, sondern ein automatischer Prozess. Alle Lebewesen durchlaufen einen festen, unendlich langen Zyklus von Wiedergeburten, bis sie ihr vorbestimmtes Kontingent an Erfahrungen erschöpft haben. Gosāla verwendete das berühmte Gleichnis eines Fadenknäuels, das sich abwickelt, bis der Faden zu Ende ist. Nach einer festgelegten Anzahl von Zeitaltern werden alle Wesen – die Weisen ebenso wie die Toren – automatisch „dem Leid ein Ende machen“.
- Ethische Implikation: Moralische Anstrengung ist sinnlos. Jedes Bemühen um ethische Läuterung ist vergeblich, da der Lauf der Dinge ohnehin unabänderlich feststeht.
3.2. Ajita Kesakambalī und der Materialismus (Ucchedavāda)
Ajita Kesakambalī, dessen Beiname „der mit der Decke aus Menschenhaar“ auf seine extreme Askese hindeutet, predigte eine Lehre des reinen Materialismus und der Auslöschung nach dem Tod, bekannt als Ucchedavāda (Lehre von der Vernichtung).
- Ablehnung von Jenseits und Moral: Ajita lehrte, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, keine Früchte oder Resultate von guten und schlechten Taten (Kamma-Vipāka) und dass Almosen, Opfer und Gebete wertlos sind.
- Der Mensch als Materie: Ein Mensch besteht lediglich aus den vier großen Elementen: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Mit dem Tod kehrt die Erde zur Erde zurück, das Wasser zum Wasser, die Hitze zum Feuer, der Wind zur Luft, und die Sinnesfähigkeiten lösen sich im Raum auf. Die Vorstellung einer Seele, die den Körper überdauert, wird als Illusion zurückgewiesen; Seele und Körper sind identisch (Taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ). Seine Lehre gipfelt in dem Satz: „Toren wie Weise werden mit der Auflösung des Körpers abgeschnitten, vernichtet und sind nach dem Tode nicht mehr.“
- Ethische Implikation: Da es keine Konsequenzen jenseits des Todes gibt, ist die Rede von Moral eine „Lehre der Toren“, eine „leere Lüge“. Diese Weltsicht legt einen Hedonismus nahe oder führt zumindest zu völliger moralischer Gleichgültigkeit.
3.3. Pūraṇa Kassapa und der Amoralismus (Akiriyavāda)
Pūraṇa Kassapa vertrat die wohl radikalste Form der ethischen Verneinung: den Akiriyavāda, die Lehre von der Nicht-Wirksamkeit oder Nicht-Tat. Seine Philosophie besagt, dass Handlungen an sich keine moralische Qualität besitzen.
- Leugnung von Verdienst und Schuld: Pūraṇa erklärte, dass selbst die großzügigsten Taten, wie das Geben von Almosen am Ufer des Ganges, kein Verdienst (Puñña) erzeugen. Umgekehrt würde selbst die grausamste Tat – würde man mit einer rasiermesserscharfen Scheibe alle Lebewesen der Erde zu einem einzigen Fleischhaufen machen – kein Übel oder keine Schuld (Pāpa) nach sich ziehen.
- Die handlungsneutrale Tat: Der Körper mag handeln, aber diese physischen Akte erzeugen keine moralischen Konsequenzen für ein dahinterstehendes „Selbst“ oder eine „Seele“.
- Ethische Implikation: Die Konzepte von „Gut“ und „Böse“ sind reine soziale Konventionen ohne jede objektive Realität. Diese Sichtweise zerschneidet die Verbindung zwischen Tat und Folge vollständig und entzieht jeder Form von Ethik die Grundlage.
Obwohl sich diese drei Lehren in ihren metaphysischen Annahmen unterscheiden, bilden sie eine geschlossene Front gegen die Möglichkeit eines sinnvollen spirituellen Weges. Sie repräsentieren ein Spektrum des Nihilismus, das für den Buddha der eigentliche Gegner war: die Leugnung der Wirksamkeit von Handlungen (Kiriyavāda). Der Fatalismus leugnet die Wirksamkeit der Tat, der Materialismus ihre Konsequenz über den Tod hinaus und der Amoralismus ihre moralische Qualität. Alle drei Wege münden in derselben Sackgasse: ethische Lähmung und existenzielle Hoffnungslosigkeit. Für einen Mann wie Ajātasattu, der unter der Last einer schrecklichen Tat litt, waren diese Lehren ein Schlag ins Gesicht. Sie boten ihm entweder die kalte Versicherung, dass seine Tat bedeutungslos war, oder die grausame Gewissheit, dass sie ein unabänderlicher Teil seines Schicksals war – aber keine der Lehren bot ihm einen Weg zur Heilung oder Transformation.
Vergleichende Analyse: Die Implikationen der Weltbilder
Die Gegenüberstellung der buddhistischen Lehre mit den drei nihilistischen Strömungen offenbart unüberbrückbare Gegensätze in der Auffassung von Realität, Ethik und menschlichem Potenzial. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist die Frage der moralischen Kausalität. Die Lehre des Buddha ist ein Kammavāda (eine Lehre von der Handlung) und ein Kiriyavāda (eine Lehre von der Wirksamkeit der Handlung) und steht damit im scharfen Widerspruch zum Akiriyavāda des Pūraṇa, zum Ahetukavāda (Lehre von der Ursachlosigkeit) des Makkhali und zum Ucchedavāda des Ajita.
Die folgende Tabelle fasst die zentralen Unterschiede der vier Weltbilder zusammen:
| Kriterium | Buddhistisches Kamma (Kammavāda) | Fatalismus (Niyativāda) | Materialismus (Ucchedavāda) | Amoralismus (Akiriyavāda) |
|---|---|---|---|---|
| Grundprinzip | Absichtsvolle Handlung (Cetanā) formt die Zukunft. | Alles ist durch Schicksal (Niyati) vorbestimmt. | Nur Materie existiert; Auslöschung nach dem Tod. | Handlungen haben keine moralische Wirkung. |
| Urheber der Lehre | Siddhattha Gotama (der Buddha) | Makkhali Gosāla | Ajita Kesakambalī | Pūraṇa Kassapa |
| Freier Wille? | Ja, durch bewusste Absicht und Kultivierung des Geistes. | Nein, Anstrengung ist sinnlos. | Ja, aber ohne transzendente Konsequenz. | Irrelevant, da Handlungen keine Folgen haben. |
| Moralische Kausalität? | Ja, heilsame/unheilsame Taten haben Folgen (Vipāka). | Nein, alles ist vorbestimmt, nicht durch Taten verursacht. | Nein, es gibt keine Folgen nach dem Tod. | Nein, es gibt weder Gutes noch Böses. |
| Leben nach dem Tod? | Ja, Wiedergeburt im Saṃsāra bis zur Befreiung. | Ja, aber als Teil eines festen, automatischen Zyklus. | Nein. | Die Frage wird als irrelevant betrachtet. |
| Ziel des Lebens | Befreiung (Nibbāna) durch Ethik, Sammlung und Weisheit. | Automatisches Erreichen der Erlösung nach Ablauf des Zyklus. | Genuss des Lebens, da es kein Jenseits gibt. | Kein spezifisches Ziel, da Handeln wirkungslos ist. |
| Implikation für Ajātasattu | Sein Verbrechen hat schwere Folgen, aber er kann durch Einsicht und heilsames Handeln einen neuen Weg einschlagen. | Sein Verbrechen war unausweichlich und er kann nichts dagegen tun. | Sein Verbrechen ist bedeutungslos, da nach dem Tod alles endet. | Sein Verbrechen war weder gut noch böse. |
Die Widerlegung dieser Lehren durch den Buddha ist von bemerkenswerter Raffinesse. Er weist sie nicht nur pauschal zurück, sondern greift ihre Begrifflichkeit auf, um die Debatte neu zu rahmen. So erklärt er beispielsweise, dass auch er ein Akiriyavādin sei – in dem Sinne, dass er die Nicht-Handlung (Akiriyā) in Bezug auf unheilsame Taten lehre. Er sei auch ein Ucchedavādin – in dem Sinne, dass er die Vernichtung (Uccheda) von Gier, Hass und Verblendung lehre. Diese rhetorische Strategie zeigt nicht nur eine tiefe Auseinandersetzung mit den gegnerischen Positionen, sondern demonstriert auch deren überlegene Interpretation im Rahmen seiner eigenen Lehre. Damit positioniert der Buddha seine Lehre als einen „Mittleren Weg“, nicht nur zwischen den Extremen von Askese und Genusssucht, sondern auch zwischen den philosophischen Extremen des Eternalismus (Sassatavāda) – der Annahme einer ewigen, unveränderlichen Seele, die oft im Fatalismus mitschwingt – und des Annihilationismus (Ucchedavāda). Die Lehre vom Kamma bekräftigt die Kontinuität des Lebens und die moralische Konsequenz (gegen den Annihilationismus), verneint aber die Existenz eines ewigen, unveränderlichen Selbst (Attā), das von Leben zu Leben wandert (gegen den Eternalismus). Der „Täter“ der Handlung und der „Empfänger“ der Frucht sind weder exakt dieselbe Person noch völlig verschiedene, sondern Teile eines sich ständig wandelnden, aber kausal verbundenen Bewusstseinsstroms. Diese nuancierte Position ermöglicht beides: moralische Verantwortung für das eigene Handeln und die letztendliche Möglichkeit der Befreiung, ein Ziel, das in den anderen Systemen unerreichbar bleibt.
Fazit: Kamma als befreiendes Handlungsprinzip
Die buddhistische Lehre von Kamma ist im Kern eine Lehre der Befreiung und der radikalen Selbstermächtigung. Sie legt den Schlüssel zur Gestaltung der eigenen Zukunft direkt in die Hände des Individuums. Sie ist kein Aufruf zur Unterwerfung unter ein Schicksal, sondern ein Aufruf zum bewussten, ethischen Handeln. Dies wird am Ende der Samaññaphala Sutta eindrücklich demonstriert. Nachdem König Ajātasattu der detaillierten Darlegung des buddhistischen Pfades durch den Buddha gelauscht hat – beginnend mit ethischem Verhalten (Sīla), das zu geistiger Ruhe (Samādhi) und schließlich zu befreiender Weisheit (Paññā) führt –, ist er zutiefst bewegt. Er nimmt Zuflucht zum Buddha, seiner Lehre und der Gemeinschaft. Und dann geschieht das Entscheidende: Er bekennt seine schreckliche Tat. „Eine Übertretung hat mich überwältigt, da ich so töricht war […], meinen Vater zu töten […]. Möge der Erhabene mein Bekenntnis als solches annehmen, zur zukünftigen Zügelung.“
Die Antwort des Buddha ist die praktische Anwendung der Kamma-Lehre. Er nimmt das Bekenntnis an und sagt: „Wahrlich, o König, eine Übertretung hat dich überwältigt […]. Da du aber, o König, deine Übertretung als solche erkannt und sie wiedergutgemacht hast, nehmen wir dein Bekenntnis an. Denn dies ist ein Fortschritt in der Disziplin der Edlen, wenn man eine Übertretung als solche erkennt, sie wiedergutmacht und für die Zukunft Zurückhaltung übt.“ In diesem Moment wird die befreiende Kraft der Lehre greifbar. Sie zeigt zweierlei:
- Handlungen haben Konsequenzen: Der Buddha bemerkt später zu seinen Mönchen, dass der Vatermord den König daran gehindert hat, noch an Ort und Stelle die erste Stufe der Erleuchtung zu erlangen. Die karmische Frucht der Tat bleibt wirksam.
- Diese Konsequenzen sind kein eisernes Schicksal: Der Akt des aufrichtigen Bereuens und Bekennens ist selbst eine neue, heilsame Handlung (Kamma). Es ist der erste Schritt, um die eigene Lebensbahn zu verändern.
Die Geschichte endet mit dem Beweis, dass die „Frucht des Asketenlebens“ nicht nur eine ferne Belohnung ist, sondern die unmittelbare Möglichkeit, selbst aus der tiefsten Dunkelheit heraus Frieden und einen gangbaren Weg nach vorn zu finden. Die Lehre des Buddha vom Kamma gab dem gequälten König das, was Fatalismus, Materialismus und Amoralismus ihm verweigerten: einen Grund und eine Methode für sinnvolles, transformatives Handeln. Sie war die ultimative Antwort auf seine verzweifelte Suche.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
- Alois Payer: Karma und Wiedergeburt – Die akademische Referenz. Payer schlüsselt präzise auf, wie der Buddha den Kamma-Begriff der Brahmanen (rituelle Handlung) radikal umdeutete zu einer Ethik des Willens (Cetanā): „Den Willen, ihr Mönche, nenne ich das Wirken.“
- Uni Hamburg: Karma in der Geschichte (PDF) – Dieser Text grenzt die buddhistische Sicht gegen den Fatalismus (Niyati) der damaligen Ajivika-Schule ab. Er zeigt: Karma ist kein unabänderliches Schicksal, sondern ein dynamischer Prozess, der hier und jetzt beeinflusst werden kann.
- Bernd Golz: Wozu Dhamma? (PDF) – Ein moderner Zugang zum Thema Schicksal: Der Text erklärt, wie wir durch Achtsamkeit aus dem „Hamsterrad“ unbewusster Reaktionen (altes Karma) aussteigen und Freiheit im jetzigen Moment gewinnen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Der Mittlere Weg: Majjhimā Paṭipadā als Antwort auf Extreme
Wie findest du den richtigen Weg zur Erkenntnis? Der Buddha lehrte, dass weder exzessiver Genuss noch schmerzhafte Askese zum Ziel führen. Tauche ein in die Lehre vom Mittleren Weg – einem Pfad der Weisheit und Balance, der dir zeigt, wie du die Extreme des Lebens meisterst und einen klaren Geist kultivierst.







