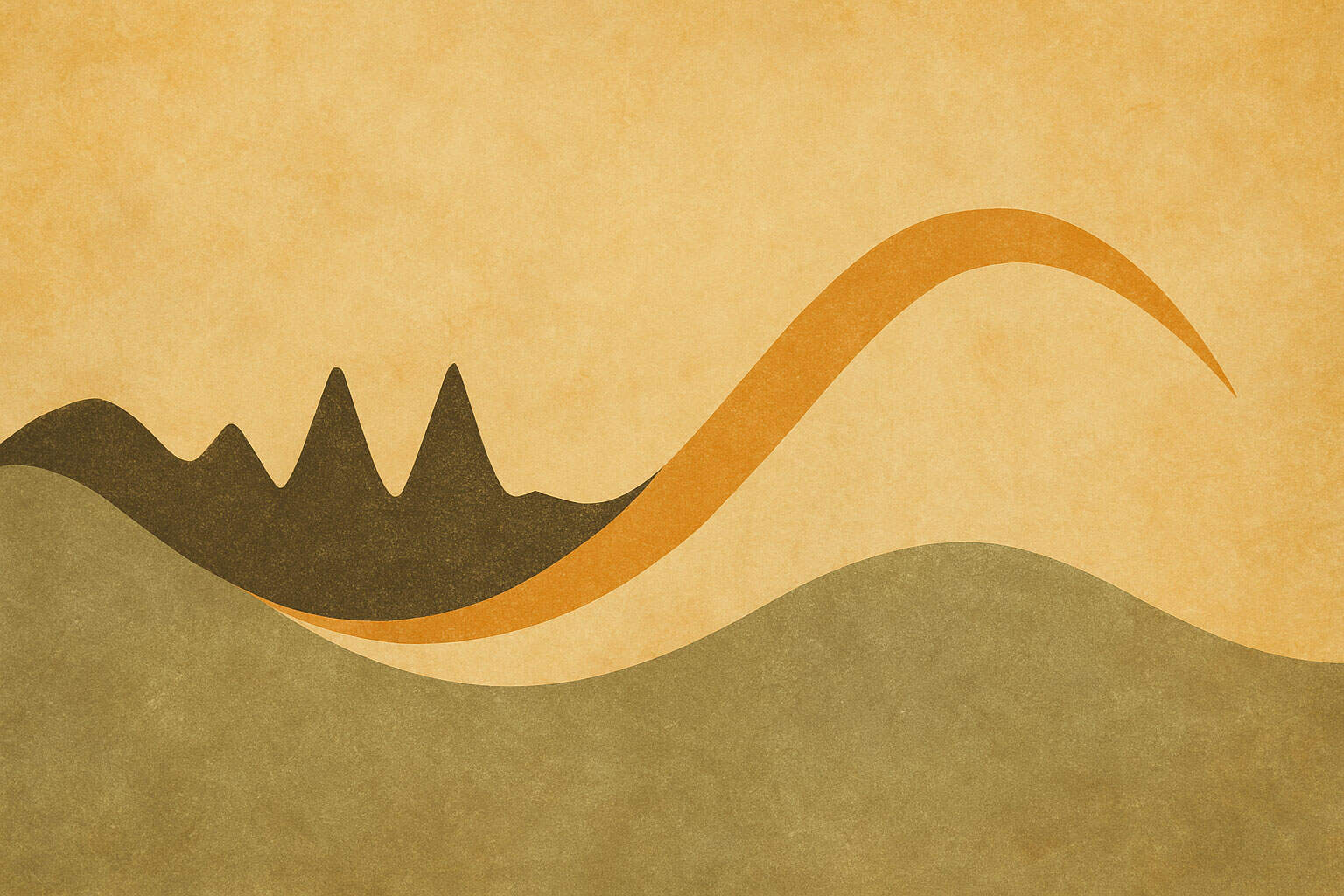
Vedanānupassanā: Achtsamkeit auf Empfindungen im Lichte der Lehrreden des Buddha
Die zweite Grundlage der Achtsamkeit (Satipaṭṭhāna) verstehen und kultivieren
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Vedanānupassanā – Den Empfindungen achtsam begegnen
- Was ist Vedanā? Die Natur der Empfindung im Buddhismus
- Vedanānupassanā: Die Kultivierung der Achtsamkeit auf Empfindungen
- Im Kontext: Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipaṭṭhāna)
- Zentrale Lehrreden (Suttas) zu Vedanā und Vedanānupassanā
- Zusammenfassung und Praktische Relevanz
- Quellen, Referenzen & weiterführende Webseiten
Einleitung: Vedanānupassanā – Den Empfindungen achtsam begegnen
Im Herzen der buddhistischen Lehre und Praxis steht die Kultivierung von Achtsamkeit (Sati) und Einsicht (Vipassanā) als Weg zur Befreiung vom Leiden (Dukkha). Dieser Pfad basiert nicht auf blindem Glauben, sondern auf der direkten, erforschenden Untersuchung des eigenen Körpers und Geistes. Ein zentraler Aspekt dieser inneren Erforschung ist die Vedanānupassanā, die Achtsamkeit auf Empfindungen oder Gefühlstöne. Sie bildet eine der vier fundamentalen Säulen der Achtsamkeitspraxis, bekannt als die vier Satipaṭṭhāna (Grundlagen der Achtsamkeit).
Das bewusste Wahrnehmen und Verstehen unserer Empfindungen ist von entscheidender Bedeutung, da sie oft der Dreh- und Angelpunkt für unsere Reaktionen auf die Welt sind. Unbeachtet und unreflektiert führen angenehme Empfindungen leicht zu Gier und Anhaften, unangenehme zu Abneigung und Hass, und neutrale zu Verblendung und Gleichgültigkeit. Die Praxis der Vedanānupassanā bietet einen Weg, diese automatischen Reaktionsmuster zu erkennen und zu durchbrechen.
Dieser Beitrag zielt darauf ab, den Pāli-Begriff Vedanānupassanā klar zu definieren und seine Bedeutung im Kontext des frühen Buddhismus zu erläutern. Er wird den verwandten Begriff Vedanā (Empfindung) erklären und die Rolle der Vedanānupassanā innerhalb des umfassenderen Rahmens der Satipaṭṭhāna beleuchten. Darüber hinaus werden zentrale Lehrreden (Suttas) aus dem Pāli-Kanon vorgestellt, die dieses Thema schwerpunktmäßig behandeln, um dir einen fundierten Zugang zu den Originalquellen zu ermöglichen.
Was ist Vedanā? Die Natur der Empfindung im Buddhismus
Der Pāli-Begriff Vedanā (Sanskrit: वेदना) wird oft mit „Gefühl“ oder „Empfindung“ übersetzt. Im buddhistischen Kontext bezeichnet er jedoch etwas sehr Spezifisches: den grundlegenden affektiven Ton oder die Qualität einer Erfahrung – wie sie sich unmittelbar anfühlt, noch bevor komplexere emotionale oder kognitive Bewertungen stattfinden. Vedanā ist die direkte, registrierende Empfindung, die entsteht, wenn eines unserer sechs Sinnesorgane (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist) mit einem entsprechenden Sinnesobjekt (Form, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung, Gedankenobjekt) in Kontakt tritt und Bewusstsein (Viññāṇa) vorhanden ist.
Es ist entscheidend, Vedanā von dem zu unterscheiden, was wir im Alltag oft als „Emotion“ bezeichnen. Während Emotionen wie Freude, Trauer, Wut oder Eifersucht komplexere mentale Zustände sind, die oft aus Vedanā hervorgehen, aber zusätzliche gedankliche Bewertungen, Erinnerungen und Handlungsimpulse beinhalten, ist Vedanā die „nackte affektive Qualität“ der Erfahrung selbst – ihr reiner Gefühlston.
Dieser Fokus auf den grundlegenden Gefühlston ist für die buddhistische Praxis von strategischer Bedeutung. Im Prozess des Bedingten Entstehens (Paṭiccasamuppāda), der Kette von Ursache und Wirkung, die zum Leiden führt, wird Vedanā als die unmittelbare Bedingung für das Entstehen von Verlangen oder Durst (Taṇhā) identifiziert. Angenehme Empfindungen führen zu Verlangen nach mehr, unangenehme zu Verlangen nach Beseitigung (Abneigung), und neutrale können zu subtilem Anhaften oder Verblendung führen. Indem die Achtsamkeitspraxis auf die Beobachtung der rohen Vedanā abzielt, bevor sie sich zu voll ausgeprägten emotionalen Reaktionen und Verlangen verfestigt, bietet sie die Möglichkeit, die Kette der Leidensentstehung an einer fundamentalen Stelle zu unterbrechen. Man lernt, den Gefühlston wahrzunehmen, ohne automatisch darauf mit Gier oder Hass zu reagieren.
Die buddhistischen Texte klassifizieren Vedanā primär nach ihrer Qualität in drei Arten:
- Sukha Vedanā: Angenehme Empfindung.
- Dukkha Vedanā: Unangenehme, schmerzhafte Empfindung.
- Adukkhamasukha Vedanā: Neutrale, weder-angenehme-noch-unangenehme Empfindung.
Darüber hinaus gibt es detailliertere Einteilungen, die die Tiefe der buddhistischen Analyse verdeutlichen. Vedanā kann nach den sechs Sinnesgrundlagen unterschieden werden, durch die sie entsteht (Empfindung durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Denken). Sie kann auch als körperlich (kāyika) oder geistig (cetasika) klassifiziert werden, oder danach, ob sie mit weltlichen Dingen verbunden ist (sāmisa, z. B. Freude an Sinnesobjekten) oder nicht-weltlich ist (nirāmisa, z. B. die Freude an der Meditation oder Loslösung).
Die zentrale Bedeutung von Vedanā wird auch dadurch unterstrichen, dass sie eines der fünf Aggregate (Khandhas) ist – jene grundlegenden Bestandteile (Form, Empfindung, Wahrnehmung, Geistesformationen, Bewusstsein), aus denen sich unsere gesamte Erfahrung und das konventionelle Gefühl eines „Selbst“ zusammensetzt. Das Verständnis von Vedanā ist somit untrennbar mit dem Verständnis der menschlichen Erfahrung und der Natur des Selbst verbunden.
Vedanānupassanā: Die Kultivierung der Achtsamkeit auf Empfindungen
Vedanānupassanā bedeutet wörtlich „Betrachtung der Empfindungen“ oder „Achtsamkeit auf Empfindungen“. Es ist die spezifische Meditationspraxis, bei der die Aufmerksamkeit auf das unmittelbare Erleben von Empfindungen gerichtet wird, so wie sie von Moment zu Moment entstehen und vergehen. Das Ziel ist es, die auftretenden Gefühlstöne – angenehm, unangenehm oder neutral – klar zu erkennen und zu beobachten, ohne sich mit ihnen zu identifizieren, sie zu bewerten, an ihnen festzuhalten oder sie abzulehnen.
In der Praxis bedeutet dies, dass der Meditierende, wenn eine Empfindung auftritt, diese einfach zur Kenntnis nimmt und benennt: „Eine angenehme Empfindung ist entstanden“, „Eine unangenehme Empfindung ist entstanden“, „Eine neutrale Empfindung ist entstanden“. Diese Beobachtung geschieht, wie in den Satipaṭṭhāna-Suttas beschrieben, mit Eifer oder anhaltender Bemühung (Ātāpī), klarem Verstehen (Sampajāno) und Achtsamkeit (Satimā), nachdem Gier und Abneigung in Bezug auf die Welt überwunden oder zumindest beiseitegestellt wurden (vineyya loke abhijjhādomanassaṁ).
Die Zielsetzung dieser Praxis ist vielschichtig:
- Entwicklung von Nicht-Reaktivität: Der Kern der Übung liegt darin, die tief verwurzelten, gewohnheitsmäßigen Reaktionen auf Empfindungen zu durchbrechen. Anstatt automatisch mit Begehren (Rāga) auf Angenehmes, mit Abneigung (Paṭigha) auf Unangenehmes oder mit Unwissenheit und Verblendung (Avijjā bzw. Moha) auf Neutrales zu reagieren, lernt der Übende, die Empfindung als das zu sehen, was sie ist – ein vorübergehendes Phänomen. Es geht darum, die „zugrundeliegenden Neigungen“ (Anusaya) zu Gier, Hass und Verblendung, die durch Empfindungen genährt werden, zu erkennen und schrittweise aufzugeben.
- Entwicklung von Einsicht (Vipassanā): Durch die kontinuierliche, nicht wertende Beobachtung offenbart sich die wahre Natur der Empfindungen. Man erkennt ihre Vergänglichkeit (Anicca) – keine Empfindung, egal wie intensiv, bleibt bestehen; sie entstehen und vergehen unaufhörlich. Man erkennt ihre letztendliche Unbefriedigendheit oder Leidhaftigkeit (Dukkha) – selbst angenehme Empfindungen sind unbeständig und können bei Verlust zu Leiden führen, während unangenehme Empfindungen direkt leidhaft sind. Man erkennt ihre Unpersönlichkeit oder Nicht-Selbst-Natur (Anattā) – Empfindungen sind bedingt entstehende Phänomene, keine inhärenten Eigenschaften eines festen „Ich“ oder „Selbst“. Die Praxis beinhaltet das klare Sehen des Entstehens (Samudaya) und Vergehens (Vaya) der Empfindungen.
- Förderung der Loslösung: Das ultimative Ziel ist es, eine Haltung der Unabhängigkeit und des Nicht-Anhaftens zu kultivieren. Der Übende verweilt „unabhängig und haftet an nichts in der Welt an“ (anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati). Dies schließt das Nicht-Anhaften an die Empfindungen selbst ein.
Die Praxis der Vedanānupassanā geht über die reine Modifikation von Reaktionen hinaus; sie zielt auf eine grundlegende Dekonstruktion der Art und Weise, wie wir uns selbst erleben. Da Vedanā eines der fünf Aggregate (Khandhas) ist, die unser konventionelles Selbstgefühl konstituieren, untergräbt die Erkenntnis ihrer unpersönlichen und vergänglichen Natur die Illusion eines festen, dauerhaften „Ich“, das fühlt. Die Identifikation – „Ich fühle angenehm“, „Ich leide“ – ist eine Hauptquelle des Leidens. Durch die achtsame Beobachtung wird diese Identifikation geschwächt. Man lernt zu sehen, „dass da Empfindung ist“ (atthi vedanā’ti), lediglich als ein Teil des erfahrbaren Phänomenspektrums, nur zum Zweck des Wissens und der fortgesetzten Achtsamkeit. Dies führt zu einer tiefgreifenden Veränderung der Perspektive und reduziert das Leiden, das aus der Ich-Identifikation mit flüchtigen Empfindungen entsteht.
Im Kontext: Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipaṭṭhāna)
Vedanānupassanā steht nicht isoliert, sondern ist integraler Bestandteil eines umfassenderen Systems der Achtsamkeitsschulung, das als die vier Satipaṭṭhāna bekannt ist. Der Buddha bezeichnete diese vier Grundlagen der Achtsamkeit als den „einzigen“ oder „direkten Weg“ (Ekāyano Maggo) zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges und zur Verwirklichung von Nibbāna.
Die vier Bereiche, auf die die Achtsamkeit systematisch gerichtet wird, umfassen die gesamte menschliche Erfahrung:
- Betrachtung des Körpers (Kāyānupassanā): Achtsamkeit auf körperliche Prozesse wie die Atmung, die vier Körperhaltungen (Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen), alltägliche Aktivitäten, die anatomische Zusammensetzung des Körpers, die vier Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft) und die Vergänglichkeit des Körpers (Kontemplation über Leichenstadien).
- Betrachtung der Empfindungen (Vedanānupassanā): Achtsamkeit auf das Entstehen und Vergehen von angenehmen, unangenehmen und neutralen Empfindungen, wie zuvor beschrieben.
- Betrachtung des Geistes (Cittānupassanā): Achtsamkeit auf den momentanen Zustand des Bewusstseins oder Geistes (Citta). Dies beinhaltet das Erkennen, ob der Geist gerade von Gier, Hass oder Verblendung erfasst oder frei davon ist; ob er gesammelt oder zerstreut, entwickelt oder unentwickelt, übertreffbar oder unübertrefflich, konzentriert oder unkonzentriert, befreit oder unbefreit ist.
- Betrachtung der Geistesobjekte (Dhammānupassanā): Achtsamkeit auf die Erfahrungsinhalte im Licht zentraler buddhistischer Lehrkategorien (Dhammas). Dies umfasst die Beobachtung des Geistes in Bezug auf die fünf Hindernisse (Sinnesbegehren, Übelwollen, Trägheit und Mattheit, Ruhelosigkeit und Sorge, Zweifel), die fünf Aggregate des Anhaftens, die sechs inneren und äußeren Sinnesgrundlagen, die sieben Erleuchtungsglieder und die vier Edlen Wahrheiten.
Vedanānupassanā nimmt als zweite Grundlage eine Schlüsselposition ein. Sie fokussiert auf die affektive Färbung der Erfahrung, die oft als entscheidendes Bindeglied zwischen der reinen Wahrnehmung eines Objekts und der darauffolgenden mentalen oder emotionalen Reaktion fungiert.
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese vier Grundlagen keine voneinander getrennten, isolierten Übungsfelder sind, sondern ein integriertes System bilden, dessen Teile sich gegenseitig unterstützen und durchdringen. Körperliche Empfindungen, die im Rahmen der Kāyānupassanā beobachtet werden (z. B. Schmerz beim Sitzen), sind oft direkt mit einer angenehmen, unangenehmen oder neutralen Vedanā verbunden. Die Geisteszustände (Citta), die bei der Cittānupassanā erkannt werden (z. B. Gier oder Ärger), sind häufig unmittelbare Reaktionen auf erlebte Vedanā. Das tiefere Verständnis der Natur von Vedanā als vergänglich, leidhaft und nicht-selbst ist wiederum Teil der Dhammānupassanā, insbesondere im Kontext der fünf Aggregate und des Bedingten Entstehens. Umgekehrt kann die Praxis der Achtsamkeit auf den Atem (Kāyānupassanā) helfen, den Geist zu beruhigen und zu sammeln, was eine klarere und stabilere Beobachtung der subtileren Empfindungen (Vedanā) erst ermöglicht. Vedanānupassanā entfaltet ihre volle transformative Kraft somit im Zusammenspiel mit den anderen drei Grundlagen der Achtsamkeit.
Zentrale Lehrreden (Suttas) zu Vedanā und Vedanānupassanā
Der Pāli-Kanon enthält zahlreiche Lehrreden, die sich mit Empfindungen und deren achtsamer Betrachtung befassen. Einige der wichtigsten Quellen werden im Folgenden vorgestellt:
Die Satipaṭṭhāna-Suttas (DN 22 & MN 10)
Diese beiden Lehrreden sind die wohl bekanntesten und grundlegendsten Texte zur Praxis der Achtsamkeitsmeditation im gesamten Pāli-Kanon. Sie bieten eine detaillierte und systematische Anleitung zu den vier Grundlagen der Achtsamkeit.
- DN 22: Mahāsatipaṭṭhāna-Sutta – „Die Große Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit“. Diese Version, enthalten in der „Langen Sammlung“ (Dīgha-Nikāya), ist nahezu identisch mit MN 10, enthält jedoch im Abschnitt über die Geistesobjekte (Dhammānupassanā) eine ausführlichere Darlegung der Vier Edlen Wahrheiten.
- MN 10: Satipaṭṭhāna-Sutta – „Die Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit“. Diese Version aus der „Mittleren Sammlung“ (Majjhima-Nikāya) gilt oft als die ursprüngliche Form. Gebräuchliche deutsche Titel für beide Suttas sind oft „Die Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit“ oder „Die Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit“.
Beide Suttas widmen der Vedanānupassanā einen eigenen Abschnitt. Darin wird präzise angeleitet, wie man angenehme, unangenehme und neutrale Empfindungen erkennt, sobald sie auftreten. Es wird auch zwischen weltlichen (mit Sinnesobjekten verbundenen) und nicht-weltlichen (mit der Praxis verbundenen) Empfindungen unterschieden. Die Standardformel für die Achtsamkeitspraxis – „er verweilt… eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat“ (ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṁ) – wird hier angewendet. Ein zentraler Aspekt ist die Beobachtung des Entstehens und Vergehens der Empfindungen, um ihre Vergänglichkeit direkt zu erfahren.
Das Vedanā-Saṃyutta (SN 36)
Das 36. Kapitel (Saṃyutta) der „Gruppierten Sammlung“ (Saṃyutta-Nikāya) ist vollständig dem Thema Vedanā gewidmet. Es versammelt eine Vielzahl kürzerer Lehrreden, die Empfindungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Ein gebräuchlicher deutscher Titel ist „Die Gruppierte Sammlung über Empfindungen“ oder „Die Lehrreden über Gefühl“.
- Beispielhaftes Sutta: SN 36.6 – Sallasutta („Die Lehrrede vom Pfeil“) Dieses besonders eindrückliche Sutta illustriert den Unterschied im Umgang mit schmerzhaften Empfindungen zwischen einem gewöhnlichen, ungeschulten Menschen (Puthujjana) und einem edlen, geschulten Schüler (Ariyasāvaka). Beide erfahren den unvermeidlichen „ersten Pfeil“ – den körperlichen Schmerz oder die unangenehme Empfindung selbst. Der ungeschulte Mensch jedoch fügt sich durch seine Reaktion darauf – durch Widerstand, Klagen, Sorge und Verzweiflung – selbst einen „zweiten Pfeil“ zu: das geistige Leiden. Der geschulte Schüler hingegen, der Vedanā mit Achtsamkeit und Gleichmut begegnet, erfährt zwar den ersten Pfeil, bleibt aber vom zweiten Pfeil des selbstgemachten Leids verschont. Dieses Sutta verdeutlicht meisterhaft das Ziel der Vedanānupassanā: nicht die unmögliche Aufgabe, alle unangenehmen Empfindungen zu vermeiden, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, nicht mit zusätzlichem geistigen Leid darauf zu reagieren.
- Weitere Themen in SN 36: Das Saṃyutta behandelt auch die Vergänglichkeit aller Empfindungen, die Gefahr, in den „Abgrund“ des Leidens zu stürzen, wenn man auf schmerzhafte Empfindungen mit Verzweiflung reagiert, die Notwendigkeit, die zugrundeliegenden Neigungen zu Gier, Hass und Unwissenheit aufzugeben, die verschiedenen Arten von Empfindungen, die wie unterschiedliche Winde im Körper aufsteigen, und die Beziehung zwischen Empfindung und meditativer Sammlung (Samādhi).
Eine relevante Lehrrede im Aṅguttara-Nikāya (AN)
Die „Angereihte Sammlung“ (Aṅguttara-Nikāya) ist nach einem numerischen Prinzip aufgebaut und enthält viele Lehrreden, die sich direkt an Laien und Mönche richten und praktische Aspekte des Pfades beleuchten.
- Empfohlenes Sutta: AN 6.63 – Nibbedhika-Sutta („Die Durchdringende Lehrrede“) Dieses Sutta bietet eine tiefgehende, analytische Untersuchung von sechs zentralen Themen des Dhamma: Sinnenfreuden (Kāma), Empfindungen (Vedanā), Wahrnehmungen (Saññā), Triebe/Befleckungen (Āsava), Handlung/Karma (Kamma) und Leiden (Dukkha). Jedes dieser Themen wird systematisch unter sechs Gesichtspunkten analysiert: Was ist es? Was ist seine Ursache/sein Ursprung (Nidānasambhavo)? Was ist seine Vielfalt (Vemattatā)? Was ist seine Frucht/Wirkung (Vipāko)? Was ist seine Aufhebung (Nirodho)? Was ist der Pfad, der zu seiner Aufhebung führt (Nirodhagāminī Paṭipadā)? In Bezug auf Vedanā liefert dieses Sutta eine klare Struktur: Die Ursache der Empfindung ist der Kontakt (Phassa) zwischen Sinnesorgan und Objekt. Ihre Vielfalt besteht in den drei Arten (angenehm, unangenehm, neutral). Ihre Frucht ist, dass sie zu entsprechenden Daseinsformen beiträgt (je nachdem, ob sie mit heilsamen oder unheilsamen Geisteszuständen verbunden ist). Ihre Aufhebung geschieht durch die Aufhebung des Kontakts. Der Pfad zur Aufhebung ist der Edle Achtfache Pfad.
Diese Auswahl an Lehrreden zeigt, wie Vedanā und Vedanānupassanā aus verschiedenen, sich ergänzenden Perspektiven beleuchtet werden. Während die Satipaṭṭhāna-Suttas (DN 22, MN 10) die primäre Anleitung für die meditative Praxis bieten und das Vedanā-Saṃyutta (SN 36) die Erfahrung und den Umgang mit Empfindungen anhand vieler Beispiele vertieft, liefert das Nibbedhika-Sutta (AN 6.63) eine wertvolle analytische Landkarte. Es hilft, die Rolle der Empfindungen im größeren Kontext der buddhistischen Lehre – insbesondere in Bezug auf Ursache und Wirkung (Kontakt, Karma) und den Befreiungspfad – intellektuell zu durchdringen. Für ein umfassendes Verständnis sind sowohl der erfahrungsbasierte Zugang der Meditation als auch der analytische Zugang des Studiums von großer Bedeutung.
Zusammenfassung und Praktische Relevanz
Vedanānupassanā, die Achtsamkeit auf Empfindungen, ist eine zentrale Säule der buddhistischen Meditationspraxis. Sie beinhaltet das bewusste, nicht-reaktive Beobachten der angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühlstöne, die unsere Erfahrung von Moment zu Moment färben. Durch diese Praxis wird die wahre Natur der Empfindungen – ihre Vergänglichkeit, ihre potenzielle Leidhaftigkeit und ihre unpersönliche Natur – direkt erkannt.
Das Hauptziel ist es, die automatischen Reaktionsmuster von Gier auf Angenehmes, Abneigung gegen Unangenehmes und Verblendung gegenüber Neutralem zu durchbrechen. Indem wir lernen, Empfindungen als das zu sehen, was sie sind – flüchtige, bedingt entstandene Phänomene –, können wir die Wurzeln von Anhaftung und Ablehnung schwächen und schließlich durchtrennen. Dies führt nicht nur zu einer größeren emotionalen Ausgeglichenheit und einer Reduzierung des selbstgemachten Leids (des „zweiten Pfeils“), sondern auch zur Entwicklung von tiefgreifender Einsicht (Vipassanā) und Weisheit (Paññā).
Die Praxis der Vedanānupassanā ist somit ein mächtiges Werkzeug auf dem buddhistischen Pfad zur Befreiung. Sie ermöglicht es uns, die Funktionsweise unseres eigenen Geistes besser zu verstehen und uns von leidvollen Mustern zu lösen. Es lohnt sich für dich, die in diesem Beitrag genannten Lehrreden selbst zu studieren, um ein tieferes Verständnis zu erlangen. Die Auseinandersetzung mit den Originaltexten, idealerweise ergänzt durch eine regelmäßige Meditationspraxis unter qualifizierter Anleitung, kann den Weg zu größerer Klarheit, innerem Frieden und Einsicht ebnen.
Quellen, Referenzen & weiterführende Webseiten
Audio-Vorträge & Geleitete Meditationen- Fred von Allmen: Dharma-Vorträge (Audio-Archiv) – Umfangreiches Archiv mit Anleitungen zu Vipassanā, Metta und Geistesschulung.
- BuddhasLehre: YouTube-Kanal – Traditionsübergreifende Audio- und Videothek, gut geeignet für geführte Meditationen verschiedener Lehrer.
- Bhikkhu Anālayo: Satipaṭṭhāna-Studien – Essenzielle Ressourcen (u.a. Universität Hamburg) für das detaillierte Verständnis der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
- SATI Institut: Der Weg der Achtsamkeit (PDF) – Ein kompakter Leitfaden zur praktischen Anwendung des Satipaṭṭhāna.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefgründige Artikel, die meditative Erfahrungen oft mit westlicher Psychologie verknüpfen.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte und Artikel – Schriftliche Erläuterungen zu spezifischen Meditationshindernissen und Herzensqualitäten.
- Dhamma Dana: Praxis-Bücher (BGM) – Kostenlose E-Books und Meditationshandbücher (z.B. von Ajaan Lee oder Mahasi Sayadaw).
- Palikanon.com: Suttas & Wörterbuch – Die Primärquelle für die klassischen Meditationstexte (z.B. Satipaṭṭhāna Sutta, Ānāpānasati Sutta).
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – Systematische Aufbereitung der Lehre, hilfreich für die Einordnung der Meditation in den Gesamtpfad.
- Theravāda-Netz: Suttensuche & Texte – Gute Quelle für spezifische Suttas und Studienmaterial zur Vertiefung.
- BuddhaStiftung: Glossar – Kurze, prägnante Definitionen zu den Grundlagen der Achtsamkeit.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Für den schnellen Überblick und Querverweise.
Weiter in diesem Bereich mit …
Cittānupassanā (Geistesachtsamkeit)
Die dritte Grundlage ist die Betrachtung des Geistes (Citta) selbst. Es geht darum, die momentanen Geisteszustände direkt und nicht-wertend zu erkennen. Erfahre, wie du achtsam feststellst, ob dein Geist gerade von Gier (rāga), Hass (dosa), Verblendung (moha) erfasst oder frei davon ist, ob er gesammelt (samāhita) oder zerstreut (vikkhitta), befreit (vimutta) oder unbefreit ist, und viele weitere Zustände.







