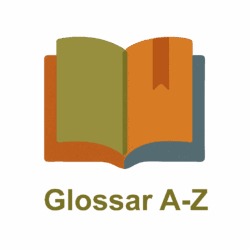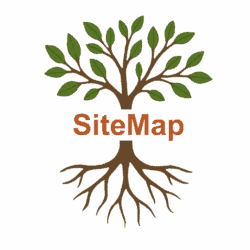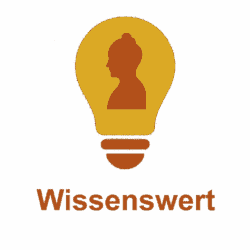Khandha Saṃyutta (SN 22): Eine thematische Tiefenanalyse der Daseinsgruppen
Die buddhistische Lehre der fünf Aggregate und der Weg zur Befreiung vom „Ich“
Inhaltsverzeichnis
- Kurzer Kontext: Der Saṃyutta Nikāya als thematische Schatzkammer
- Im Fokus: Eine detaillierte Analyse von SN 22, dem Khandha Saṃyutta
- Thematische Schwerpunkte und Kernbotschaften: Die Befreiung vom „Ich“
- Struktur und Stil des Saṃyutta: Ein pädagogisches Meisterwerk
- Beispielhafte Suttas: Die Lehre in der Praxis
- Bedeutung für die heutige Praxis: Was wir vom Khandha Saṃyutta lernen können
- Fazit: Ein Wegweiser zur tiefen Einsicht
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Kurzer Kontext: Der Saṃyutta Nikāya als thematische Schatzkammer
Der Pāli-Kanon, die heilige Schrift des Theravāda-Buddhismus, ist eine gewaltige Sammlung von Lehrreden, Ordensregeln und philosophischen Abhandlungen. Innerhalb dieses Kanons nimmt der Saṃyutta Nikāya eine besondere Stellung ein. Anders als andere Sammlungen, die ihre Texte nach Länge oder numerisch ordnen, gruppiert der Saṃyutta Nikāya die Lehrreden des Buddha nach Themen. Diese einzigartige Struktur macht ihn zu einer thematischen Schatzkammer, die ein systematisches und tiefgehendes Studium der Grundlehren des Dhamma ermöglicht. Diese Seite beleuchtet nun eines seiner grundlegendsten und psychologisch tiefgründigsten „Themenbücher“: das Kapitel über die Daseinsgruppen, die Khandhas.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Pāli-Titel | Saṃyutta Nikāya |
| Position im Kanon | Dritter der fünf Nikāyas (Sammlungen) im Sutta Piṭaka (Korb der Lehrreden) |
| Deutscher Titel | Die Gruppierte Sammlung; auch: Verbundene Lehrreden |
| Organisationsprinzip | Thematische Gruppierung. Über 2.900 Lehrreden (moderne Zählung) sind in fünf große Bücher (Vaggas) und 56 thematische Kapitel (Saṃyuttas) geordnet. Die Themen umfassen zentrale Lehren (z.B. Bedingtes Entstehen), Personengruppen (z.B. Nonnen) oder einzelne Persönlichkeiten (z.B. König Pasenadi von Kosala). |
Die logische, thematische Anordnung des Saṃyutta Nikāya ist für Studierende des Dhamma von unschätzbarem Wert. Sie wirkt der anfänglichen Überforderung angesichts der schieren Textmenge des Kanons entgegen und offenbart eine bewusst gestaltete Struktur, die einem Lehrplan gleicht. Anstatt sich in einem Ozean von Lehren zu verlieren, kann man sich gezielt einem grundlegenden Pfeiler der Lehre widmen. Die folgende Analyse des Khandha Saṃyutta ist somit keine Untersuchung eines zufälligen Textes, sondern die Erkundung eines zentralen Bausteins in dem großartigen, wohlgeordneten Gebäude der Lehre des Buddha.
Im Fokus: Eine detaillierte Analyse von SN 22, dem Khandha Saṃyutta
Einleitung: Worum geht es in diesem Kapitel? – Die Anatomie der Erfahrung
Das Khandha Saṃyutta (SN 22) ist eine der tiefgründigsten und praktisch relevantesten Sammlungen im gesamten Pāli-Kanon. Es präsentiert die tiefgreifende Analyse des Buddha dessen, was wir als „Person“, „Ich“ oder „Selbst“ bezeichnen. Statt einer unteilbaren, beständigen Seele offenbart die Lehre eine dynamische Zusammenspiel von fünf psycho-physischen Prozessgruppen, den pañca khandhā (fünf Daseinsgruppen oder Aggregate): Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein. Das Ziel dieser Analyse ist nicht metaphysische Spekulation, sondern die Befreiung vom Leiden (dukkha), das unweigerlich aus der Identifikation mit diesen unbeständigen Prozessen entsteht. Die hervorgehobene Stellung dieses Kapitels unterstreicht seine fundamentale Bedeutung. Als 22. Saṃyutta ist es das erste, längste und thematisch dominierende Kapitel des dritten großen Buches, des Khandhavagga (Das Buch der Daseinsgruppen). Es legt damit das Fundament für das Verständnis der Ersten Edlen Wahrheit, denn der Buddha definierte das Leiden selbst als die „fünf am Anhaften hängenden Daseinsgruppen“ (pañcupādānakkhandhā). Die Lehrreden werden meist vom Buddha selbst gehalten, doch oft treten auch seine herausragenden Schüler wie Sāriputta und Mahākaccāna auf, die seine Lehren für andere Mönche oder Laien wie den alternden Hausvater Nakulapitā meisterhaft erläutern und so die lebendige Weitergabe des tiefen Dhamma in der frühen Gemeinschaft veranschaulichen.
Ein faszinierender Aspekt, der sich aus dem Vergleich mit der chinesischen Parallelversion, dem Saṃyukta Āgama (SA), ergibt, ist eine unterschiedliche pädagogische Anordnung. Während der Pāli Saṃyutta Nikāya (SN) das Kapitel über das Bedingte Entstehen (Nidāna Saṃyutta, SN 12) vor das Kapitel über die Aggregate stellt, kehrt das Saṃyukta Āgama diese Reihenfolge um. Dies deutet auf zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen gültige Lehrstrategien hin. Die chinesische Version folgt genauer der Reihenfolge der Vier Edlen Wahrheiten: Zuerst wird das Leiden analysiert (die Aggregate), dann seine Ursache (das Bedingte Entstehen). Die Pāli-Version scheint einen anderen Weg zu bevorzugen: Zuerst wird das universelle Gesetz der Kausalität etabliert (Bedingtes Entstehen), um dieses dann auf den spezifischen Fall der menschlichen Erfahrung (die Aggregate) anzuwenden. Beide Strukturen zeugen von der tiefen pädagogischen Weisheit der frühen buddhistischen Lehrer.
Thematische Schwerpunkte und Kernbotschaften: Die Befreiung vom „Ich“
Das Khandha Saṃyutta ist ein analytisches Meisterstück. Es zerlegt die scheinbar feste Einheit unseres Selbst in seine funktionalen Bestandteile, um die Wurzel des Leidens freizulegen.
Das Fünf-Aggregate-Modell: Ein analytisches Werkzeug
Die fünf Khandhas sind das grundlegende Analyseinstrument, das in diesem Kapitel immer wieder angewendet wird:
- Rūpa (Körperlichkeit, Form): Dies umfasst nicht nur den eigenen Körper mit seinen vier Elementen (Erde, Wasser, Feuer, Luft), sondern auch alle materiellen Phänomene der Außenwelt, die über die Sinne wahrgenommen werden.
- Vedanā (Gefühl): Dies ist der reine affektive Ton jeder Erfahrung, die unmittelbare, vor-begriffliche Reaktion. Sie wird in drei Kategorien eingeteilt: angenehm (sukha), unangenehm (dukkha) oder neutral (adukkhamasukha).
- Saññā (Wahrnehmung): Diese Funktion erkennt und benennt Objekte. Sie greift auf Erinnerungen zurück, um Sinnesdaten zu identifizieren und zu kategorisieren („Das ist ein Baum“, „Das ist die Farbe Blau“).
- Saṅkhārā (Geistesformationen, Willensregungen): Dies ist das komplexeste Aggregat. Es bezeichnet alle willentlichen Handlungen, mentalen Konstrukte, Gewohnheiten, Absichten und Reaktionen. Der Buddha setzt es oft mit cetanā (Wollen, Absicht) gleich, dem Motor, der Kamma erzeugt. Es ist die reaktive und gestaltende Kraft des Geistes.
- Viññāṇa (Bewusstsein): Dies ist die grundlegende Fähigkeit, sich eines Objekts bewusst zu sein. Es entsteht immer in Abhängigkeit von einem Sinnesorgan und einem Sinnesobjekt (z.B. entsteht Seh-Bewusstsein in Abhängigkeit von Auge und Form).
Der Kern des Problems: Das Anhaften (Upādāna)
Ein zentrales Thema, das sich durch SN 22 zieht, ist die entscheidende Unterscheidung zwischen den Aggregaten (khandhā) und den Anhaftungs-Aggregaten (upādānakkhandhā). Die Aggregate an sich sind neutrale, unpersönliche Prozesse – das „Material“ der Erfahrung. Das Leiden (dukkha) entsteht erst durch upādāna, den mentalen Akt des Greifens, des Sich-Identifizierens und des Festhaltens an diesen Prozessen als „ich“ und „mein“. Das Khandha Sutta (SN 22.48) definiert die Anhaftungs-Aggregate explizit als jene, die „befleckt“ sind und „angehaftet werden können“. Das Pāli-Wort upādāna trägt eine aufschlussreiche Doppelbedeutung: Es bedeutet nicht nur „Anhaften“, sondern auch „Brennstoff“ oder „Nahrung“. Die Aggregate sind also nicht nur das, woran wir uns klammern; sie sind auch der Brennstoff, der das Feuer des Daseinskreislaufs (saṃsāra) am Lodern hält. Wie es im Upaya Sutta (SN 22.53) beschrieben wird, „landet“ das Bewusstsein auf den anderen Aggregaten und wächst, genährt von Freude und Verlangen, wie eine Pflanze in fruchtbarem Boden. Diese dynamische Sichtweise zeigt, dass wir aktiv an unserem eigenen Leiden teilhaben, indem wir die Prozesse der Identifikation ständig „nähren“. Die praktische Konsequenz ist klar: Um das Leiden zu beenden, müssen wir aufhören, es zu füttern.
Die Drei Daseinsmerkmale (Tilakkhaṇa) als chirurgisches Skalpell
Die primäre Untersuchungsmethode in SN 22 ist die unermüdliche Anwendung der drei Daseinsmerkmale – anicca (Vergänglichkeit), dukkha (Leidhaftigkeit) und anattā (Nicht-Selbst) – auf jedes einzelne Aggregat. Die Lehrreden folgen einer kraftvollen, wiederkehrenden Logik:
- Ist dieser Prozess (z.B. Körperlichkeit) beständig oder unbeständig (niccaṃ vā aniccaṃ vā)? – Unbeständig.
- Ist das, was unbeständig ist, leidhaft oder glückhaft (sukhaṃ vā dukkhaṃ vā)? – Leidhaft.
- Ist es angemessen, das, was unbeständig, leidhaft und dem Wandel unterworfen ist, so zu betrachten: „Das ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst“ (‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti)? – Nein, das ist es nicht.
Diese Formel ist kein bloßer Katechismus, sondern eine Anleitung zur Kontemplation, eine Methode, um das Bewusstsein neu zu verdrahten und die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist.
Die pragmatische Psychologie des Buddha: Reiz, Gefahr und Entrinnen
Um einer nihilistischen Sichtweise vorzubeugen, ist der Ansatz des Buddha stets ausgewogen. Er anerkennt die assāda (Befriedigung, Verlockung) der Aggregate – die Freude, die wir aus ihnen ziehen und die der Grund für unser Anhaften ist. Dann legt er systematisch die ādīnava (Gefahr, Nachteil) offen, die ihrer Vergänglichkeit innewohnt. Schließlich zeigt er den Weg zum nissaraṇa (Entrinnen, Ausweg), nämlich das Aufgeben von Verlangen und Leidenschaft für sie. Diese dreifache Methode, wie sie in den Suttas SN 22.26-28 zu finden ist, ist ein Meisterstück der Verhaltenspsychologie. Sie führt den Praktizierenden von der Anhaftung zur Befreiung, indem sie seine Wahrnehmung des Objekts grundlegend verändert.
Struktur und Stil des Saṃyutta: Ein pädagogisches Meisterwerk
Das Khandha Saṃyutta umfasst 159 Lehrreden, die sorgfältig in drei große Abschnitte zu je fünfzig Suttas (paṇṇāsaka) gegliedert sind: das Mūlapaṇṇāsaka (Wurzel-Fünfziger), das Majjhimapaṇṇāsaka (Mittleres-Fünfziger) und das Uparipaṇṇāsaka (Oberes-Fünfziger). Diese sind wiederum in insgesamt 15 kleinere Kapitel (vaggas) unterteilt, von denen jedes die Lehre von den Aggregaten aus einem bestimmten Blickwinkel beleuchtet. Der Stil ist stark formelhaft und repetitiv. Viele Suttas verwenden identische Rahmenstrukturen und tauschen lediglich einzelne Begriffe aus. In einer mündlichen Überlieferungskultur diente dies als wirkungsvolles mnemotechnisches Hilfsmittel. Für den modernen Leser wirkt diese Wiederholung wie eine Art „kontemplatives Eintauchen“, das die Kernprinzipien durch strukturierte Wiederholung tief im Bewusstsein verankert.
Die innere Abfolge dieser 15 vaggas ist dabei keineswegs zufällig. Sie bildet einen kohärenten und aufeinander aufbauenden Lehrplan zur Entwicklung von Einsicht:
- Grundlagen (Mūlapaṇṇāsaka, SN 22.1–52): Die Sammlung beginnt mit einem nachvollziehbaren Problem (das Altern des Nakulapitā in SN 22.1) und grundlegenden Definitionen. Der Anicca Vagga (Kapitel über Vergänglichkeit) etabliert das Kernprinzip. Der Bhāra Vagga (Kapitel von der Last) führt die kraftvolle Metapher der Bürde ein. Der Natumhāka Vagga (Kapitel „Nicht euer“) stellt den Besitzanspruch auf die Erfahrung direkt in Frage, und der Attadīpa Vagga (Kapitel „Seid euch selbst eine Insel“) weist auf die Selbstzuflucht durch den Dhamma hin.
- Vertiefung der Praxis (Majjhimapaṇṇāsaka, SN 22.53–102): Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das „Wie“. Der Upaya Vagga (Kapitel über Anhaftung) erklärt die Mechanik, wie das Bewusstsein „landet“ und wächst. Der Arahanta Vagga zeigt das Ergebnis der Praxis. Der Khajjanīya Vagga (Kapitel „Aufgefressen werden“) nutzt eindringliche Bilder, um zu beschreiben, wie wir von unserer Identifikation verzehrt werden.
- Verfeinerung des Verständnisses (Uparipaṇṇāsaka, SN 22.103–159): Der letzte Abschnitt behandelt subtile Punkte und mögliche Fallstricke. Der Thera Vagga (Kapitel der Älteren) enthält Dialoge, die komplexe Themen wie das Schicksal eines Erleuchteten nach dem Tod behandeln (Yamaka Sutta, SN 22.85). Der Puppha Vagga (Kapitel der Blumen) enthält das berühmte Gleichnis vom Schaumklumpen. Die Sammlung schließt mit dem Diṭṭhi Vagga (Kapitel der Ansichten), das spekulative falsche Ansichten auflöst.
Diese sorgfältig durchdachte Progression offenbart das verborgene Genie des Khandha Saṃyutta als ein vollständiges Handbuch für die Einsichtspraxis.
Beispielhafte Suttas: Die Lehre in der Praxis
Drei Lehrreden stechen durch ihre Klarheit und transformative Kraft besonders hervor und veranschaulichen die zentralen Botschaften des Kapitels.
SN 22.59: Anattalakkhaṇa Sutta – Die Lehrrede über das Merkmal des Nicht-Selbst
Dies ist die zweite Lehrrede des Buddha, gehalten vor denselben fünf Asketen, die seine erste Rede gehört hatten. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Kapitels und ein Eckpfeiler der buddhistischen Lehre. Die Argumentation ist von bestechender Logik: Wenn einer der fünf Aggregate wirklich „mein Selbst“ wäre, hätte ich die absolute Kontrolle darüber und könnte befehlen: „Mein Körper soll so sein! Mein Körper soll nicht so sein!“. Da wir diese Kontrolle offensichtlich nicht haben, können diese Prozesse nicht unser wahres Selbst sein. Diese Erkenntnis wird durch die Analyse von anicca und dukkha untermauert. Die unmittelbare Wirkung dieser Rede war tiefgreifend: Alle fünf Asketen erlangten beim Hören die vollständige Befreiung und wurden zu Arahants.
SN 22.95: Pheṇapiṇḍūpama Sutta – Das Gleichnis vom Schaumklumpen
Dieses Sutta ist ein pädagogisches Juwel, das kraftvolle, poetische Gleichnisse verwendet, um die schwer fassbare Qualität der Substanzlosigkeit der Aggregate zu vermitteln.
- Körperlichkeit (rūpa) ist wie ein Schaumklumpen: scheinbar fest, aber bei näherer Betrachtung hohl und ohne Kern.
- Gefühl (vedanā) ist wie eine Wasserblase: entsteht und vergeht im selben Augenblick, zerbrechlich und flüchtig.
- Wahrnehmung (saññā) ist wie eine Fata Morgana: sie täuscht und lässt etwas Wirkliches erscheinen, wo nichts ist.
- Geistesformationen (saṅkhārā) sind wie der Stamm eines Bananenbaums: schält man Schicht um Schicht auf der Suche nach einem festen Kernholz, findet man nichts als weitere Schichten.
- Bewusstsein (viññāṇa) ist wie die Illusion eines Magiers: es erzeugt den Anschein von Realität, ist aber letztlich ein Trugbild.
Diese Gleichnisse sind direkte Objekte für die Kontemplation. Sie umgehen den Intellekt und sprechen die intuitive Einsicht an, wodurch ein tiefes, gefühltes Verständnis für die Vergänglichkeit und Leere der eigenen Erfahrung entstehen kann.
SN 22.22: Bhāra Sutta – Die Lehrrede von der Last
Dieses Sutta rahmt die Vier Edlen Wahrheiten auf brillante Weise neu, indem es die tiefgründige Metapher einer Last verwendet. Dadurch wird die Lehre von den Aggregaten unmittelbar persönlich und ihre dringende Notwendigkeit zur Befreiung spürbar.
- Die Last (bhāra): Die fünf Anhaftungs-Aggregate (die Wahrheit vom Leiden).
- Das Aufnehmen der Last (bhārādāna): Das Verlangen (taṇhā), das zu weiterem Werden führt (die Wahrheit von der Leidensentstehung).
- Das Ablegen der Last (bhāranikkhepana): Das restlose Aufhören dieses Verlangens (die Wahrheit von der Leidensaufhebung).
- Der Lastenträger (bhārahāra): Die „Person“ (puggala).
Die Genialität dieses Suttas liegt in seiner geschickten Anwendung von Lehrmethoden (upāya-kosalla). Indem der Buddha den konventionellen Begriff des „Lastenträgers“ verwendet, vermeidet er es, sich in der metaphysischen Debatte zu verstricken, „wer“ denn nun leidet – eine Frage, die er konsequent als nicht zielführend zurückwies. Der Fokus wird von einer philosophischen Frage („Was ist eine Person?“) auf ein praktisches, existenzielles Problem verlagert: „Wie lege ich diese Last ab?“. Dies verkörpert die Essenz des pragmatischen Befreiungsweges des Buddha.
Bedeutung für die heutige Praxis: Was wir vom Khandha Saṃyutta lernen können
Die Lehren des Khandha Saṃyutta sind keine verstaubten philosophischen Relikte, sondern eine hochaktuelle und direkt anwendbare Anleitung zur Befreiung des Geistes.
Der Leitfaden für die Vipassanā-Meditation
Die Analyse der fünf Aggregate ist die praktische Landkarte für die Einsichtsmeditation (Vipassanā). Die Praxis besteht darin, die Erfahrung von Moment zu Moment durch diese fünffache Linse zu betrachten. Ein Meditierender beobachtet Körperempfindungen (rūpa), registriert das Aufsteigen und Vergehen von angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühlen (vedanā), bemerkt, wie der Geist diese Erfahrungen benennt (saññā), und wird sich vor allem der reaktiven Gedanken und Impulse bewusst, die darauf folgen (saṅkhārā). All dies wird durch das grundlegende Bewusstsein (viññāṇa) gewusst. Diese systematische Beobachtung kultiviert direkt die Einsicht in anicca, dukkha und anattā und erfüllt damit die Anweisungen der berühmten Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit (Satipaṭṭhāna Sutta).
Ein wirksames Gegenmittel gegen existenzielle Angst
Das Upādāparitassanā Sutta (SN 22.7) liefert eine klare psychologische Diagnose: Angst und Sorge entstehen aus dem Anhaften an die Aggregate als ein „Selbst“, wenn diese sich unweigerlich verändern und vergehen. Indem man lernt, die Erfahrung als einen Fluss unpersönlicher, bedingter Prozesse zu sehen, untergräbt man die Grundlage für Ängste vor Alter, Krankheit, Verlust und Tod. Das „Selbst“, das sich bedroht fühlt, wird als eine Illusion, als ein Konstrukt durchschaut. Diese Einsicht schenkt tiefen Frieden und Resilienz.
Verblüffende Parallelen zur modernen Kognitionswissenschaft
Das 2500 Jahre alte Modell des Buddha vom Selbst als einer Zusammensetzung interagierender Prozesse ohne einen zentralen Steuermann findet einen bemerkenswerten Widerhall in der modernen Wissenschaft. Die Neurowissenschaft hat keinen einzelnen „Sitz des Selbst“ im Gehirn gefunden. Stattdessen wird das Ich-Gefühl als eine sich aus dem Zusammenspiel ergebende Eigenschaft verstanden – eine Erzählung, die aus verschiedenen kognitiven Funktionen wie Gedächtnis, Körperwahrnehmung und Handlungsplanung konstruiert wird. Diese Übereinstimmung ist mehr als eine Kuriosität. Sie stellt eine Bestätigung der Methode des Buddha dar. Der Buddha nutzte die rigorose, disziplinierte Introspektion als sein „wissenschaftliches Instrument“, um den Geist zu kartieren. Die moderne Wissenschaft nutzt objektive Werkzeuge wie fMRT und EEG, um dasselbe zu tun. Die Tatsache, dass beide – die „Erste-Person-Wissenschaft“ der Meditation und die „Dritte-Person-Wissenschaft“ des Labors – zu verblüffend ähnlichen Schlussfolgerungen gelangen, verleiht dem Dhamma eine außerordentliche Glaubwürdigkeit. Es erlaubt dem modernen Praktizierenden, die Lehre von den Aggregaten nicht als Glaubensartikel, sondern als eine überprüfbare Hypothese über die Natur des eigenen Geistes zu betrachten – eine Hypothese, die durch ein unabhängiges Feld der menschlichen Forschung gestützt wird.
Fazit: Ein Wegweiser zur tiefen Einsicht
Das Khandha Saṃyutta ist weit mehr als ein philosophischer Traktat; es ist das wesentliche „Werkzeugset zur Befreiung“, das der Buddha hinterlassen hat. Es liefert das analytische Skalpell, das benötigt wird, um die feine Operation durchzuführen, das Bewusstsein vom Anhaften zu trennen. Indem es eine präzise, nachvollziehbare Landkarte der Erfahrung anbietet, ermächtigt SN 22 den Praktizierenden, vom Opfer der eigenen mentalen Prozesse zum klar sehenden Beobachter zu werden. Die tiefste Botschaft ist eine von tiefem Optimismus: Da das Leiden bedingt ist, kann es auch ent-dingt werden. Freiheit wird nicht gefunden, indem man etwas Neues hinzufügt, sondern indem man jene Prozesse versteht und loslässt, die man fälschlicherweise für sich selbst hält.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Vertiefen Sie Ihr Wissen und erkunden Sie die Lehren des Buddha direkt an der Quelle:
- Lesen Sie das vollständige Khandha Saṃyutta (SN 22) auf SuttaCentral
- Entdecken Sie die gesamte Gruppierte Sammlung (Saṃyutta Nikāya)
- Samyutta Nikaya: The Grouped Discourses – Access to Insight
- Saṁyutta Nikāya Suttas auf dhammatalks.org
- Samyutta Nikaya 22 Einleitung – Palikanon
- Khandha: Definitionen – Wisdom Library
- The Samyutta Nikaya of the Pali Canon – Vipassana Fellowship
- Saṃyutta Nikāya – Wikipedia