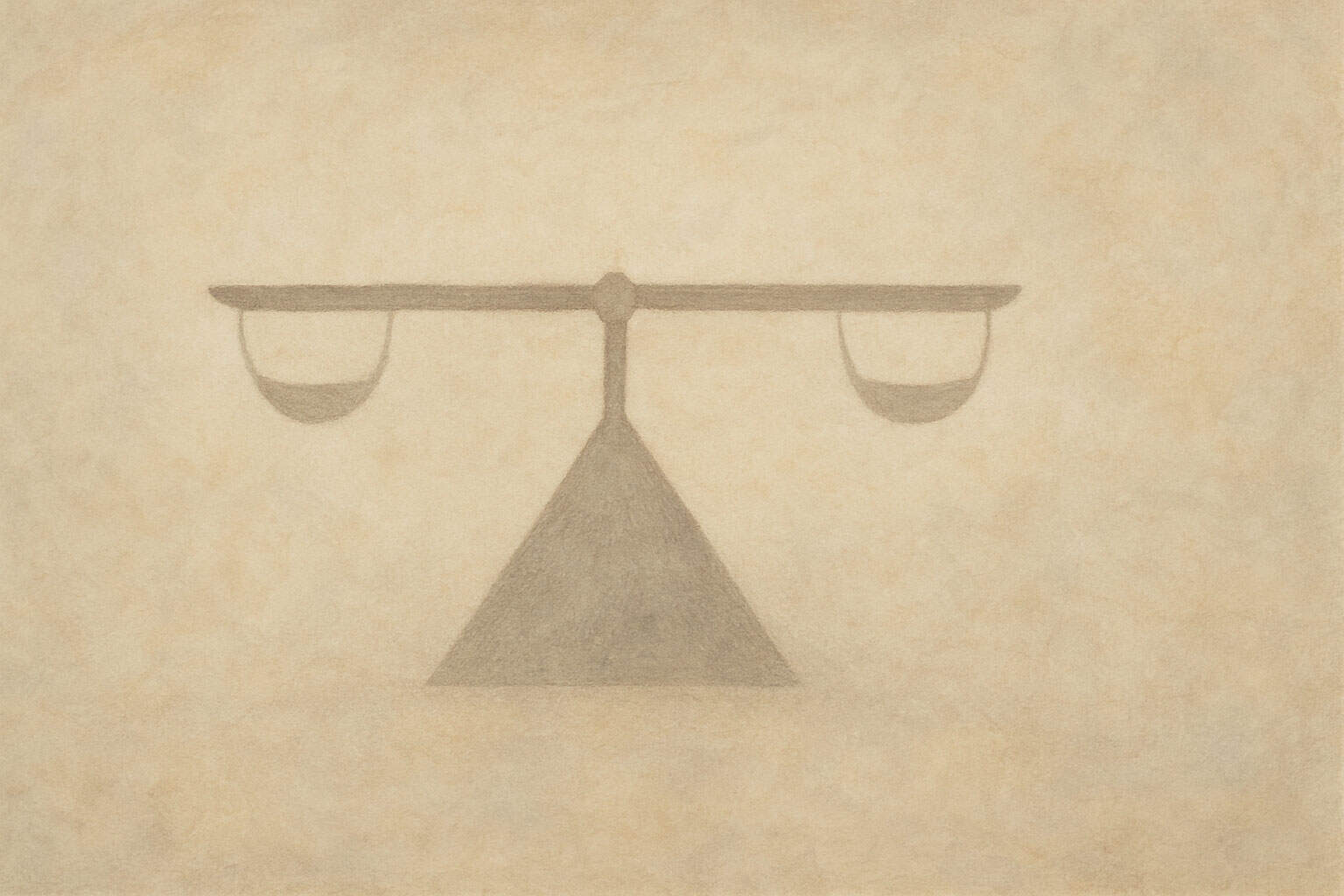
Upekkhā (Gleichmut): Ein Schlüsselbegriff im Pāli-Kanon und seine Bedeutung im frühen Buddhismus
Die Kultivierung von Ausgeglichenheit, Unparteilichkeit und Weisheit
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Die Bedeutung von Gleichmut im Buddhismus
Das Verständnis zentraler Begriffe aus der Sprache des Buddha, dem Pāli, ist essenziell, um die Tiefe seiner Lehre (Dhamma) zu erschließen. Einer dieser Schlüsselbegriffe ist Upekkhā, oft mit „Gleichmut“ übersetzt. Diese Geisteshaltung ist weit mehr als nur emotionale Ruhe; sie ist eine tragende Säule auf dem buddhistischen Weg zur Befreiung (Nibbāna). Sie repräsentiert eine Form geistiger Reife und Weisheit, die es ermöglicht, den Herausforderungen des Lebens mit Klarheit und innerer Stärke zu begegnen.
Dieser Bericht wird Upekkhā definieren, seine verschiedenen Facetten beleuchten, es in wichtige Lehrkonzepte einordnen und konkrete Lehrreden aus den Hauptsammlungen des Pāli-Kanons vorstellen, die diesen Begriff vertiefen. Besonderes Augenmerk liegt auf Texten aus dem Dīgha Nikāya (DN), der Sammlung der langen Lehrreden, und dem Majjhima Nikāya (MN), der Sammlung der mittleren Lehrreden. Ergänzend werden Hinweise auf relevante Kapitel (Saṃyuttas) im Saṃyutta Nikāya (SN), der Sammlung der gruppierten Lehrreden, sowie auf besonders bekannte Lehrreden aus dem Aṅguttara Nikāya (AN), der Sammlung der angereihten Lehrreden, gegeben.
Ziel ist es, sowohl Lesern mit Vorkenntnissen spezifische Textverweise für ein vertieftes Studium an die Hand zu geben, als auch Interessierten ohne Vorkenntnisse einen fundierten Zugang zu diesem wichtigen Konzept zu ermöglichen.
Upekkhā (Gleichmut): Definition und Erklärung
Kernbedeutung und Übersetzung
Der Pāli-Begriff lautet Upekkhā, wobei gelegentlich auch die Schreibweise Upekhā vorkommt. Gängige deutsche Übersetzungen umfassen Gleichmut, Ausgeglichenheit, Gelassenheit, Seelenruhe, Unparteilichkeit, Nicht-Reaktivität und mentale Balance.
Im Kern beschreibt Upekkhā die Fähigkeit, einen stabilen, ausgeglichenen Geist inmitten der unvermeidlichen Wechselfälle des Lebens zu bewahren. Diese werden im Buddhismus oft als die „acht weltlichen Winde“ oder „acht weltlichen Bedingungen“ (Aṭṭhaloka Dhamma) bezeichnet: Gewinn (Lābha) und Verlust (Alābha), Ansehen (Yasa) und Missachtung oder Schande (Ayasa), Lob (Pasaṃsā) und Tadel (Nindā), sowie Freude oder Vergnügen (Sukha) und Schmerz oder Leid (Dukkha). Upekkhā ist die unerschütterliche Freiheit des Geistes angesichts dieser Polaritäten, ein Zustand inneren Gleichgewichts, der durch diese Schwankungen nicht gestört werden kann.
Etymologie und tiefere Bedeutung
Das Wort Upekkhā setzt sich etymologisch zusammen aus dem Präfix upa (nahe bei, auf etwas hin, betrachtend) und der Verbalwurzel √ikkh (sehen, betrachten). Wörtlich kann es daher als „darauf schauen“, „hinsehen“ oder „(nahes) Beobachten“ verstanden werden.
Diese Wortbedeutung deutet bereits darauf hin, dass Upekkhā weit mehr ist als eine passive Haltung. Es ist keine gefühllose Stumpfheit, sondern eine Form des bewussten, aufmerksamen und nicht-wertenden Beobachtens der eigenen Erfahrung. Es impliziert ein aktives geistiges Engagement, ein gleichmütiges Hinschauen auf das, was ist, ohne sich sofort in emotionale Reaktionen von Anziehung oder Abstoßung zu verstricken.
Diese Qualität ist eng verbunden mit Achtsamkeit (Sati) und klarem Verstehen (Sampajañña) und bildet eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung von Weisheit (Paññā). In Lehrreden wie MN 118 wird Upekkhā im Kontext der Erleuchtungsglieder explizit mit Sati-Sampajañña verknüpft und als ein „sorgfältiges Beobachten mit Gleichmut“ beschrieben, insbesondere beim Erkennen des Aufgebens von Gier und Kummer. Dies unterstreicht den aktiven, erkenntnisorientierten Charakter von Upekkhā, der es zu einer Schlüsselkomponente der Einsichtsmeditation (Vipassanā) macht.
Abgrenzung von Missverständnissen: Nicht Gleichgültigkeit!
Es ist von entscheidender Bedeutung, Upekkhā klar von bloßer Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit oder Vernachlässigung abzugrenzen. Upekkhā bedeutet nicht, dass einem das Wohl anderer gleichgültig ist oder dass man keine Gefühle mehr empfindet. Wahrer Gleichmut ist vielmehr die Freiheit von ich-bezogenen Reaktionen – von Gier (Lobha oder Rāga), Hass (Dosa oder Paṭigha) und Verblendung (Moha).
Es ist eine aus Weisheit geborene Haltung, die die unbeständige und unbefriedigende Natur aller Phänomene erkennt und deshalb nicht von jeder Welle der Erfahrung mitgerissen wird.
Die wiederholte Betonung dieser Abgrenzung in den buddhistischen Texten und Kommentaren weist auf eine signifikante Gefahr auf dem spirituellen Weg hin. Gleichgültigkeit wird als der „nahe Feind“ (Āsanna-Paccatthika) von Upekkhā bezeichnet, im Gegensatz zu den „fernen Feinden“ (Dūra-Paccatthika) wie Gier und Hass. Nahe Feinde sind tückischer, da sie der eigentlichen Tugend oberflächlich ähneln und leicht mit ihr verwechselt werden können. Eine Person könnte emotional abgestumpft sein und fälschlicherweise glauben, sie praktiziere Gleichmut, während sie in Wirklichkeit nur apathisch ist. Dieser Zustand würde jedoch die Entwicklung von echter Einsicht und von Qualitäten wie Mitgefühl verhindern. Die korrekte Unterscheidung ist daher grundlegend für ein authentisches Verständnis und die richtige Kultivierung von Upekkhā.
Die „Feinde“ des Gleichmuts
Zusammenfassend lassen sich die Hindernisse für Gleichmut wie folgt kategorisieren:
- Die offensichtlichen Gegensätze („ferne Feinde“): Geisteszustände wie Gier (Lobha), Begierde (Rāga), Hass (Dosa), Widerwille (Paṭigha) und Ärger (Kodha). Diese sind klar unvereinbar mit einem ausgeglichenen Geist.
- Der subtile Gegner („naher Feind“): Gleichgültigkeit oder Apathie. Dieser Zustand mag oberflächlich wie Upekkhā wirken, entspringt aber oft Unwissenheit, emotionaler Abstumpfung oder Resignation und nicht der Weisheit und Stärke des echten Gleichmuts.
Upekkhā in wichtigen Lehrkonzepten
Upekkhā ist kein isolierter Begriff, sondern ein integraler Bestandteil verschiedener zentraler Lehrgebäude des frühen Buddhismus. Seine spezifische Bedeutung und Funktion kann je nach Kontext leicht variieren. Der berühmte Kommentator Buddhaghosa listet in seinem Werk Visuddhimagga (Der Weg zur Reinheit) sogar zehn verschiedene Arten von Upekkhā auf, was die Vielschichtigkeit dieses Konzepts unterstreicht. Für ein grundlegendes Verständnis konzentrieren wir uns hier auf die wichtigsten Kontexte:
A. Upekkhā als vierte der Brahmavihāras (Göttliche Verweilungszustände)
Die Brahmavihāras, wörtlich „Verweilungszustände Brahmas“ (wobei Brahma hier für „erhaben“ oder „göttlich“ steht), sind vier Geisteshaltungen, die kultiviert und grenzenlos auf alle Wesen ausgedehnt werden sollen. Sie werden daher auch Appamaññā (die Unermesslichen) genannt. Diese vier sind:
- Mettā: Liebende Güte, Wohlwollen, Freundlichkeit.
- Karuṇā: Mitgefühl, Erbarmen.
- Muditā: Mitfreude, anteilnehmende Freude am Glück und Erfolg anderer.
- Upekkhā: Gleichmut, Unparteilichkeit, Ausgeglichenheit.
Im Kontext der Brahmavihāras bezeichnet Upekkhā die Fähigkeit, allen Wesen gegenüber unparteiisch zu sein, ohne Anhaftung (Rāga) oder Abneigung (Paṭigha). Sie basiert auf der Weisheit, dass alle Wesen „Eigner ihrer Taten“ (Kammassakā) und Erben ihrer Handlungen sind. Upekkhā tritt besonders dann in den Vordergrund, wenn aktives Eingreifen durch Mitgefühl oder Mitfreude nicht möglich oder angemessen ist, oder um die anderen drei Qualitäten auszubalancieren und vor Extremen zu schützen.
Upekkhā wird oft als der Höhepunkt oder die Vervollkommnung der Brahmavihāra-Praxis angesehen. Sie verhindert, dass Mettā zu besitzergreifender Anhaftung oder Kummer wird, Karuṇā zu lähmender Verzweiflung oder emotionaler Erschöpfung (Burnout), und Muditā zu oberflächlicher Sentimentalität oder Aufregung. Upekkhā ist hier also kein Ersatz für die anderen drei Herzensqualitäten, sondern eine notwendige Ergänzung, die Weisheit, Stabilität und Ausgewogenheit verleiht. Alle vier Brahmavihāras zusammen bilden ein vollständiges, gesundes emotionales Repertoire für den Umgang mit der Welt und anderen Lebewesen.
Upekkhā sorgt dafür, dass Liebe, Mitgefühl und Mitfreude nicht blind, parteiisch oder von egoistischen Motiven gefärbt sind, sondern auf einer Grundlage von Klarheit und Verständnis ruhen.
B. Upekkhā als siebtes der Bojjhaṅgā (Erleuchtungsglieder)
Die Bojjhaṅgā (wörtlich: Glieder des Erwachens) sind sieben geistige Qualitäten oder Faktoren, deren Entwicklung zur vollen Erleuchtung (Bodhi) führt. Sie sind ein wichtiger Teil der 37 „zur Erleuchtung gehörigen Dinge“ (Bodhipakkhiyā Dhammā). Die sieben Glieder sind:
- Sati: Achtsamkeit
- Dhammavicaya: Erforschung der Daseinsphänomene (oder der Lehre)
- Viriya: Energie, Willenskraft, Anstrengung
- Pīti: Verzückung, freudiges Interesse
- Passaddhi: Ruhe, Gelassenheit (von Körper und Geist)
- Samādhi: Sammlung, Konzentration
- Upekkhā: Gleichmut
Als letztes Glied in dieser fortschreitenden Entwicklung repräsentiert Upekkhā hier einen Zustand höchster geistiger Ausgeglichenheit, vollkommener Unparteilichkeit und Nicht-Reaktivität. Dieser Zustand geht aus tiefer Sammlung (Samādhi) und innerer Ruhe (Passaddhi) hervor. Die Position am Ende der Liste ist bedeutsam: Dieser tiefe Gleichmut steht nicht am Anfang des Weges, sondern ist das Ergebnis der intensiven Kultivierung der anderen sechs Faktoren.
Er ist charakterisiert durch eine Stabilität und Klarheit des Geistes, die nicht mehr durch äußere oder innere Ereignisse gestört wird. Gleichzeitig bildet dieser Zustand der ungestörten, klaren Beobachtung die ideale Basis für das Entstehen der tiefsten befreienden Einsicht (Vipassanā) in die wahre Natur der Wirklichkeit. In diesem Sinn ist Upekkhā als Erleuchtungsfaktor sowohl eine Kulmination der Entwicklung als auch eine notwendige Voraussetzung für den endgültigen Durchbruch zur Befreiung.
C. Upekkhā als neutrale Empfindung (Vedanā)
Im Kontext der Analyse der Erfahrung wird Vedanā (Empfindung, Gefühl) als eine der fünf Daseinsgruppen (Khandha) genannt. Empfindungen werden üblicherweise in drei Arten unterteilt:
- Sukha Vedanā: Angenehme, freudvolle Empfindung.
- Dukkha Vedanā: Unangenehme, schmerzhafte, leidvolle Empfindung.
- Adukkhamasukhā Vedanā: Weder-unangenehme-noch-angenehme Empfindung, d.h. neutrale Empfindung.
Das Wort Upekkhā wird manchmal auch verwendet, um diese neutrale Empfindung (Adukkhamasukhā Vedanā) zu bezeichnen. Sie wird als der „Nullpunkt zwischen Freude und Leid“ beschrieben.
Es ist jedoch wichtig, diese Empfindung, die zur Daseinsgruppe der Empfindungen (Vedanākkhandha) gehört, von Upekkhā als kultivierter Geisteshaltung oder Faktor zu unterscheiden. Upekkhā als Brahmavihāra oder Bojjhaṅga ist eine aktive geistige Qualität, die zu den Geistesformationen (Saṅkhārakkhandha) zählt. Die neutrale Empfindung ist ein passives Erleben, das einfach auftritt, wenn ein Sinneskontakt weder als angenehm noch als unangenehm registriert wird.
Die kultivierte Geisteshaltung Upekkhā hingegen ist das Ergebnis von Übung und Weisheit. Man kann (und soll) Gleichmut (Upekkhā als Faktor) gegenüber allen drei Arten von Empfindungen – angenehmen, unangenehmen und neutralen – entwickeln. Das Ziel der buddhistischen Praxis ist nicht, nur noch neutrale Gefühle zu haben, sondern Gleichmut gegenüber allen auftretenden Gefühlen zu kultivieren, ohne von ihnen beherrscht zu werden.
Die Tatsache, dass dasselbe Pāli-Wort für diese beiden unterschiedlichen Phänomene verwendet wird, macht eine klare begriffliche Unterscheidung notwendig, um Missverständnisse zu vermeiden.
D. Upekkhā in der meditativen Vertiefung (Jhāna)
Upekkhā spielt eine zentrale Rolle in den höheren Stufen der meditativen Vertiefung, den sogenannten Jhānas (Form-Meditationen).
Im dritten Jhāna (Tatiya Jhāna) erfährt der Meditierende tiefes Glück (Sukha), verweilt dabei aber bereits gleichmütig (Upekkhako) und achtsam. Der Gleichmut dient hier dazu, nicht an dem intensiven Glück anzuhaften.
Das vierte Jhāna (Catuttha Jhāna) wird explizit durch Upekkhā charakterisiert. Es entsteht durch das Überwinden von Glück (Sukha) und Leid (Dukkha) sowie früherer Freude (Somanassa) und Traurigkeit (Domanassa). Der Zustand wird beschrieben als adukkhamasukhaṁ upekkhāsatipārisuddhiṁ – „Weder-Leid-noch-Freude und Reinheit der Achtsamkeit durch Gleichmut“.
Der Gleichmut, der in diesen stabilen Zuständen der Sammlung erfahren wird (Jhānupekkhā), ist das Ergebnis beständiger Kultivierung (Samatha) und unterscheidet sich in seiner Beständigkeit und Reinheit erheblich von alltäglichem Gleichmut. Er ist nicht Ausdruck von Dumpfheit, sondern geht mit einem Höchstmaß an geistiger Klarheit und geschärfter Achtsamkeit einher. Dieser geklärte Zustand von Upekkhā bildet eine kraftvolle Grundlage für die Entwicklung durchdringender Einsicht (Vipassanā) in die wahre Natur der Phänomene.
E. Weltlicher vs. Überweltlicher Gleichmut
Eine weitere entscheidende Unterscheidung, die insbesondere in der Lehrrede MN 137 getroffen wird, ist die zwischen weltlichem und überweltlichem Gleichmut:
- Gehasita Upekkhā: Dies ist der weltliche, „auf dem Haus basierende“ Gleichmut. Er entsteht oft passiv durch den Kontakt mit neutralen Sinnesobjekten oder aus einer Haltung der Unwissenheit, Stumpfheit oder Resignation gegenüber den Wechselfällen des Lebens. Diese Art von Gleichmut ist abhängig von äußeren Umständen und überwindet nicht die zugrundeliegende Anhaftung an die Sinnesobjekte oder das Selbst. Sie ist nicht befreiend.
- Nekkhammasita Upekkhā: Dies ist der Gleichmut, der „auf Entsagung“ oder Loslösung basiert. Er entsteht aktiv durch die Entwicklung von Weisheit (Paññā) und Einsicht (Vipassanā) in die universellen Merkmale der Existenz: Vergänglichkeit (Anicca), Leidhaftigkeit (Dukkha) und Nicht-Selbst (Anattā). Dieser Gleichmut ist stabil und unabhängig von äußeren Objekten, da er auf Verständnis beruht. Er überwindet die Anhaftung an die Objekte (Ativattati) und führt zur Befreiung. Dieser Gleichmut ist Teil des edlen achtfachen Pfades und wird auch als überweltlich (Lokuttara) bezeichnet, da er über die gewöhnliche weltliche Erfahrung hinausführt.
Diese Unterscheidung ist von zentraler Bedeutung für den Erlösungsweg. Der buddhistische Pfad zielt darauf ab, den Praktizierenden über den abhängigen, oft auf Unwissenheit beruhenden weltlichen Gleichmut hinaus zu einem stabilen, auf Weisheit gegründeten Gleichmut zu führen, der ein integraler Bestandteil der Befreiung vom Leiden ist. Es geht nicht darum, keine Gefühle mehr zu haben oder unbeteiligt zu sein, sondern die Art und Weise, wie man auf Erfahrungen reagiert, durch Einsicht grundlegend zu transformieren.
Schlüssel-Lehrreden zu Upekkhā im Pāli-Kanon
Die folgenden Lehrreden (Suttas) aus den vier Haupt-Nikāyas des Pāli-Kanons behandeln den Begriff Upekkhā in besonderer Weise oder sind für sein Verständnis von zentraler Bedeutung.
A. Dīgha Nikāya (DN) – Die Sammlung der langen Lehrreden
- DN 13: Tevijja Sutta (Die Lehrrede über die drei [vedischen] Wissensarten)
- Relevanz: In diesem Dialog mit zwei jungen Brahmanen, die den Weg zur Vereinigung mit Brahma suchen, stellt der Buddha die Kultivierung der vier Brahmavihāras – Mettā, Karuṇā, Muditā und Upekkhā – als den wahren Weg zur Reinheit und zur Gemeinschaft mit dem Göttlichen (im Sinne von höchster geistiger Qualität) dar. Upekkhā wird hier prominent als Teil der Brahmavihāra-Meditation gelehrt, die den Geist von Feindseligkeit und Übelwollen befreit. Die Sutta verwendet die Standardformel zur Beschreibung der Ausdehnung dieser Geisteszustände in alle Richtungen.
- Link zur Lehrrede: https://suttacentral.net/dn13 | DN 13 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
B. Majjhima Nikāya (MN) – Die Sammlung der mittleren Lehrreden
- MN 137: Saḷāyatanavibhaṅga Sutta (Die Lehrrede über die Analyse der sechs Sinnesbereiche)
- Relevanz: Diese Sutta ist von herausragender Bedeutung für das Verständnis der verschiedenen Arten von Upekkhā. Sie analysiert detailliert die Entstehung von Freude (Somanassa), Traurigkeit (Domanassa) und Gleichmut (Upekkhā) in Bezug auf die sechs Sinne und unterscheidet dabei klar zwischen weltlichem Gleichmut (Gehasita Upekkhā), der auf Unwissenheit beruht und an das Objekt gebunden bleibt, und dem Gleichmut der Entsagung (Nekkhammasita Upekkhā), der durch Einsicht in Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst entsteht und das Objekt überwindet. Sie zeigt den Weg von einer abhängigen zu einer befreienden Form des Gleichmuts.
- Link zur Lehrrede: https://suttacentral.net/mn137 | MN 137 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
- MN 140: Dhātuvibhaṅga Sutta (Die Lehrrede über die Analyse der Elemente)
- Relevanz: In einem tiefgründigen Gespräch mit dem Mönch Pukkusāti (der ihn zunächst nicht erkennt), analysiert der Buddha die Erfahrung anhand der sechs Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum, Bewusstsein). Gleichmut (Upekkhā) entsteht hier im Kontext der Einsicht, dass keines dieser Elemente „mein“, „ich“ oder „mein Selbst“ ist. Der Zustand des Weisen, der Frieden erlangt hat, wird dadurch charakterisiert, dass die „Ströme des Identifizierens/Konstruierens“ (Maññassavā) zur Ruhe gekommen sind. Die Sutta behandelt auch die neutrale Empfindung (Adukkhamasukhā Vedanā) als Teil der Analyse und verbindet somit tiefen Gleichmut mit der Auflösung der Selbst-Identifikation durch Weisheit.
- Link zur Lehrrede: https://suttacentral.net/mn140 | MN 140 – Zusammenfassung und Erklärung der Lehrrede im Lehrreden-Verzeichnis.
C. Saṃyutta Nikāya (SN) – Die Sammlung der gruppierten Lehrreden
- SN 46: Bojjhaṅga Saṃyutta (Die Gruppierte Sammlung über die Erleuchtungsglieder)
- Relevanz: Dieses gesamte Kapitel (Saṃyutta), bestehend aus zahlreichen kurzen Lehrreden, ist den sieben Erleuchtungsgliedern (Bojjhaṅgā) gewidmet. Upekkhā wird hier durchgängig als der siebte und letzte Faktor behandelt. Die Suttas in diesem Kapitel erläutern die Bedingungen für sein Entstehen, die Methoden seiner Kultivierung, seine Beziehung zu den anderen sechs Faktoren (Achtsamkeit, Lehr-Erforschung, Energie, Verzückung, Ruhe, Sammlung) und seine entscheidende Rolle auf dem Weg zur Befreiung (Nibbāna). Dies ist die primäre Quelle im Pāli-Kanon für das Verständnis von Upekkhā im spezifischen Kontext der Erleuchtungsfaktoren. Es gibt zwar kein eigenes Saṃyutta, das ausschließlich Upekkhā oder den Brahmavihāras gewidmet ist, aber SN 46 behandelt Upekkhā als Bojjhaṅga sehr ausführlich.
- Link zum Kapitel: https://suttacentral.net/sn46 | SN 46 – Zusammenfassung des Kapitels im Lehrreden-Verzeichnis.
D. Aṅguttara Nikāya (AN) – Die Sammlung der angereihten Lehrreden
- AN 4.125: Mettā Sutta (Die Lehrrede über Güte – oder: Paṭhama Mettā Sutta)
- Relevanz: Diese bekannte Lehrrede (und die inhaltlich sehr ähnliche AN 4.126) beschreibt detailliert die Praxis aller vier Brahmavihāras, einschließlich Upekkhā, und deren kraftvolle Auswirkungen. Sie erklärt, wie die intensive Kultivierung dieser Geisteszustände zu einer günstigen Wiedergeburt in den Brahma-Welten führen kann, wenn sie nicht mit befreiender Einsicht verbunden ist. Für einen edlen Schüler des Buddha jedoch kann dieselbe Praxis, wenn sie auf dem Edlen Achtfachen Pfad basiert, zum endgültigen Erlöschen (Parinibbāna) führen. Die Sutta ist berühmt für die Darstellung der karmischen Früchte der Brahmavihāra-Praxis und die wichtige Unterscheidung zwischen einem weltlichen Pfad (der zu besserer Wiedergeburt führt) und dem überweltlichen Pfad (der zur Befreiung führt).
- Link zur Lehrrede: https://suttacentral.net/an4.125
- AN 10.219: Karajakāya Sutta (Die Lehrrede vom durch Wirken geborenen Körper)
- Relevanz: Eine zentrale Lehrrede, die erklärt, wie die vier Brahmavihāras – einschließlich Upekkhā –, wenn sie grenzenlos (appamāṇa) entwickelt werden, zur „Herzensbefreiung“ führen. Der Buddha lehrt hier, dass diese Praxis vergangenes, begrenztes Kamma unwirksam machen kann, sodass es nicht verbleibt.
- Link zur Lehrrede: https://suttacentral.net/an10.219
- AN 6.13: Nissāraṇīya Sutta (Elemente des Entrinnens)
- Relevanz: Diese Lehrrede ist besonders wertvoll, da sie die spezifische Funktion jeder der vier Brahmavihāras (sowie der ‚zeichenlosen Herzensbefreiung‘ und der ‚Ich-bin-Dünkel-Beseitigung‘) als „Entrinnen“ (Nissaraṇa) aus einem bestimmten negativen Geisteszustand oder einer Fessel erklärt. Upekkhā wird hier explizit als das Entrinnen aus Begierde bzw. Leidenschaft (Rāga) genannt. Dies unterstreicht die aktive, transformierende Kraft des Gleichmuts bei der Überwindung von Anhaftung und Verlangen.
- Link zur Lehrrede: https://suttacentral.net/an6.13
Zusammenfassung und Ausblick
Upekkhā erweist sich bei näherer Betrachtung als ein äußerst reicher und vielschichtiger Begriff im Pāli-Kanon. Er bezeichnet weit mehr als nur eine neutrale Empfindung. Er steht vor allem für eine hochentwickelte Geisteshaltung, die durch ethische Praxis (Sīla), meditative Sammlung (Samādhi) und befreiende Weisheit (Paññā) kultiviert wird.
Diese Haltung manifestiert sich in verschiedenen Kontexten: als unparteiische Ausgeglichenheit gegenüber allen Lebewesen (im Rahmen der Brahmavihāras), als stabilisierender und klärender Faktor auf dem Weg zur Erleuchtung (als siebtes Bojjhaṅga), als charakteristisches Merkmal tiefer meditativer Zustände (Jhāna) und als natürliche Frucht der Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit (Nekkhammasita Upekkhā).
Die zentrale Erkenntnis aus der Analyse der Texte ist die Notwendigkeit, zwischen einem passiven, oft auf Unwissenheit beruhenden weltlichen Gleichmut (oder gar Apathie) und dem aktiv kultivierten, auf Weisheit basierenden überweltlichen Gleichmut zu unterscheiden. Letzterer ist keine emotionale Unterdrückung oder Gleichgültigkeit, sondern eine unerschütterliche innere Stärke und Klarheit, die aus tiefem Verständnis und einem Herzen erwächst, das auch Mitgefühl und Güte kennt.
Dieser wahre Gleichmut ist eine wesentliche Komponente auf dem buddhistischen Weg zur Befreiung vom Leiden.
Die in diesem Bericht vorgestellten Lehrreden bieten wertvolle Einstiegspunkte für ein tieferes Verständnis von Upekkhā. Eine fortgesetzte Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Texten des Pāli-Kanons, idealerweise verbunden mit eigener Reflexion und Meditationspraxis, kann dazu beitragen, diese wichtige Qualität im eigenen Geist zu entwickeln und zu verwirklichen.
Referenzen und weiterführende Webseiten/Dokumente
Quellen, Suttas & Nachschlagewerke- Palikanon.com: Wörterbuch & Suttas – Die zentrale deutsche Referenz für Begriffsdefinitionen (Nyanatiloka) und vollständige Sutta-Übersetzungen.
- Theravāda-Netz: Glossar & Studienmaterial – Umfangreiche Sammlung mit Suchfunktion für spezifische Fachbegriffe und systematische Erklärungen.
- Alois Payer: Materialien zu den Grunderlehren – Eine „Fundgrube“ für sehr detaillierte, akademische Aufschlüsselungen buddhistischer Begriffe und Systematiken.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Enzyklopädischer Einstieg für Definitionen, Historie und Querverweise zu verwandten Konzepten.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefenpsychologische und philologische Analysen zentraler buddhistischer Schlüsselbegriffe.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte & Artikel – Schriftliche Studien zur Klärung zentraler Aspekte des Pfades und deren praktischer Anwendung.
- Forest Sangha: Publikationen der Waldtradition – Veröffentlichungen (u.a. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho), die Begriffe oft sehr lebensnah und direkt erklären.
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – E-Books und Schriften zur systematischen Aufschlüsselung der Lehrreden und Konzepte.
- Dhamma Dana: Buchprojekt (BGM) – Kostenlose Literatur, die buddhistische Grundbegriffe und Praxisanleitungen umfassend behandelt.
- BuddhasLehre: Audio- & Videothek – Traditionsübergreifende Sammlung, hilfreich um unterschiedliche Auslegungen von Begriffen kennenzulernen.
Weiter in diesem Bereich mit …
Sieben Erleuchtungsglieder (Satta Bojjhaṅgā)
Hier erhältst du einen Überblick über die Sieben Erleuchtungsglieder als Gesamtkonzept. Du lernst ihre Bedeutung als zentrale Faktoren auf dem Weg zur Befreiung kennen und verstehst ihre Einordnung innerhalb der 37 „zum Erwachen gehörigen Dinge“ (Bodhipakkhiyadhamma). Erfahre mehr über das dynamische Zusammenspiel der sieben Glieder und warum ihre ausgewogene Kultivierung so entscheidend ist.







