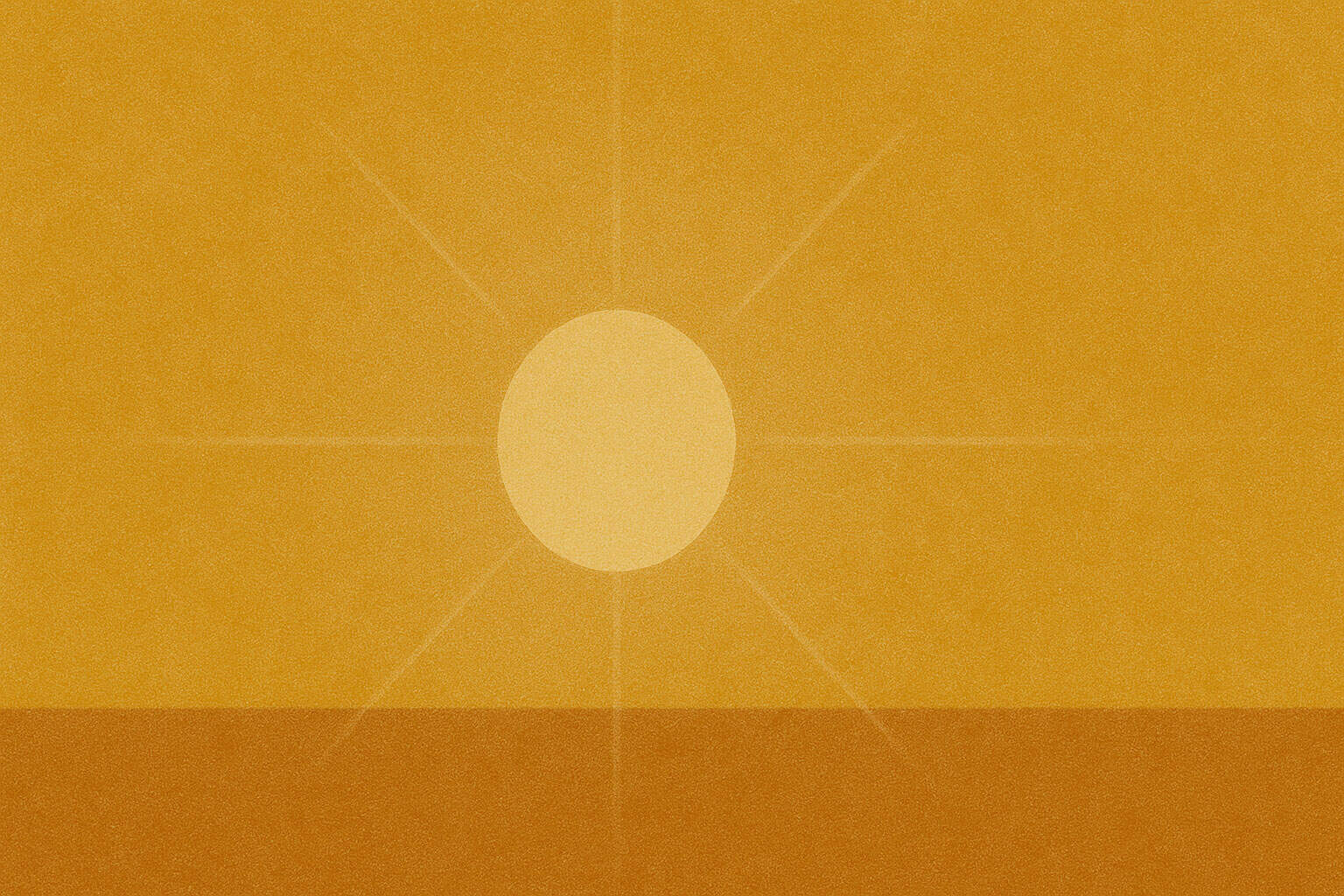
Das Dritte Jhāna im Pāli-Kanon: Eine Analyse von Glück, Gleichmut und verkörperter Erfahrung
Die Architektur der meditativen Vertiefung und des verkörperten Glücks
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Architektur der Vertiefung
- Definition und Kernmerkmale des Dritten Jhāna
- Kontext und Abgrenzung im Stufenweg der Jhānas
- Die zentrale Kontroverse: Kāyena Paṭisaṁvedeti – Erfahrung „mit dem Körper“
- Das Dritte Jhāna in Schlüssel-Lehrreden
- Fazit: Die Bedeutung des Dritten Jhāna für den Befreiungsweg
- Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung: Die Architektur der Vertiefung
Im Herzen der buddhistischen Meditationslehre, als achtes und letztes Glied des Edlen Achtfachen Pfades, steht die Rechte Sammlung (Sammā-Samādhi). Der Kanon definiert diese Praxis vornehmlich durch die vier meditativen Vertiefungen der Form-Sphäre, die Rūpa-Jhānas. Diese Zustände sind weit mehr als bloße Entspannungsübungen; sie sind die „himmlische Wohnstatt“ (Dibba-Vihāra), in der der Buddha selbst gerne verweilte, und bilden die unverzichtbare Grundlage für die Entwicklung befreiender Einsicht (Vipassanā). Innerhalb dieser progressiven Verfeinerung des Geistes nimmt das Dritte Jhāna (Tatiya-Jhāna) eine besondere Stellung ein. Es wird als ein bemerkenswerter Zustand beschrieben, der sich durch ein Höchstmaß an subtilem Glück (Sukha) auszeichnet, das jedoch von einer tiefen, wachen Ausgeglichenheit (Upekkhā) durchdrungen ist. Es repräsentiert den Gipfelpunkt des meditativen Wohlbefindens, bevor auch dieses im noch subtileren Vierten Jhāna überstiegen wird. In diesem Text erfährst du mehr über die Definition, die Merkmale und die zentralen interpretatorischen Kontroversen des Dritten Jhāna, wie sie sich aus den frühesten Lehrreden des Pāli-Kanons ergeben.
Definition und Kernmerkmale des Dritten Jhāna
Die Essenz des Dritten Jhāna wird in zahlreichen Lehrreden des Pāli-Kanons durch eine präzise Standardformel erfasst. Diese Formel ist nicht nur eine technische Beschreibung, sondern eine phänomenologische Landkarte, die dir den Weg in diesen Zustand und seine einzigartige Qualität aufzeigt.
Die kanonische Formel
Die am häufigsten zitierte Beschreibung des Eintritts in das Dritte Jhāna findet sich unter anderem im Vibhaṅga-Sutta (SN 45.8, „Die Analyse“). Der Pāli-Text lautet:
Pītiyā Ca Virāgā Upekkhako Ca Viharati, Sato Ca Sampajāno, Sukhañca Kāyena Paṭisaṃvedeti, Yaṃ Taṃ Ariyā Ācikkhanti: ‘Upekkhako Satimā Sukhavihārī’ti Tatiyaṃ Jhānaṃ Upasampajja Viharati.
Eine schrittweise Analyse der Begriffe offenbart die psychologische Tiefe dieses Zustands:
- Pītiyā Ca Virāgā: „Und mit der Abwendung/dem Verblassen von der Verzückung…“ – Dies markiert den entscheidenden Übergang vom Zweiten Jhāna.
- Upekkhako Ca Viharati: „…verweilt er gleichmütig…“ – Ein Zustand stabiler, unerschütterlicher Ausgeglichenheit tritt in den Vordergrund.
- Sato Ca Sampajāno: „…und achtsam und klar wissend…“ – Die geistige Klarheit und Präsenz bleiben voll erhalten und werden sogar verfeinert.
- Sukhañca Kāyena Paṭisaṃvedeti: „…erfährt er Glück mit dem Körper.“ – Dies ist die zentrale, kontrovers diskutierte Phrase des Dritten Jhāna.
- Yaṃ Taṃ Ariyā Ācikkhanti: ‘Upekkhako Satimā Sukhavihārī’ti: „…jenen Zustand, von dem die Edlen sagen: ‚Gleichmütig und achtsam, verweilt er glückselig‘.“ – Ein bemerkenswertes Zitat, das die Qualität des Zustands bestätigt.
Vom Rausch zum stillen Glück: Das Schwinden von Pīti
Der Eintritt in das Dritte Jhāna ist untrennbar mit dem Überwinden von Pīti verbunden. Die Texte unterscheiden klar zwischen Pīti (Verzückung) und Sukha (Glück). Pīti ist ein ekstatisch-aufgeregter Zustand, oft mit starken körperlichen Empfindungen wie Schauern oder Vibrationen verbunden. Sukha hingegen ist ein tiefes, ruhiges und stabiles Wohlgefühl. Während das Zweite Jhāna von der aufwogenden Energie der Pīti geprägt ist, wird diese im Dritten Jhāna als zu grob und unruhig erkannt und losgelassen. Das Rahogata-Sutta (SN 36.11, „Allein“) bestätigt dies explizit: Tatiyaṃ Jhānaṃ Samāpannassa Pīti Niruddhā Hoti – „Für jemanden, der die dritte Vertiefung erreicht hat, ist die Verzückung (Pīti) zur Ruhe gekommen“. Der hier verwendete Begriff Virāga („Abwendung“, „Fading“) ist dabei von entscheidender Bedeutung. Er bezeichnet mehr als nur ein passives Verblassen. Virāga ist ein zentraler Begriff auf dem buddhistischen Befreiungsweg und impliziert eine aktive Abwendung, die aus Einsicht geboren wird. Du lässt Pīti nicht einfach hinter dir, weil es von selbst verschwindet, sondern weil du dessen unbefriedigenden, aufgeregten Charakter im Vergleich zum subtileren und friedvolleren Sukha erkennst. Dieser Übergang ist somit selbst ein Akt der Weisheit und zeigt die enge Verflechtung von Geistesruhe (Samatha) und Einsicht (Vipassanā) bereits auf dem Weg durch die Jhānas.
Die paradoxe Harmonie: Sukha und Upekkhā
Das Dritte Jhāna ist einzigartig in seiner Fähigkeit, zwei scheinbar gegensätzliche Qualitäten zu vereinen: intensives Glück (Sukha) und vollkommenen Gleichmut (Upekkhā). Upekkhā ist hier keine Apathie oder Indifferenz. Der Kommentator Buddhaghosa unterscheidet zehn verschiedene Arten von Gleichmut, und die hier präsente Jhānupekkhā ist eine wache, stabile und perfekt ausbalancierte Geisteshaltung. Sie rahmt das Glücksgefühl, ohne es zu unterdrücken; sie erlaubt dem Sukha, den Geist vollständig zu durchdringen, ohne dass Anhaftung oder Erregung entstehen. Dieses Sukha wird als das höchste und verfeinertste angenehme Gefühl (Sukha-Vedanā) beschrieben, das ein Wesen erfahren kann. Es ist eine zarte, heilsame und friedvolle Qualität, die organisch auch liebevolle Güte (Mettā) beinhalten kann.
Die Beschreibung der Edlen: Upekkhako Satimā Sukhavihārī
Die kanonische Formel enthält ein Zitat: Der Zustand wird als einer beschrieben, „von dem die Edlen (Ariyā) sagen: ‚Gleichmütig, achtsam, verweilt er glückselig‘“. Diese Referenz auf die bereits erwachten Praktizierenden ist im Kanon ungewöhnlich und verleiht dem Dritten Jhāna ein besonderes Gütesiegel. Es signalisiert, dass dieses Glück nicht nur ein angenehmes Nebenprodukt der Konzentration ist, sondern ein für den Befreiungsweg wertvoller Zustand – ein Glück, das förderlich für den Weg zur Befreiung ist und von denjenigen, die das Ziel erreicht haben, anerkannt wird.
Kontext und Abgrenzung im Stufenweg der Jhānas
Jede Jhāna-Stufe ist eine Verfeinerung der vorhergehenden, erreicht durch das Loslassen der jeweils gröbsten verbliebenen Faktoren. Verfeinerung des Zweiten Jhāna: Der Übergang vom Zweiten zum Dritten Jhāna erfolgt durch das Erkennen und Loslassen des Faktors Pīti. Während das Zweite Jhāna von der aus der Sammlung geborenen, aufwogenden Energie der Verzückung geprägt ist, tritt im Dritten Jhāna ein ruhiges, alles durchdringendes Glück an seine Stelle. Abgrenzung zum Vierten Jhāna: Der nächste Schritt, der Eintritt in das Vierte Jhāna, wird durch das Aufgeben des letzten und subtilsten positiven Gefühls, Sukha, vollzogen. Das Ergebnis ist ein Zustand reiner, durch Gleichmut geläuterter Achtsamkeit (Upekkhā-Sati-Pārisuddhi), der als „weder-schmerzhaft-noch-angenehm“ beschrieben wird und eine noch tiefere Ebene der Stille darstellt. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Progression und das Prinzip des schrittweisen Loslassens (Vossagga).
| Jhāna-Stufe | Anwesende Faktoren | Abwesende/Überwundene Faktoren | Kanonische Beschreibung (Kurzform) |
|---|---|---|---|
| Erstes Jhāna | Vitakka (Gedankenfassen), Vicāra (Gedankenprüfen), Pīti (Verzückung), Sukha (Glück), Ekaggatā (Einspitzigkeit) | Fünf Hindernisse | Geboren aus Abgeschiedenheit |
| Zweites Jhāna | Pīti, Sukha, Ekaggatā | Vitakka, Vicāra | Geboren aus Sammlung (Samādhi) |
| Drittes Jhāna | Sukha, Ekaggatā (sowie Upekkhā & Sati) | Pīti | Gleichmütig, achtsam, glückselig verweilend |
| Viertes Jhāna | Upekkhā, Ekaggatā | Sukha (und Dukkha) | Reinheit von Gleichmut und Achtsamkeit |
Die zentrale Kontroverse: Kāyena Paṭisaṃvedeti – Erfahrung „mit dem Körper“
Der Kernsatz Sukhañca Kāyena Paṭisaṃvedeti („er erfährt Glück mit dem Körper“) ist der Angelpunkt einer fundamentalen Debatte über die Natur und Tiefe der Jhāna-Erfahrung. Die Interpretation dieses einen Wortes, Kāya, bestimmt maßgeblich das Verständnis der meditativen Praxis.
Interpretation 1: Der physische Körper (Rūpakāya)
Die wörtliche Lesart besagt, dass das Glücksgefühl im oder durch den physischen Körper erfahren wird. Diese Interpretation hat weitreichende Konsequenzen. Wenn das Bewusstsein des physischen Körpers erhalten bleibt, deutet dies auf eine leichtere Form der Absorption hin. In einem solchen Zustand wären externe Sinneswahrnehmungen (wie Hören) und möglicherweise sogar komplexe Handlungen (wie Gehen) theoretisch denkbar. Diese Sichtweise, oft als „Sutta-Jhāna“ bezeichnet, wird durch Passagen im Kanon gestützt, in denen Meditierende in Zuständen beschrieben werden, die eine solche Durchlässigkeit zur Außenwelt nahelegen. Ein solches Modell ermöglicht die gleichzeitige oder eng verwobene Praxis von Ruhe (Samatha) und Einsicht (Vipassanā), da der Geist konzentriert, aber nicht völlig von seinen Wahrnehmungsobjekten abgekoppelt ist.
Interpretation 2: Der mentale Körper (Nāmakāya) oder „persönlich“
Die alternative Interpretation argumentiert, dass Kāya hier idiomatisch verwendet wird. Es kann „Gruppe“ oder „Sammlung“ bedeuten und sich auf den Nāmakāya beziehen – den „mentalen Körper“, der aus Gefühl (Vedanā), Wahrnehmung (Saññā), Geistesformationen (Saṅkhārā) und Bewusstsein (Viññāṇa) besteht. In diesem Fall würde das Glück die Gesamtheit der mentalen Erfahrung durchdringen. Eine andere, von prominenten Übersetzern wie Bhikkhu Sujato und Gelehrten wie Bhikkhu Analayo favorisierte Lesart, übersetzt Kāyena adverbial als „persönlich“, „direkt“ oder „unmittelbar“. Diese Lesart stützt ein Modell tiefer Absorption, bei dem die Wahrnehmung des physischen Körpers und der externen Sinne vollständig zur Ruhe kommt. Dies nähert sich der im Visuddhimagga – einem maßgeblichen Kommentarwerk aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. – systematisierten Vorstellung von Jhāna als Zustand völliger Versenkung (Appanā-Samādhi) an. In diesem sequentiellen Modell wird zuerst durch tiefe Sammlung ein extrem reiner und kraftvoller Geisteszustand erzeugt, der dann nach dem Austritt aus dem Jhāna für die Einsichtspraxis genutzt wird.
Die philologische Debatte um Kāyena ist somit keine rein akademische Spitzfindigkeit. Sie legt die Grundlage für zwei unterschiedliche meditative Pfadmodelle, die bis heute die buddhistische Praxislandschaft prägen: den integrierten Pfad, bei dem Einsicht auch in leichteren Konzentrationszuständen möglich ist, und den sequentiellen Pfad, der tiefe Absorption als Voraussetzung für effektive Einsicht betont. Die interpretatorische Offenheit des Kanons selbst liefert beiden Ansätzen eine textuelle Grundlage. Ein entscheidendes Indiz für die idiomatische Verwendung von Kāya liefert der Begriff Kāyasakkhi („Körper-Zeuge“). Dieser Titel wird für Praktizierende verwendet, die die formlosen Vertiefungen (Arūpa-Jhānas) gemeistert haben und die „todlose Sphäre mit dem Körper berühren“ (Amataṁ Dhātuṁ Kāyena Phusitvā). Da die formlosen Reiche per definitionem frei von jeder Wahrnehmung von Form und damit des physischen Körpers sind, muss Kāya hier eine über-physische, metaphorische Bedeutung haben. Es ist daher sehr plausibel, dass der Begriff auch in der Beschreibung des Dritten Form-Jhāna dieselbe idiomatische Tiefe besitzt, was die Interpretation einer tiefen, mentalen Absorption stützt.
Das Dritte Jhāna in Schlüssel-Lehrreden
Zwei Lehrreden sind besonders prominent in ihrer Beschreibung des Dritten Jhāna und seiner Qualitäten.
DN 2: Sāmaññaphala-Sutta (Die Früchte des Asketenlebens)
In dieser Lehrrede fragt König Ajātasattu den Buddha nach einem sichtbaren, unmittelbaren Lohn des spirituellen Lebens. Als Teil seiner Antwort beschreibt der Buddha die Jhānas und verwendet für das Dritte Jhāna ein eindringliches Gleichnis: Es ist wie mit einem Lotosteich, in dem einige Lotosblumen im Wasser geboren, im Wasser gewachsen, untergetaucht gedeihen und nicht aus dem Wasser herausragen. Sie sind von den Wurzeln bis zur Spitze von kühlem Wasser durchdrungen, durchfeuchtet, erfüllt und überströmt, und es gibt keinen Teil von ihnen, der nicht von kühlem Wasser durchdrungen wäre. Dieses Bild der totalen Immersion ist ein starkes Argument für eine tiefe Absorption. Die Lotusblume ist vollständig von der Welt außerhalb des Wassers – der „Luft“ der externen Sinneswahrnehmungen – abgeschottet. Sie ist in ihrem Element, dem kühlen Wasser des Sukha, vollkommen eingetaucht. Dieses kanonische Gleichnis stützt die Interpretation von Kāyena als einer inneren, den gesamten mentalen Raum erfüllenden Erfahrung und steht im Einklang mit dem tiefen Absorptionsmodell, das später im Visuddhimagga systematisiert wurde.
MN 77: Mahāsakuludāyi-Sutta (Die längere Lehrrede an Sakuludāyin)
In dieser Rede erklärt der Buddha, dass seine Schüler ihn nicht wegen oberflächlicher Askese, sondern wegen der tiefen Lehre und Praxis, einschließlich der Jhānas, verehren. Das Sutta wiederholt die Standardformeln und das Lotus-Gleichnis für das Dritte Jhāna und positioniert es als eine überlegene Form des Glücks, die weit über weltliche Freuden hinausgeht.
Fazit: Die Bedeutung des Dritten Jhāna für den Befreiungsweg
Das Dritte Jhāna stellt einen einzigartigen Höhepunkt auf dem meditativen Pfad dar. Es verbindet ein tiefes, subtiles und heilsames Glück (Sukha) mit vollkommener, wacher Gelassenheit (Upekkhā) und Achtsamkeit (Sati). Es ist der friedvollste Zustand, der noch ein positives Gefühl enthält, und wird von den Erwachten selbst als ein „glückseliges Verweilen“ gepriesen. Die anhaltende Debatte über die genaue Natur der Erfahrung – ob sie den physischen Körper einschließt oder ihn transzendiert – ist kein Zeichen für einen Widerspruch im Kanon. Vielmehr spiegelt sie die semantische Tiefe der Lehre und die unterschiedlichen Wege wider, auf denen die Balance zwischen Ruhe und Einsicht in der buddhistischen Tradition konzeptualisiert und praktiziert wurde. Unabhängig von der letztendlichen Tiefe der Absorption lehrt dich das Dritte Jhāna eine universelle Lektion: Wahres, stabiles Glück wird nicht durch das Greifen nach aufgeregten Freuden, sondern durch das Loslassen und Verfeinern des Geistes gefunden. Es ist ein entscheidender Schritt zur Überwindung der Anhaftung an grobe Gefühle und bereitet den Geist auf die noch subtilere Ebene des Vierten Jhāna und die endgültige Befreiung vor.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Audio-Vorträge & Geleitete Meditationen- Fred von Allmen: Dharma-Vorträge (Audio-Archiv) – Umfangreiches Archiv mit Anleitungen zu Vipassanā, Metta und Geistesschulung.
- BuddhasLehre: YouTube-Kanal – Traditionsübergreifende Audio- und Videothek, gut geeignet für geführte Meditationen verschiedener Lehrer.
- Bhikkhu Anālayo: Satipaṭṭhāna-Studien – Essenzielle Ressourcen (u.a. Universität Hamburg) für das detaillierte Verständnis der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
- SATI Institut: Der Weg der Achtsamkeit (PDF) – Ein kompakter Leitfaden zur praktischen Anwendung des Satipaṭṭhāna.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefgründige Artikel, die meditative Erfahrungen oft mit westlicher Psychologie verknüpfen.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte und Artikel – Schriftliche Erläuterungen zu spezifischen Meditationshindernissen und Herzensqualitäten.
- Dhamma Dana: Praxis-Bücher (BGM) – Kostenlose E-Books und Meditationshandbücher (z.B. von Ajaan Lee oder Mahasi Sayadaw).
- Palikanon.com: Suttas & Wörterbuch – Die Primärquelle für die klassischen Meditationstexte (z.B. Satipaṭṭhāna Sutta, Ānāpānasati Sutta).
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – Systematische Aufbereitung der Lehre, hilfreich für die Einordnung der Meditation in den Gesamtpfad.
- Theravāda-Netz: Suttensuche & Texte – Gute Quelle für spezifische Suttas und Studienmaterial zur Vertiefung.
- BuddhaStiftung: Glossar – Kurze, prägnante Definitionen zu den Grundlagen der Achtsamkeit.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Für den schnellen Überblick und Querverweise.
Weiter in diesem Bereich mit …
Das Vierte Jhāna (Catuttha-Jhāna)
Hier erreichst du den Gipfel der formhaften Vertiefungen. Das Vierte Jhāna (Catuttha-Jhāna) wird als ein Zustand unvergleichlicher mentaler Stabilität und Klarheit beschrieben. Du lernst, wie durch das Aufgeben selbst des subtilsten Glücksgefühls ein Zustand „jenseits von Leid und Glück“ (Adukkhamasukha) entsteht. Verstehe, warum die hier erlangte, durch Gleichmut geläuterte Achtsamkeit (Upekkhā-Sati-Pārisuddhiṃ) als die ideale und kraftvollste Plattform für die Entwicklung befreiender Einsicht und der höheren Geisteskräfte gilt.







