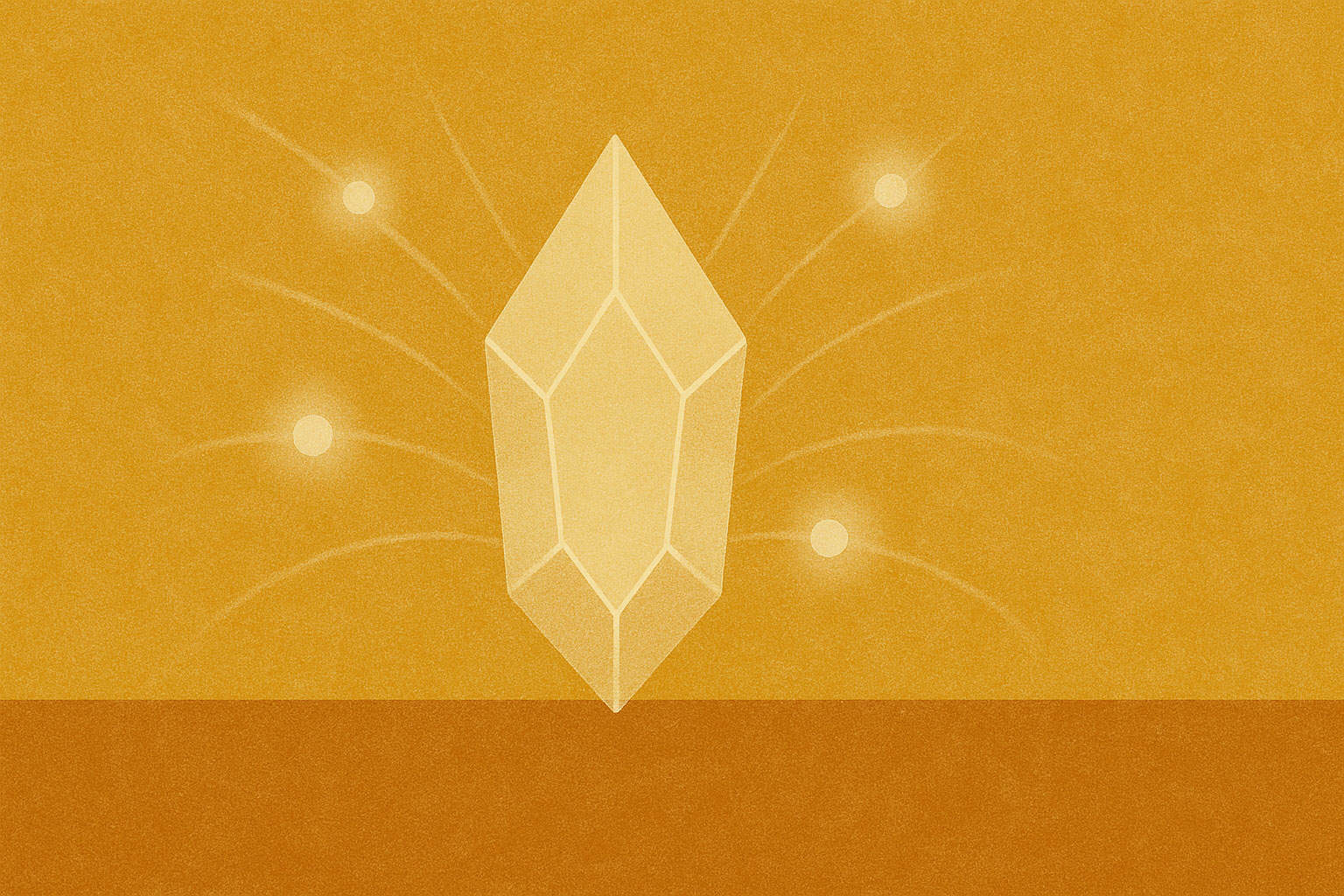
Das Erste Jhāna (Paṭhama-Jhāna) im Pāli-Kanon: Eine detaillierte Analyse von Zustand, Faktoren und Interpretation
Das Tor zur tiefen Sammlung und die erste Stufe der Rechten Sammlung (Sammā-Samādhi)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Das Tor zur tiefen Sammlung
Im Herzen der meditativen Praxis, wie sie im Pāli-Kanon, den frühesten Schriften des Buddhismus, überliefert ist, stehen die meditativen Vertiefungen, die als Jhānas bekannt sind. Sie repräsentieren Zustände außergewöhnlicher geistiger Sammlung (Samādhi), Klarheit und Glückseligkeit. Das Erste Jhāna, auf Pāli Paṭhama-Jhāna, bildet dabei den fundamentalen Einstieg in diese tiefgreifenden Bewusstseinsebenen. Entgegen einer in der modernen westlichen Meditationslandschaft verbreiteten Fokussierung auf reine Achtsamkeitspraktiken, legen die Lehrreden (Suttas) des Buddha ein enormes Gewicht auf die Entwicklung von Samādhi, die in den Jhānas gipfelt.
Eine statistische Analyse des Sutta-Piṭaka, des Korbes der Lehrreden, offenbart die zentrale Bedeutung dieser Praxis: Der Begriff Paṭhamaṃ Jhānaṃ (das erste Jhāna) erscheint dort fast dreimal so häufig wie Cattāro Satipaṭṭhānā (die vier Grundlagen der Achtsamkeit). Lässt man den Saṃyutta-Nikāya (die Gruppierte Sammlung) außer Acht, der das berühmte Satipaṭṭhāna-Sutta enthält, wird das Erste Jhāna sogar über fünfmal häufiger erwähnt. Diese Prävalenz unterstreicht, dass die Jhānas in der frühen buddhistischen Tradition nicht als esoterische Nebenpraxis, sondern als ein zentrales und erwartetes Ergebnis des Weges angesehen wurden.
Die Jhānas sind fest im Edlen Achtfachen Pfad verankert, dem Kernstück der buddhistischen Lehre. Sie stellen die kanonische Definition der „Rechten Sammlung“ (Sammā-Samādhi) dar, des achten und letzten Gliedes dieses Pfades. Das Magga-Vibhaṅga-Sutta (Analyse des Pfades, SN 45.8) definiert die Rechte Sammlung explizit durch die Beherrschung der vier Jhānas. Das Erste Jhāna ist somit kein beliebiger Zustand, sondern die erste Stufe der Verwirklichung des meditativen Zweigs des Befreiungspfades.
Dieser Beitrag hat zum Ziel, dir eine umfassende und nuancierte Darstellung des Ersten Jhāna zu liefern. Du wirst seine Definition, die notwendigen Voraussetzungen und seine charakteristischen Faktoren detailliert kennenlernen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Klärung der zentralen Kontroverse um die verbleibende geistige Aktivität (Vitakka und Vicāra) in diesem Zustand. Schließlich wird seine Funktion als kraftvolle Basis für die Entwicklung von befreiender Weisheit (Paññā) im Kontext zentraler Lehrreden des Pāli-Kanons analysiert.
Teil I: Die Anatomie des Ersten Jhāna
A. Die Voraussetzung: Die Läuterung des Geistes von den Fünf Hindernissen (Pañca Nīvaraṇāni)
Bevor dein Geist in die tiefen und klaren Zustände der Jhānas eintreten kann, muss er von bestimmten mentalen Qualitäten gereinigt werden, die ihn trüben und schwächen. Diese werden als die Fünf Hindernisse (Pañca Nīvaraṇāni) bezeichnet. Die Suttas beschreiben sie als „Verderbnisse des Geistes, die die Weisheit schwächen“ (Cittassa Upakkilesā Paññāya Dubbalīkaraṇā). Ihre vorübergehende Überwindung ist die unabdingbare Voraussetzung für jede Form tiefer Konzentration und den Eintritt ins Erste Jhāna.
Die fünf Hindernisse sind:
- Sinnliches Begehren (Kāmacchanda): Das ständige Greifen nach und Verlangen nach angenehmen Erfahrungen durch die fünf Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten). Es zieht die Aufmerksamkeit nach außen und verhindert Zufriedenheit im gegenwärtigen Moment.
- Übelwollen (Byāpāda): Das gesamte Spektrum negativer, ablehnender Emotionen, von leichter Gereiztheit und Ärger bis hin zu tiefem Hass und Groll gegenüber Personen, Situationen oder sich selbst.
- Trägheit und Mattheit (Thīna-Middha): Ein Zustand geistiger Stumpfheit, Apathie und körperlicher Energielosigkeit. Er äußert sich als Desinteresse, Schläfrigkeit und mangelnde Motivation für die Praxis.
- Unruhe und Sorge (Uddhacca-Kukkucca): Ein Zwillingshindernis. Uddhacca ist die geistige Unruhe, das unkontrollierte Umherschweifen der Gedanken. Kukkucca bezeichnet Sorgen, Bedauern über vergangene Taten oder Gewissensunruhe.
- Skeptischer Zweifel (Vicikicchā): Ein lähmendes Misstrauen und eine Unentschlossenheit, die das Vertrauen (Saddhā) in die Lehre, den Lehrer oder die eigene Fähigkeit, den Weg zu gehen, untergräbt.
Um die Wirkung dieser Hindernisse und die Erfahrung ihrer Überwindung zu veranschaulichen, verwenden die Suttas zwei eindrucksvolle Sätze von Gleichnissen. Der erste Satz beschreibt die erlebbare Qualität des behinderten Geistes – seinen Mangel an Klarheit. Der zweite Satz beschreibt die tiefgreifende emotionale und existenzielle Erleichterung, die mit ihrer Beseitigung einhergeht. Die Freude (Pīti) und das Glück (Sukha) des Ersten Jhāna werden als „aus der Abgeschiedenheit geboren“ (Vivekaja) bezeichnet, eben weil diese tiefgreifende psychologische Befreiung stattgefunden hat. Die Wasser-Gleichnisse, unter anderem aus dem Saṃyutta-Nikāya, vergleichen den von den Hindernissen getrübten Geist mit Wasser, in dem man sein Spiegelbild nicht klar erkennen kann. Die Freiheits-Gleichnisse aus dem Mahā-Assapura-Sutta (MN 39) beschreiben die Hindernisse als Zustände des Leidens und der Unfreiheit. Die folgende Tabelle fasst diese Analogien zusammen:
| Hindernis (Pāli) | Kernproblem | Wasser-Metapher (Geisteszustand) | Befreiungs-Metapher (Überwindung) |
|---|---|---|---|
| Kāmacchanda | Sinnliches Begehren | Mit Farbe vermischtes Wasser | Schuldenfreiheit |
| Byāpāda | Übelwollen, Hass | Kochendes Wasser | Genesung von Krankheit |
| Thīna-Middha | Trägheit, Mattheit | Von Algen bedecktes Wasser | Befreiung aus dem Gefängnis |
| Uddhacca-Kukkucca | Unruhe, Sorge | Von Wind aufgewühltes Wasser | Freiheit von Sklaverei |
| Vicikicchā | Skeptischer Zweifel | Trübes Wasser im Dunkeln | Ankunft an einem sicheren Ort |
Der Übergang zum Jhāna ist somit mehr als eine technische Verschiebung der Konzentration. Ihm geht eine tiefgreifende Erfahrung der Befreiung und Entlastung voraus, die die direkte Ursache für die nachfolgende Freude und das Glück des meditativen Zustandes ist.
B. Die Standardformel: Definition aus den Lehrreden
Die Beschreibung des Ersten Jhāna folgt im gesamten Pāli-Kanon einer bemerkenswert konsistenten Standardformel, die hunderte Male wiederholt wird. Dies unterstreicht ihren Status als fest etablierter technischer Begriff. Die Formel lautet:
Idha, Bhikkhave, Bhikkhu Vivicceva Kāmehi, Vivicca Akusalehi Dhammehi, Savitakkaṃ Savicāraṃ Vivekajaṃ Pītisukhaṃ Paṭhamaṃ Jhānaṃ Upasampajja Viharati.
Übersetzung: „Da, ihr Mönche, tritt ein Mönch, ganz abgeschieden von den Sinnenfreuden, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, in das Erste Jhāna ein, das von Denken und Nachsinnen begleitet ist, und das aus dieser Abgeschiedenheit geborene Verzückung und Glückseligkeit aufweist, und verweilt darin.“
Die Formulierung Savitakkaṃ Savicāraṃ ist grammatikalisch aufschlussreich. Das Präfix Sa- bedeutet „mit“, und die Akkusativendung zeigt, dass es sich um Adjektive handelt, die den Zustand des Jhāna qualifizieren und beschreiben.
C. Die Fünf Faktoren des Ersten Jhāna (Jhānaṅga)
Der Zustand des Ersten Jhāna wird durch das Vorhandensein von fünf charakteristischen mentalen Faktoren (Jhānaṅga) definiert, die zusammenwirken, um den Geist in diesen Zustand zu heben und ihn dort zu stabilisieren.
- 1. & 2. Vitakka & Vicāra (Denken & Nachsinnen):
Diese beiden Faktoren sind die umstrittensten und werden in Teil II dieses Berichts ausführlich behandelt. Vorläufig können sie als eine Form von „Gedankenfassen“ und „Gedankenerwägen“ oder „Denken“ und „Nachsinnen“ verstanden werden. Sie repräsentieren eine verbleibende, subtile Form geistiger Aktivität. - 3. Pīti (Verzückung, Freude):
Pīti ist eine aufgeregte, energetisierende Form der Freude oder ein intensives Interesse, das den Körper und Geist durchdringt. Es wird in der buddhistischen Psychologie (Abhidhamma) nicht als Gefühl (Vedanā), sondern als Geistesformation (Saṅkhāra) klassifiziert. Die Kommentare unterscheiden fünf Stufen von Pīti, die von einem leichten Interesse bis hin zu überwältigender, den Körper hebender Ekstase reichen können. - 4. Sukha (Glückseligkeit, Wohlgefühl):
Sukha ist ein ruhigeres, stabileres und tieferes Glücksgefühl, das oft aus der Beruhigung der anfänglichen Aufregung von Pīti hervorgeht. Im Gegensatz zu Pīti wird Sukha als Gefühl (Vedanā) klassifiziert. Das berühmte Gleichnis vom Wüstenreisenden aus dem Visuddhimagga, einem späteren Kompendium, illustriert den Unterschied treffend: Ein erschöpfter Reisender, der in der Wüste eine Oase erblickt oder von ihr hört, empfindet Pīti – die aufgeregte Freude der Erwartung und Erleichterung. Wenn er die Oase jedoch erreicht, sich in den Schatten setzt und das kühle Wasser trinkt, erfährt er Sukha – das tatsächliche, beruhigende Erleben des Wohlgefühls. - 5. Ekaggatā (Einspitzigkeit des Geistes):
Ekaggatā bezeichnet die Fähigkeit des Geistes, ungeteilt und stabil auf einem einzigen Objekt zu ruhen – die Essenz der Konzentration. Während dieser Faktor im Ersten Jhāna zweifellos vorhanden ist, scheint seine Rolle in der späteren kommentatorischen Tradition stärker betont zu werden. Die Suttas selbst assoziieren die vollkommene „Einheit des Geistes“ (Ekodibhāva) explizit mit dem Zweiten Jhāna, das erst nach dem Stillwerden von Vitakka und Vicāra erreicht wird. Dies legt nahe, dass die Einspitzigkeit im Ersten Jhāna zwar vorhanden, aber noch nicht absolut oder voll ausgereift ist. Die Anwesenheit subtiler geistiger Bewegung (Vitakka/Vicāra) bedeutet naturgemäß, dass der Geist noch nicht vollkommen „ein-spitzig“ ist. Die spätere Systematik des Abhidhamma, die bestrebt war, fünf Gegenmittel für die fünf Hindernisse zu finden, hat Ekaggatā möglicherweise zu einem expliziteren Faktor des Ersten Jhāna erhoben und dabei die fließende, übergangshafte Natur dieses Zustandes, wie sie in den Suttas beschrieben wird, etwas in den Hintergrund gerückt.
Teil II: Die zentrale Kontroverse – Denken oder Nicht-Denken?
Eines der am intensivsten diskutierten Themen bezüglich des Ersten Jhāna ist die Bedeutung der Faktoren Vitakka und Vicāra. Die Interpretation dieser beiden Begriffe entscheidet darüber, ob das Erste Jhāna ein Zustand mit Restgedanken oder ein Zustand völliger Gedankenstille ist.
A. Die kommentatorische Lesart: Vitakka/Vicāra als Aufmerksamkeitslenkung
Die spätere kommentatorische Tradition, maßgeblich geprägt durch das Werk Visuddhimagga von Buddhaghosa aus dem 5. Jahrhundert n. Chr., interpretiert diese Begriffe als technische Termini für die Mechanik der Aufmerksamkeit. Vitakka wird hier als „angewandtes Denken“ (applied thought) definiert – das erstmalige, aktive Hinlenken des Geistes auf das Meditationsobjekt (z. B. den Atem). Vicāra wird als „anhaltendes Denken“ (sustained thought) verstanden – das Verweilen und die kontinuierliche Untersuchung des Geistes beim Objekt. In dieser Lesart werden bildhafte Metaphern verwendet: Vitakka ist wie das Anschlagen einer Glocke, Vicāra ist ihr Nachklingen. Vitakka ist wie der kraftvolle Flügelschlag eines Vogels beim Abheben, Vicāra ist sein anschließendes, müheloses Gleiten in der Luft. Die entscheidende Implikation dieser Interpretation ist, dass jegliches diskursive, verbale Denken bereits vor dem Eintritt in das Erste Jhāna vollständig zur Ruhe gekommen sein muss. Das Jhāna selbst wäre demnach ein Zustand reiner, nicht-verbaler Aufmerksamkeitsfokussierung.
B. Die Sutta-basierte Lesart: Vitakka/Vicāra als subtiles Denken
Eine direkte Analyse der Lehrreden des Buddha legt jedoch eine andere Interpretation nahe: dass Vitakka und Vicāra ihre gebräuchliche Bedeutung von „Denken“ und „Nachsinnen“ beibehalten, wenn auch in einer sehr verfeinerten und heilsamen Form. Mehrere Argumente aus den Suttas stützen diese Sichtweise:
- Konsistenter Wortgebrauch: Der Begriff Vitakka wird im Pāli-Kanon fast ausnahmslos im Sinne von „Gedanke“ verwendet. Verbindungen wie Kāma-Vitakka (sinnlicher Gedanke), Byāpāda-Vitakka (Gedanke des Übelwollens) oder Nekkhamma-Vitakka (Gedanke der Entsagung) sind allgegenwärtig. Es ist philologisch unwahrscheinlich, dass ein so zentraler Begriff ausschließlich in der hochfrequenten Jhāna-Formel eine radikal andere, technische Bedeutung annimmt, ohne dass dies vom Buddha jemals explizit erklärt worden wäre.
- Beweis aus dem Dvedhāvitakka-Sutta (MN 19): In dieser Lehrrede berichtet der Buddha aus der Zeit vor seiner Erleuchtung. Er stellte fest, dass übermäßiges und langes Nachdenken und Nachsinnen (Aticiraṃ Anuvitakketi Anuvicāreti) den Körper ermüdet und den Geist von der Sammlung (Samādhi) entfernt. Dies impliziert jedoch nicht, dass jedes Denken der Sammlung entgegensteht, sondern nur das exzessive und unkontrollierte. Es legt nahe, dass eine subtile, beherrschte Form des Denkens mit dem Zustand der Sammlung vereinbar ist.
- Beweis aus dem Samaṇamuṇḍika-Sutta (MN 78): Diese Lehrrede stellt klar, dass unheilsame Absichten (Akusalā Saṅkappā) im Ersten Jhāna aufhören, aber heilsame Absichten (Kusalā Saṅkappā) – wie Gedanken der Entsagung, des Nicht-Übelwollens und der Harmlosigkeit – erst im Zweiten Jhāna vollständig zur Ruhe kommen. Da der Begriff Saṅkappa (Absicht, Gedanke) eng mit Vitakka verwandt ist, belegt dies direkt die Anwesenheit heilsamer, diskursiver Aktivität im Ersten Jhāna.
- Beweis aus alternativer Terminologie: Hätte der Buddha eine rein non-verbale Ausrichtung des Geistes auf ein Objekt gemeint, hätte er auf etablierte und eindeutige Begriffe zurückgreifen können. Phrasen wie Cittaṃ Abhininnāmeti („er richtet seinen Geist aus“) oder der Begriff Manasikāra („Aufmerksamkeit“, „geistiges Zuwenden“) kommen im Kanon häufig vor und beschreiben genau diese Funktion. Die bewusste und wiederholte Wahl von Vitakka und Vicāra deutet stark darauf hin, dass die konventionelle Bedeutung von „Denken“ und „Nachsinnen“ beabsichtigt war.
Zusammengenommen deuten diese Belege darauf hin, dass die Suttas eine graduelle Beruhigung des Denkens beschreiben, die im Ersten Jhāna noch nicht abgeschlossen ist.
Die folgende Tabelle stellt die beiden Interpretationen gegenüber:
| Aspekt | Kommentatorische Sicht (z. B. Visuddhimagga) | Sutta-basierte Sicht (moderne Forschung) |
|---|---|---|
| Bedeutung | „Angewandtes Denken“ & „Anhaltendes Denken“ (technische Termini für Aufmerksamkeitslenkung) | „Denken“ & „Nachsinnen“ (subtile diskursive Aktivität) |
| Funktion | Aktives Ausrichten und Halten des Geistes auf dem Meditationsobjekt. | Restaktivität des heilsamen Denkens, das noch nicht zur Ruhe gekommen ist. |
| Beziehung zu Denken | Denken hört bereits vor dem Ersten Jhāna auf. | Heilsames Denken ist im Ersten Jhāna noch präsent und endet erst im Zweiten. |
| Primärquelle | Abhidhamma und Kommentare (z. B. Visuddhimagga). | Direkte Analyse des Wortgebrauchs im Sutta-Piṭaka (z. B. MN 19, MN 78). |
C. Synthese: Das Erste Jhāna als Zustand „Hindernis-freier“ statt „Gedanken-freier“ Sammlung
Das Erste Jhāna ist somit nicht durch die Abwesenheit jeglicher geistiger Aktivität definiert, sondern durch die Qualität der vorhandenen Aktivität. Es ist ein Zustand, in dem der Geist frei von den Fünf Hindernissen ist. Der grobe, unkontrollierte und oft negative Strom des Alltagsdenkens ist zur Ruhe gekommen. Übrig bleibt eine subtile, lenkbare und heilsame geistige Bewegung, die sich auf die meditative Erfahrung selbst richtet. Es ist ein Zustand tiefen Friedens, großer Freude und wacher Klarheit, der weit entfernt ist von einer gedankenlosen Trance.
Teil III: Das Erste Jhāna im Kontext des buddhistischen Pfades
Die Funktion des Ersten Jhāna erschöpft sich nicht im Erleben eines angenehmen Zustandes. Es ist eine entscheidende Stufe auf dem Weg zur Befreiung, die sowohl als Ziel der Sammlung als auch als Ausgangspunkt für Weisheit dient.
A. Der Übergang: Vom Ersten zum Zweiten Jhāna
Die Definition des Zweiten Jhāna bestätigt indirekt die Natur des Ersten. Die Standardformel für das Zweite Jhāna beginnt mit den Worten:
Vitakkavicārānaṃ Vūpasamā Ajjhattaṃ Sampasādanaṃ Cetaso Ekodibhāvaṃ Avitakkaṃ Avicāraṃ Samādhijaṃ Pītisukhaṃ Dutiyaṃ Jhānaṃ…
Übersetzung: „Durch das Stillwerden von Denken und Nachsinnen tritt er in das Zweite Jhāna ein… das ohne Denken und Nachsinnen ist, aus der Sammlung geboren, mit innerer Stille und Einheit des Geistes…“
Der Übergang ist explizit durch das Aufhören von Vitakka und Vicāra definiert. Dies ist der deutlichste Beweis dafür, dass sie im Ersten Jhāna vorhanden waren. Das Ergebnis dieses Stillwerdens ist eine noch tiefere Ruhe und die „Einheit des Geistes“ (Ekodibhāva), was die These stützt, dass die Einspitzigkeit im Ersten Jhāna noch nicht vollendet war.
B. Schlüssel-Lehrreden zur Veranschaulichung der Funktion
Mehrere zentrale Lehrreden beleuchten die praktische Bedeutung des Ersten Jhāna aus unterschiedlichen Perspektiven.
- DN 2 (Sāmaññaphala-Sutta – Die Früchte des Asketenlebens):
In diesem Dialog fragt König Ajātasattu nach dem sichtbaren Nutzen des spirituellen Lebens. Der Buddha legt den Pfad dar, der von Ethik (Sīla) über die Überwindung der Hindernisse direkt in die Jhānas führt. Das Erste Jhāna wird als verkörperte, glückselige Frucht beschrieben, illustriert durch das Gleichnis vom Bademeister, dessen Wasserkugel vollständig gesättigt, aber nicht tropfend ist, um zu zeigen, wie der Körper von Verzückung und Glückseligkeit durchdrungen wird. - MN 39 (Mahā-Assapura-Sutta – Die längere Lehrrede bei Assapura):
Diese Lehrrede beschreibt die kausale Kette zur Sammlung: Ethik führt zu Schuldlosigkeit, dann zu Freude (Pāmojja), zu Verzückung (Pīti), zur Beruhigung des Körpers (Passaddhi), was zu Glückseligkeit (Sukha) führt. Ein glückseliger Geist sammelt sich leicht (Samādhi). Dieser Prozess gipfelt in der Überwindung der fünf Hindernisse, illustriert durch die Freiheits-Gleichnisse, und mündet direkt ins Erste Jhāna. - MN 52 (Aṭṭhakanāgara-Sutta – Die Lehrrede an den Mann aus Aṭṭhakanāgara):
Diese Lehrrede zeigt, dass Jhāna eine Plattform für Einsicht (Vipassanā) ist. Ānanda präsentiert die vier Jhānas als „Tore zur Befreiung“. Für das Erste Jhāna erklärt er, dass der Meditierende reflektiert: „Dieses Erste Jhāna ist bedingt und willentlich erzeugt. Was aber bedingt und willentlich erzeugt ist, das ist vergänglich, dem Aufhören unterworfen.“ Durch diese Einsicht kann die Zerstörung der Triebe (Āsavānaṃ Khaya) erlangt werden. - AN 4.123 (Paṭhamanānākaraṇa-Sutta – Die erste Lehrrede über die Unterschiede):
Diese Lehrrede beleuchtet die karmischen Konsequenzen der Jhānas. Jemand, der das Erste Jhāna meistert, kann in der Welt der Brahma-Gefährten wiedergeboren werden. Eine „ungebildete, gewöhnliche Person“ (Assutavā Puthujjano) wird danach wieder in leidvolle Daseinsbereiche zurückfallen. Ein „gebildeter edler Schüler“ (Sutavā Ariyasāvako) hingegen nutzt den Zustand, um aufgrund seiner Rechten Ansicht und seines Verständnisses der Vergänglichkeit im selben Dasein das endgültige Nibbāna zu erlangen (Tasmiṃyeva Bhave Parinibbāyati). Der meditative Zustand ist neutral; sein Ergebnis hängt von der Weisheit ab, mit der er betrachtet wird.
Schlussfolgerung: Die unverzichtbare erste Stufe
Die Analyse des Ersten Jhāna im Pāli-Kanon zeichnet das Bild eines tiefgreifenden, freudvollen und klaren Bewusstseinszustandes, der eine fundamentale Rolle auf dem buddhistischen Befreiungsweg spielt. Es ist das direkte Ergebnis der Reinigung des Geistes von den Fünf Hindernissen, ein Zustand, dessen Glückseligkeit aus der tiefen Erleichterung dieser mentalen Befreiung geboren wird. Die zentrale Kontroverse um die verbleibende geistige Aktivität lässt sich durch eine sorgfältige Lektüre der Suttas auflösen: Das Erste Jhāna ist nicht durch die völlige Abwesenheit von Gedanken, sondern durch die Abwesenheit von Hindernissen definiert. Eine subtile, heilsame und auf die Meditation gerichtete Form des Denkens und Nachsinnens (Vitakka und Vicāra) ist ein charakteristisches Merkmal dieses Zustandes, das erst mit dem Übergang zum noch tieferen und stilleren Zweiten Jhāna zur Ruhe kommt.
Das Erste Jhāna ist somit weit mehr als eine Konzentrationsübung. Es erfüllt eine doppelte Funktion von immenser Bedeutung: Einerseits ist es die konkrete Verwirklichung der Rechten Sammlung (Sammā-Samādhi), des kulminierenden Faktors des Edlen Achtfachen Pfades. Andererseits bietet es durch seine Stabilität, Klarheit und sein intensives Wohlgefühl die ideale, unerschütterliche Plattform, von der aus die befreiende Weisheit (Paññā) entwickelt werden kann – die Einsicht in die Vergänglichkeit, das Leid und die Nicht-Selbst-Natur aller Phänomene, einschließlich des Jhāna-Zustandes selbst. In dieser Doppelfunktion erweist sich das Erste Jhāna als eine fundamentale und unverzichtbare Stufe auf dem im Pāli-Kanon beschriebenen Weg zur Befreiung.
Referenzen & weiterführende Webseiten/Dokumente
Audio-Vorträge & Geleitete Meditationen- Fred von Allmen: Dharma-Vorträge (Audio-Archiv) – Umfangreiches Archiv mit Anleitungen zu Vipassanā, Metta und Geistesschulung.
- BuddhasLehre: YouTube-Kanal – Traditionsübergreifende Audio- und Videothek, gut geeignet für geführte Meditationen verschiedener Lehrer.
- Bhikkhu Anālayo: Satipaṭṭhāna-Studien – Essenzielle Ressourcen (u.a. Universität Hamburg) für das detaillierte Verständnis der vier Grundlagen der Achtsamkeit.
- SATI Institut: Der Weg der Achtsamkeit (PDF) – Ein kompakter Leitfaden zur praktischen Anwendung des Satipaṭṭhāna.
- Akincano Marc Weber: Texte & Essays – Tiefgründige Artikel, die meditative Erfahrungen oft mit westlicher Psychologie verknüpfen.
- Fred von Allmen: Dharma-Texte und Artikel – Schriftliche Erläuterungen zu spezifischen Meditationshindernissen und Herzensqualitäten.
- Dhamma Dana: Praxis-Bücher (BGM) – Kostenlose E-Books und Meditationshandbücher (z.B. von Ajaan Lee oder Mahasi Sayadaw).
- Palikanon.com: Suttas & Wörterbuch – Die Primärquelle für die klassischen Meditationstexte (z.B. Satipaṭṭhāna Sutta, Ānāpānasati Sutta).
- Suttanta-Gemeinschaft: Online-Bibliothek – Systematische Aufbereitung der Lehre, hilfreich für die Einordnung der Meditation in den Gesamtpfad.
- Theravāda-Netz: Suttensuche & Texte – Gute Quelle für spezifische Suttas und Studienmaterial zur Vertiefung.
- BuddhaStiftung: Glossar – Kurze, prägnante Definitionen zu den Grundlagen der Achtsamkeit.
- Wikipedia: Portal Buddhismus – Für den schnellen Überblick und Querverweise.
Weiter in diesem Bereich mit …
Das Zweite Jhāna (Dutiya-Jhāna)
Auf dieser Seite erforschst du den entscheidenden Wendepunkt der Versenkung: das Zweite Jhāna (Dutiya-Jhāna). Du wirst verstehen, wie das Verstummen des diskursiven Denkens (Vitakka und Vicāra) zu einer neuen, tieferen Stille führt. Lerne den Unterschied zwischen der Freude aus Abgeschiedenheit und der Freude, die direkt aus der Sammlung geboren ist (Samādhijaṃ Pītisukhaṃ), kennen und tauche ein in die zentrale Debatte, ob dieser Zustand eine totale sensorische Abschottung bedeutet oder eine tiefe innere Stille bei erhaltenem Bewusstsein ist.







