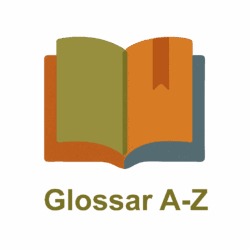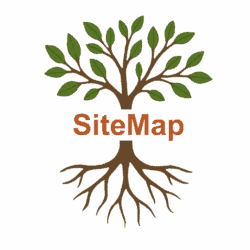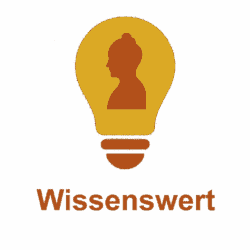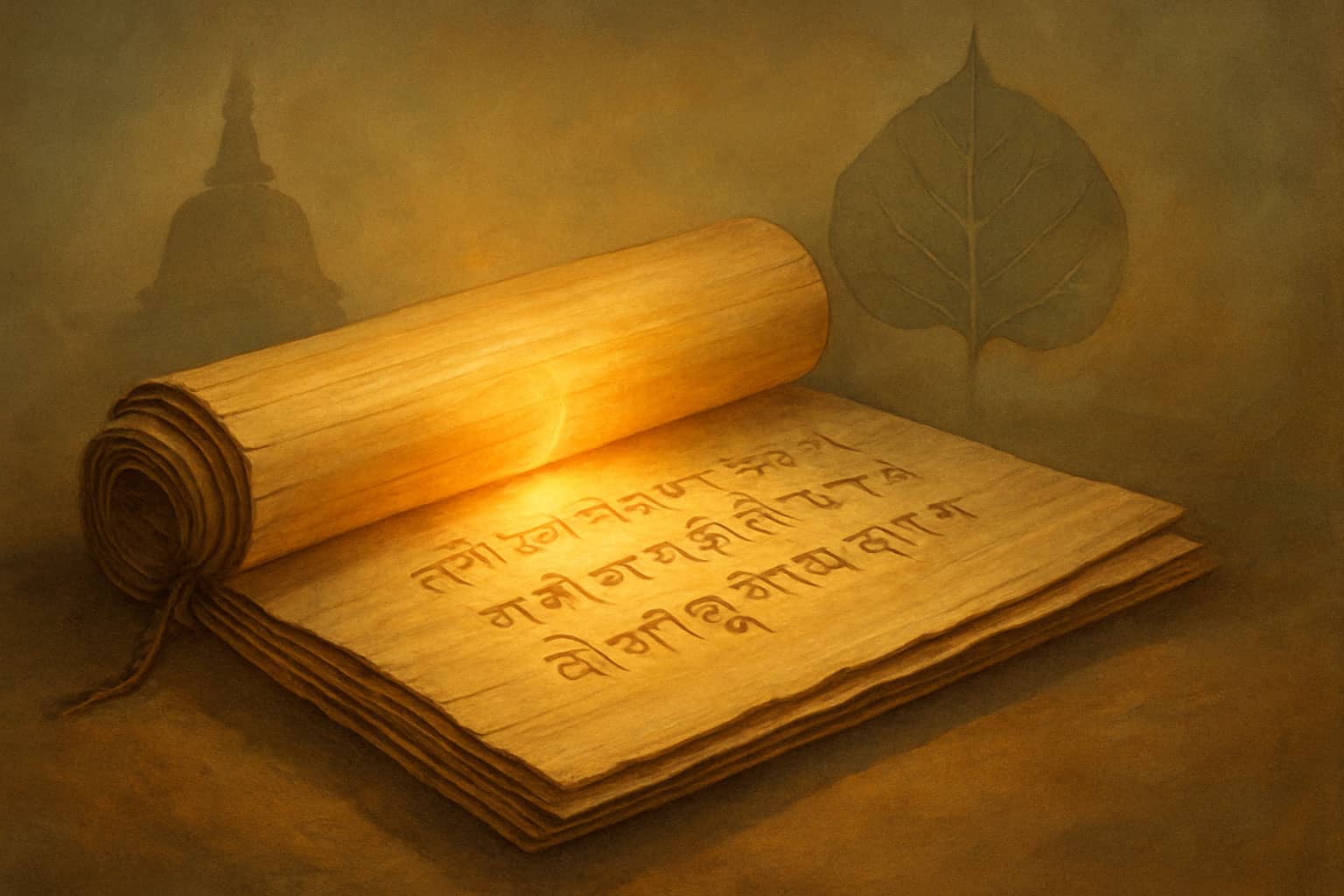
Einführung Pāli-Kanon
Definition, Entstehung und Bedeutung des Tipiṭaka im Theravāda-Buddhismus
Inhaltsverzeichnis
1.1. Was ist der Pāli-Kanon (Tipiṭaka)?
Der Pāli-Kanon, traditionell als Tipiṭaka bezeichnet, bildet das Herzstück der heiligen Schriften des Theravāda-Buddhismus. Der Name Tipiṭaka stammt aus der altindischen Sprache Pāli und bedeutet wörtlich „Drei Körbe“ (ti = drei, piṭaka = Korb). Diese Bezeichnung verweist auf die ursprüngliche Aufbewahrung der Texte auf Palmblattmanuskripten, die in Körben gelagert wurden, und spiegelt die grundlegende Dreiteilung dieser umfangreichen Schriftsammlung wider.
Traditionell wird der Kanon im Theravāda als das „Wort des Buddha“ (buddhavacana) verehrt. Dies ist jedoch nicht im streng wörtlichen Sinne zu verstehen, da der Kanon neben den Reden, die direkt dem historischen Buddha Siddhartha Gautama zugeschrieben werden, auch Lehrreden seiner unmittelbaren Schüler sowie Texte enthält, die offensichtlich erst nach seinem Tod entstanden sind. Vielmehr drückt der Begriff buddhavacana die Überzeugung aus, dass der Kanon die authentische Lehre (Dhamma) und Ordensdisziplin (Vinaya) bewahrt, wie sie vom Buddha gelehrt und von der frühen Mönchsgemeinschaft (Saṅgha) autorisiert und überliefert wurde. Er gilt als die vollständigste erhaltene Sammlung früher buddhistischer Lehren in einer indischen Sprache.
Es ist wichtig, den Pāli-Kanon von anderen buddhistischen Kanones zu unterscheiden, die in anderen Sprachen (wie Sanskrit, Chinesisch oder Tibetisch) überliefert sind und teilweise andere Texte enthalten. Der Pāli-Kanon repräsentiert die Texttradition der Theravāda-Schule (genauer der aus Sri Lanka stammenden Mahāvihāra-Tradition), die sich als Bewahrerin der ursprünglichen Lehre versteht. Er ist nicht der Ur-Kanon aller buddhistischen Schulen, sondern die Version, die von dieser spezifischen, sehr alten Schule (historisch aus der Vibhajyavāda-Linie hervorgegangen) bewahrt und kanonisiert wurde.
1.2. Entstehung: Von der mündlichen Überlieferung zur Schriftform
Die Entstehung des Pāli-Kanons ist ein faszinierender Prozess, der sich über Jahrhunderte erstreckte und von einer rein mündlichen Weitergabe zur schriftlichen Fixierung führte.
Die Mündliche Phase (ca. 5. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. v. Chr.)
Nach dem Tod (Parinibbāna) des Buddha Siddhartha Gautama, der traditionell ins 5. Jahrhundert v. Chr. datiert wird (neuere Forschung tendiert zu einem späteren Datum), versammelten sich seine führenden Schüler, um seine Lehren zu bewahren. Gemäß der Überlieferung fand kurz nach dem Tod des Buddha das Erste Buddhistische Konzil in Rājagaha (heute Rajgir) statt, geleitet vom ehrwürdigen Mahākassapa. Bei diesem Konzil sollen 500 Mönche, die bereits die Erleuchtung (Arhatschaft) erlangt hatten, zusammengekommen sein. Der Mönch Upāli, der als Meister der Ordensregeln galt, rezitierte den Vinaya Piṭaka (die Ordensdisziplin), während Ānanda, der langjährige Begleiter und Vetter des Buddha, der für sein außergewöhnliches Gedächtnis bekannt war, den Sutta Piṭaka (die Lehrreden) vortrug. Die versammelten Arhats bestätigten die Korrektheit dieser Rezitationen. Die einleitende Formel vieler Suttas, „Evaṃ me sutaṃ“ („So habe ich gehört“), wird traditionell auf Ānandas Rezitation zurückgeführt.
Die Motivation für dieses Konzil lag auch darin, die Reinheit der Lehre zu bewahren und Abweichungen oder Fehlinterpretationen entgegenzuwirken, wie eine Anekdote über einen Mönch nahelegt, der sich nach Buddhas Tod über die nun fehlende Autorität freute. Über die nächsten Jahrhunderte wurden diese Lehren ausschließlich mündlich weitergegeben. Dies geschah durch regelmäßige gemeinschaftliche Rezitationen (saṅgīti) und durch spezialisierte Mönche, sogenannte Bhāṇakas (Rezitatoren), die für die Bewahrung bestimmter Textabschnitte verantwortlich waren. Diese mündliche Kultur erforderte hochentwickelte mnemotechnische Fähigkeiten und prägte den Stil der Texte maßgeblich (siehe Seite Textformen & Stil).
Die Verschriftlichung (ca. 1. Jh. v. Chr.)
Die Überlieferung besagt, dass der Pāli-Kanon erstmals während der Herrschaft des Königs Vaṭṭagāmaṇī Abhaya (Regierungszeit ca. 89–77 v. Chr. oder etwas später, spätestens 29–17 v. Chr.) in Sri Lanka niedergeschrieben wurde. Dieser historische Schritt fand im Felsenkloster Alu Vihāra (Aluvihare) nahe Matale statt. Als Schreibmaterial dienten speziell präparierte Palmblätter (ola), in die der Text eingeritzt wurde.
Die Entscheidung zur Verschriftlichung war keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Reaktion auf existenzielle Bedrohungen. Wiederholte Invasionen aus Südindien und eine verheerende Hungersnot („Bamini Tiyā Sāya“) hatten die Reihen der Mönche dezimiert und die Kontinuität der mündlichen Überlieferungslinien gefährdet. Um den Verlust des Dhamma zu verhindern, versammelten sich Hunderte von gelehrten Mönchen (die Überlieferung spricht von 500) im Alu Vihāra, um die Texte gemeinsam zu rezitieren, zu überprüfen und schließlich schriftlich zu fixieren.
Dieser pragmatische Schritt zeigt die Priorität der Inhaltsbewahrung über die Form der Überlieferung und die Anpassungsfähigkeit des frühen Sangha an veränderte Umstände. Es ist wichtig zu wissen, dass die originalen Palmblattmanuskripte aus dieser Zeit nicht mehr erhalten sind. Palmblätter sind ein vergängliches Material, und die ältesten erhaltenen Manuskripte sind deutlich jünger. Die Bibliothek des Alu Vihāra selbst wurde während der Matale Rebellion im Jahr 1848 zerstört.
1.3. Die Pāli-Sprache: Medium der Überlieferung
Die Sprache des Kanons ist Pāli, eine mittelindoarische Sprache, die zur Gruppe der Prakrits gehört. Sie ist eng mit dem Sanskrit verwandt, weist aber deutliche Unterschiede in Lautlehre, Grammatik und Wortschatz auf. Typische Merkmale sind die Vereinfachung von Konsonantengruppen, der Wegfall der meisten Endkonsonanten und spezifische Lautwandel (z.B. wird das vokalische ṛ des Sanskrit durch a, i oder u ersetzt, und die drei Zischlaute des Sanskrit fallen in Pāli zu einem -s- zusammen).
Die genaue Herkunft des Pāli ist unter Linguisten umstritten. Die Theravāda-Tradition betrachtete Pāli lange Zeit als identisch mit Magadhi, der Sprache, die in der Region Magadha (Nordostindien) zur Zeit des Buddha gesprochen wurde und die der Buddha selbst vermutlich verwendet hat. Linguistische Analysen deuten jedoch darauf hin, dass Pāli eher Merkmale westindischer Dialekte aufweist. Eine plausible Hypothese ist, dass Pāli sich als eine Art Koine oder überregional verständliche Literatursprache entwickelte, die zwar auf westindischen Dialekten basierte, aber auch Elemente östlicher Dialekte (der Ursprungsregion des Buddhismus) aufnahm und standardisiert wurde, um die Lehren überregional zu verbreiten. Diese Standardisierung, die spätestens mit der Verschriftlichung einen festen Charakter annahm, ermöglichte einerseits die präzise und einheitliche Überlieferung des Kanons über geografische und zeitliche Grenzen hinweg. Andererseits stellt Pāli als alte Schriftsprache, die heute nicht mehr gesprochen wird, eine Barriere für den direkten Zugang zu den Texten dar und macht Übersetzungen und sprachwissenschaftliche Kenntnisse erforderlich. Pāli fungiert bis heute als Sakral- und Liturgiesprache des Theravāda-Buddhismus in Ländern wie Sri Lanka, Thailand und Myanmar.
1.4. Zentrale Bedeutung im Theravāda-Buddhismus
Für die Anhänger des Theravāda-Buddhismus besitzt der Pāli-Kanon eine unumstrittene zentrale Autorität. Er ist die primäre Quelle für das Verständnis der Lehre des Buddha (Dhamma) und der Regeln für das monastische Leben (Vinaya). Der Theravāda betrachtet den Kanon als die authentischste und am besten erhaltene Überlieferung der ursprünglichen Lehren des historischen Buddha. Er enthält nach traditioneller Auffassung alles Notwendige, um den Weg zur Befreiung vom Leiden (dukkha) und zur Verwirklichung des höchsten Ziels, Nibbāna (Nirvana), zu verstehen und praktisch zu beschreiten. Die Bewahrung und das Studium des Kanons sind daher für die Kontinuität und Integrität der Theravāda-Tradition von fundamentaler Bedeutung.
Weiter in diesem Bereich mit …
Struktur des Pāli-Kanons (Tipiṭaka)
Wie ist diese riesige Textsammlung organisiert? Dieser Abschnitt führt dich in die Struktur der „Drei Körbe“ ein: den Vinaya Piṭaka (Korb der Ordensdisziplin), den Sutta Piṭaka (Korb der Lehrreden) und den Abhidhamma Piṭaka (Korb der Höheren Lehre). Du lernst die Hauptinhalte der einzelnen Körbe kennen und erfährst, welche der fünf großen Lehrreden-Sammlungen (Nikāyas) im Sutta Piṭaka die Kernlehren enthalten.