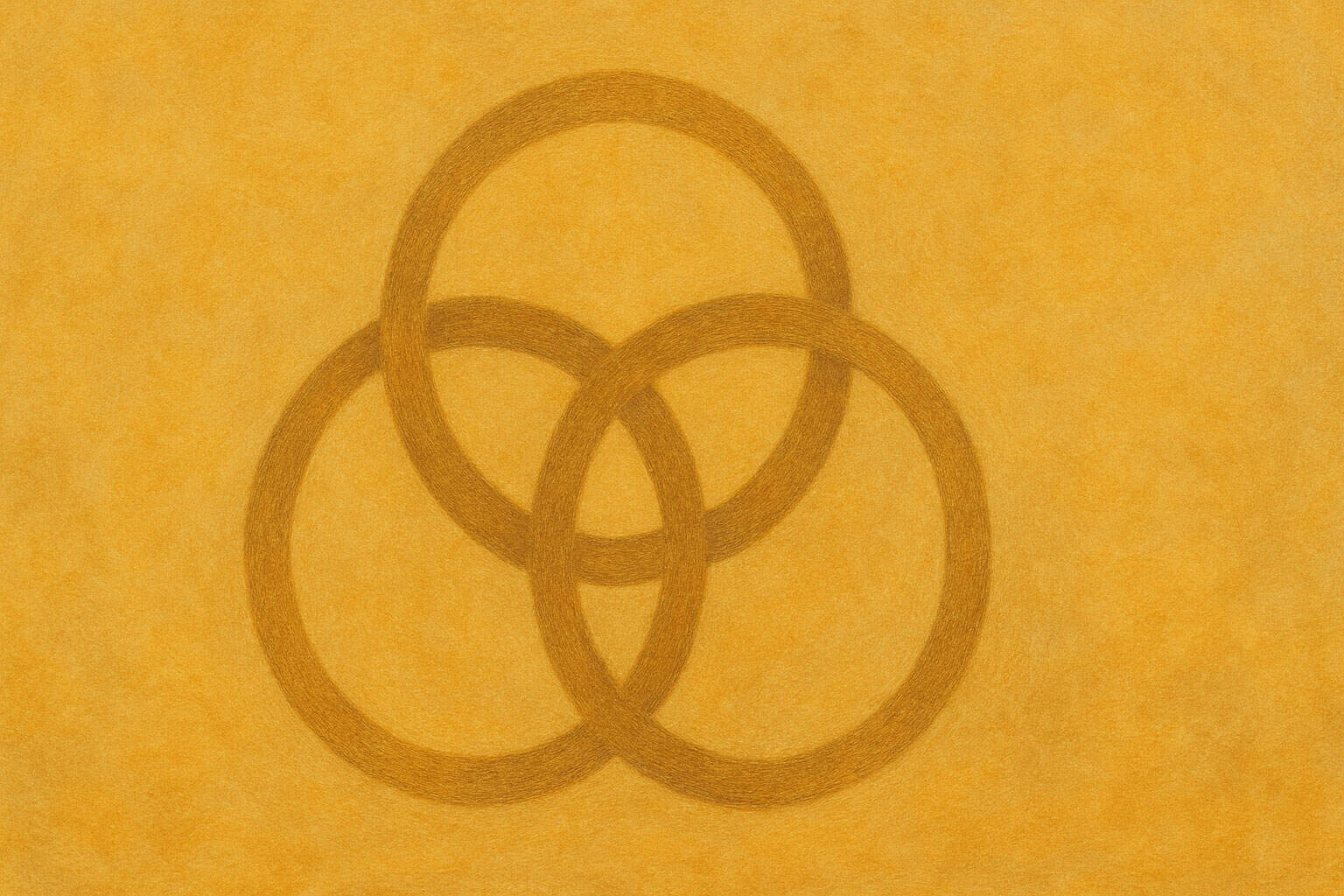
Das Fundament: Kernlehren im Spiegel des Pāli-Kanons
Die gemeinsame Wurzel der buddhistischen Strömungen
Inhaltsverzeichnis
Um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei großen Strömungen zu verstehen, ist ein Blick auf ihre gemeinsame Wurzel wichtig: den Pāli-Kanon.
A. Der Pāli-Kanon: Die älteste Schriftensammlung
Der Pāli-Kanon, auch Tipiṭaka („Drei Körbe“) genannt, gilt als die älteste und vollständigste Sammlung der Reden und Lehren, die dem historischen Buddha und seinen direkten Schülern zugeschrieben werden. Er ist die alleinige autoritative Schriftgrundlage für den Theravāda-Buddhismus.
Der Name „Drei Körbe“ bezieht sich auf die traditionelle Einteilung des Kanons:
- Vinaya-Piṭaka (Korb der Ordensdisziplin): Enthält die Regeln und Vorschriften für das Zusammenleben der buddhistischen Mönche (Bhikkhus) und Nonnen (Bhikkhunīs).
- Sutta-Piṭaka (Korb der Lehrreden): Umfasst tausende von Lehrreden (Suttas), die der Buddha oder seine Hauptschüler zu verschiedenen Anlässen gehalten haben. Dieser Korb ist weiter unterteilt in fünf Sammlungen (Nikāyas):
- Dīgha-Nikāya (Sammlung der langen Reden)
- Majjhima-Nikāya (Sammlung der mittellangen Reden)
- Saṃyutta-Nikāya (Sammlung der gruppierten Reden)
- Aṅguttara-Nikāya (Sammlung der angereihten Reden)
- Khuddaka-Nikāya (Sammlung der kurzen Texte, enthält u. a. Dhammapada, Jātaka-Erzählungen, Sutta-Nipāta)
- Abhidhamma-Piṭaka (Korb der höheren Lehre): Bietet eine systematische, philosophische und psychologische Analyse der in den Suttas enthaltenen Lehren. Er gilt als später entstanden als die anderen beiden Körbe.
Die Sprache des Kanons ist Pāli, eine mittelindische Sprache, die eng mit der Sprache verwandt ist, die der Buddha vermutlich gesprochen hat, auch wenn sie nicht identisch mit dem Māgadhī seiner Heimatregion ist. Über Jahrhunderte wurden die Texte mündlich von Mönchsgeneration zu Mönchsgeneration weitergegeben, gestützt durch regelmäßige gemeinsame Rezitationen. Erst im 1. Jahrhundert v. Chr. wurde der Kanon auf Palmblättern in Sri Lanka niedergeschrieben, um ihn angesichts von Hungersnöten und Spaltungen dauerhaft zu sichern.
B. Die Vier Edlen Wahrheiten: Diagnose und Therapie des Leidens
Wie bereits erwähnt, bilden die Vier Edlen Wahrheiten die Essenz der Lehre Buddhas. Sie wurden vom Buddha in seiner ersten Lehrrede nach dem Erwachen dargelegt und werden oft mit der Diagnose eines Arztes verglichen, der die Krankheit (Leiden), ihre Ursache, die Möglichkeit der Heilung und die notwendige Therapie (den Achtfachen Pfad) aufzeigt.
- Die Wahrheit vom Leiden (Dukkha): Der Buddha stellte fest, dass das Leben im Daseinskreislauf (Saṃsāra) untrennbar mit Dukkha verbunden ist. Das umfasst offensichtliches Leid wie Geburt, Alter, Krankheit und Tod, aber auch subtilere Formen wie Kummer, Sorge, Trennung vom Geliebten, Nichterfüllung von Wünschen und die generelle Unbeständigkeit und Unzulänglichkeit aller bedingten Phänomene. Die Identifikation mit den fünf vergänglichen Daseinsgruppen (Khandhas: Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen, Bewusstsein), aus denen sich unsere Person zusammensetzt, ist leidvoll. Dukkha ist eng verbunden mit den anderen beiden Daseinsmerkmalen: Vergänglichkeit (Anicca) und Nicht-Selbst (Anattā).
- Die Wahrheit von der Leidensentstehung (Samudaya): Die Wurzel des Leidens ist der „Durst“ (Taṇhā) – das unaufhörliche Begehren und Anhaften. Es gibt drei Hauptformen dieses Durstes: Verlangen nach Sinnesfreuden (Kāma-taṇhā), Verlangen nach Existenz und Werden (Bhava-taṇhā) und Verlangen nach Nicht-Existenz (Vibhava-taṇhā). Dieser Durst entsteht aus Unwissenheit (Avijjā) über die wahre Natur der Realität, insbesondere über Anattā. Die Kette des Bedingten Entstehens (Paṭiccasamuppāda) beschreibt detailliert, wie aus Unwissenheit über zwölf Glieder hinweg Leiden entsteht. Gier, Hass und Verblendung sind die treibenden Kräfte hinter diesem Prozess.
- Die Wahrheit von der Leidenserlöschung (Nirodha): Da das Leiden bedingt entsteht, kann es auch beendet werden. Dies geschieht durch die vollständige Überwindung und das Loslassen des Durstes (Taṇhā) und der zugrundeliegenden Unwissenheit. Das Ziel ist Nibbāna – das „Verlöschen“ der Ursachen des Leidens, der Austritt aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, ein Zustand höchsten Friedens und Freiheit.
- Die Wahrheit vom Weg zur Leidenserlöschung (Magga): Der praktische Weg, der zu Nibbāna führt, ist der Edle Achtfache Pfad.
C. Der Edle Achtfache Pfad: Der praktische Weg
Der Edle Achtfache Pfad ist keine Stufenleiter, die man nacheinander erklimmt, sondern umfasst acht Aspekte, die idealerweise gleichzeitig und in gegenseitiger Unterstützung entwickelt werden. Oft wird er durch das achtspeichige Rad des Dhamma (Dhammacakka) symbolisiert. Die wichtigste Lehrrede dazu findet sich im Mahāsatipaṭṭhāna-Sutta (DN 22). Der Pfad gliedert sich traditionell in drei Bereiche:
- Weisheit (Paññā):
- Rechte Einsicht/Anschauung (Sammā-Diṭṭhi): Das korrekte Verständnis der buddhistischen Kernlehren, insbesondere der Vier Edlen Wahrheiten, des Bedingten Entstehens, von Kamma und Wiedergeburt sowie der Lehre vom Nicht-Selbst (Anattā).
- Rechter Entschluss/Gesinnung (Sammā-Saṅkappa): Die bewusste Ausrichtung des Geistes auf heilsame Ziele: Entsagung (Loslassen von Begierden), Nicht-Schädigung (Wohlwollen) und Nicht-Grausamkeit (Mitgefühl).
- Ethik/Sittlichkeit (Sīla):
- Rechte Rede (Sammā-Vācā): Bewusstes Sprechen, das auf Lügen, Verleumdungen, harte oder beleidigende Worte und sinnloses Geschwätz verzichtet. Stattdessen wird wahrhaftige, freundliche, hilfreiche und zur rechten Zeit gesprochene Rede kultiviert.
- Rechtes Handeln (Sammā-Kammanta): Bewusstes Handeln, das vermeidet, Lebewesen zu töten, zu stehlen oder sich sexuell fehlzuverhalten. Für Laien konkretisiert sich dies oft in den Fünf Sīlas (Pañcasīla): nicht töten, nicht stehlen, keinen sexuellen Missbrauch begehen, nicht lügen, keine berauschenden Mittel zu sich nehmen, die die Achtsamkeit trüben.
- Rechter Lebenserwerb (Sammā-Ājīva): Seinen Lebensunterhalt auf eine Weise verdienen, die weder sich selbst noch anderen schadet. Berufe, die mit Waffenhandel, Handel mit Lebewesen, Fleisch, Rauschmitteln oder Giften zu tun haben, gelten als unrecht.
- Sammlung/Vertiefung (Samādhi):
- Rechtes Streben/Bemühen (Sammā-Vāyāma): Die bewusste Anstrengung, unheilsame Geisteszustände (wie Gier, Hass, Trägheit) zu verhindern bzw. zu überwinden und heilsame Geisteszustände (wie Achtsamkeit, Konzentration, Mitgefühl) zu entwickeln und zu fördern.
- Rechte Achtsamkeit (Sammā-Sati): Die klare und nicht-wertende Bewusstheit dessen, was im gegenwärtigen Moment geschieht – im Körper, in den Gefühlen, im Geist und bezüglich der Geistesobjekte (Gedanken, Konzepte). Dies ist die Grundlage der Achtsamkeitsmeditation (Satipaṭṭhāna).
- Rechte Sammlung/Konzentration (Sammā-Samādhi): Die Fähigkeit, den Geist ruhig, stabil und fokussiert auf ein Meditationsobjekt auszurichten. Dies führt zu tiefen meditativen Zuständen (Jhānas), die Klarheit und Einsicht ermöglichen.
D. Weitere zentrale Konzepte im Pāli-Kanon:
Neben den Vier Edlen Wahrheiten und dem Achtfachen Pfad finden sich im Pāli-Kanon weitere grundlegende Lehren:
- Anattā (Nicht-Selbst): Dies ist eine der revolutionärsten und zentralsten Lehren des Buddha. Sie besagt, dass es kein festes, unveränderliches, unabhängiges „Ich“ oder eine „Seele“ gibt, weder in uns noch in irgendeinem Phänomen. Was wir als unsere Persönlichkeit wahrnehmen, ist ein sich ständig verändernder Strom von physischen und mentalen Prozessen, den fünf Aggregaten (Khandhas): Körperlichkeit (Rūpa), Gefühl (Vedanā), Wahrnehmung (Saññā), Geistesformationen (Saṅkhāra) und Bewusstsein (Viññāṇa). An diesen vergänglichen Prozessen festzuhalten, als wären sie ein beständiges Selbst, ist eine Hauptursache des Leidens. Die Einsicht in Anattā ist daher ein Schlüssel zur Befreiung.
- Kamma: Wörtlich „Handlung“ oder „Wirken“. Im Buddhismus bezeichnet es das Gesetz von Ursache und Wirkung auf moralischer Ebene. Jede absichtsvolle Handlung – sei sie mit dem Körper, der Sprache oder dem Geist ausgeführt – erzeugt eine entsprechende Wirkung, eine „Frucht“ (Vipāka), die unser Erleben in diesem und in zukünftigen Leben prägt. Entscheidend ist dabei die Absicht (Cetanā) hinter der Handlung. Heilsame Absichten (Kusala), frei von Gier, Hass und Verblendung, führen zu angenehmen Ergebnissen, während unheilsame Absichten (Akusala) zu leidvollen Ergebnissen führen. Kamma ist kein Schicksal, sondern ein dynamischer Prozess, den wir durch unsere bewussten Entscheidungen beeinflussen können.
- Wiedergeburt (Saṃsāra): Solange ein Wesen von Unwissenheit und Begehren angetrieben wird und Kamma ansammelt, ist es im Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt gefangen. Dieser Kreislauf wird als leidvoll erfahren, da er immer wieder zu Alter, Krankheit, Tod und den damit verbundenen Leiden führt. Das Ziel der buddhistischen Praxis ist der endgültige Austritt aus Saṃsāra durch das Erreichen von Nibbāna.
- Mitgefühl (Karuṇā) und Liebende Güte (Mettā): Diese Geisteshaltungen sind zentrale ethische Qualitäten und wichtige Meditationspraktiken im Buddhismus. Sie gehören zu den vier „Göttlichen Verweilzuständen“ oder „Unermesslichen“ (Brahmavihāras), die kultiviert werden sollen. Die vier sind:
- Mettā: Liebende Güte, der Wunsch nach Glück und Wohlbefinden für sich selbst und alle Wesen.
- Karuṇā: Mitgefühl, der Wunsch, dass andere frei von Leid sein mögen. Es ist nicht Mitleid (das oft eine herablassende Komponente hat), sondern ein aktives Mit-Fühlen und der Wunsch zu helfen.
- Muditā: Mitfreude, die Fähigkeit, sich aufrichtig über das Glück und den Erfolg anderer zu freuen.
- Upekkhā: Gleichmut, die Fähigkeit, angesichts der Wechselfälle des Lebens innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu bewahren, ohne gleichgültig zu sein.
E. Der Pāli-Kanon als dynamische Grundlage
Es ist wichtig zu verstehen, dass der Pāli-Kanon, obwohl er die Hauptquelle des Theravāda ist, nicht als abgeschlossenes, statisches Dogma betrachtet werden sollte. Er selbst ist über einen längeren Zeitraum entstanden und enthält Texte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Entscheidend ist, dass er bereits viele Keime und Konzepte enthält, die in den späteren Mahāyāna- und Vajrayāna-Traditionen aufgegriffen, weiterentwickelt und neu interpretiert wurden.
So ist das Mitgefühl (Karuṇā) bereits ein zentraler Bestandteil der frühen Lehre, wie die Brahmavihāras zeigen. Auch wenn das spezifische Ideal des Bodhisatta, der sein eigenes Nibbāna zum Wohl aller Wesen aufschiebt, erst im Mahāyāna voll ausformuliert wurde, finden sich die Grundlagen dafür – nämlich altruistisches Handeln und der Wunsch nach dem Wohl anderer – bereits im Pāli-Kanon.
Die Jātaka-Geschichten, die von den früheren Leben des Buddha als Bodhisatta erzählen und Tugenden wie Großzügigkeit und Selbstaufopferung betonen, sind Teil des Khuddaka-Nikāya im Pāli-Kanon.
Ebenso finden sich im Pāli-Kanon Beschreibungen von sogenannten „psychischen Kräften“ (Iddhi), die als Nebenprodukt tiefer meditativer Sammlung (Samādhi) auftreten können, wie etwa die Fähigkeit, durch Wände zu gehen, auf Wasser zu wandeln oder sich an frühere Leben zu erinnern. Der Buddha selbst warnte jedoch davor, diese Kräfte zur Schau zu stellen oder sie als Ziel anzusehen; das eigentliche Ziel bleibt die Befreiung vom Leiden durch Weisheit. Dennoch könnten diese Beschreibungen später Anknüpfungspunkte für die im Vajrayāna entwickelten Techniken der Visualisierung und Transformation geboten haben.
Der Pāli-Kanon diente somit nicht nur als alleinige Quelle für den Theravāda, sondern auch als reiche Inspirationsquelle und wichtiger Bezugspunkt für die Weiterentwicklungen und Neuinterpretationen im Mahāyāna und Vajrayāna. Er stellt eine dynamische Grundlage dar, auf der die Vielfalt des Buddhismus aufbauen konnte.
Weiter in diesem Bereich mit …
Theravāda: Der Weg der Ältesten
Lerne den Theravāda, die „Lehre der Ältesten“, kennen – die älteste heute noch existierende buddhistische Schule. Du entdeckst, wie diese Tradition, die sich eng an den Pali-Kanon hält, den Weg zur Befreiung (Nibbāna) durch individuelle Anstrengung und die Praxis von Ethik (Sīla), Achtsamkeit (Sati) und Einsichtsmeditation (Vipassanā) betont. Das Ideal des Arhat, des aus eigener Kraft Befreiten, steht hier im Mittelpunkt.







