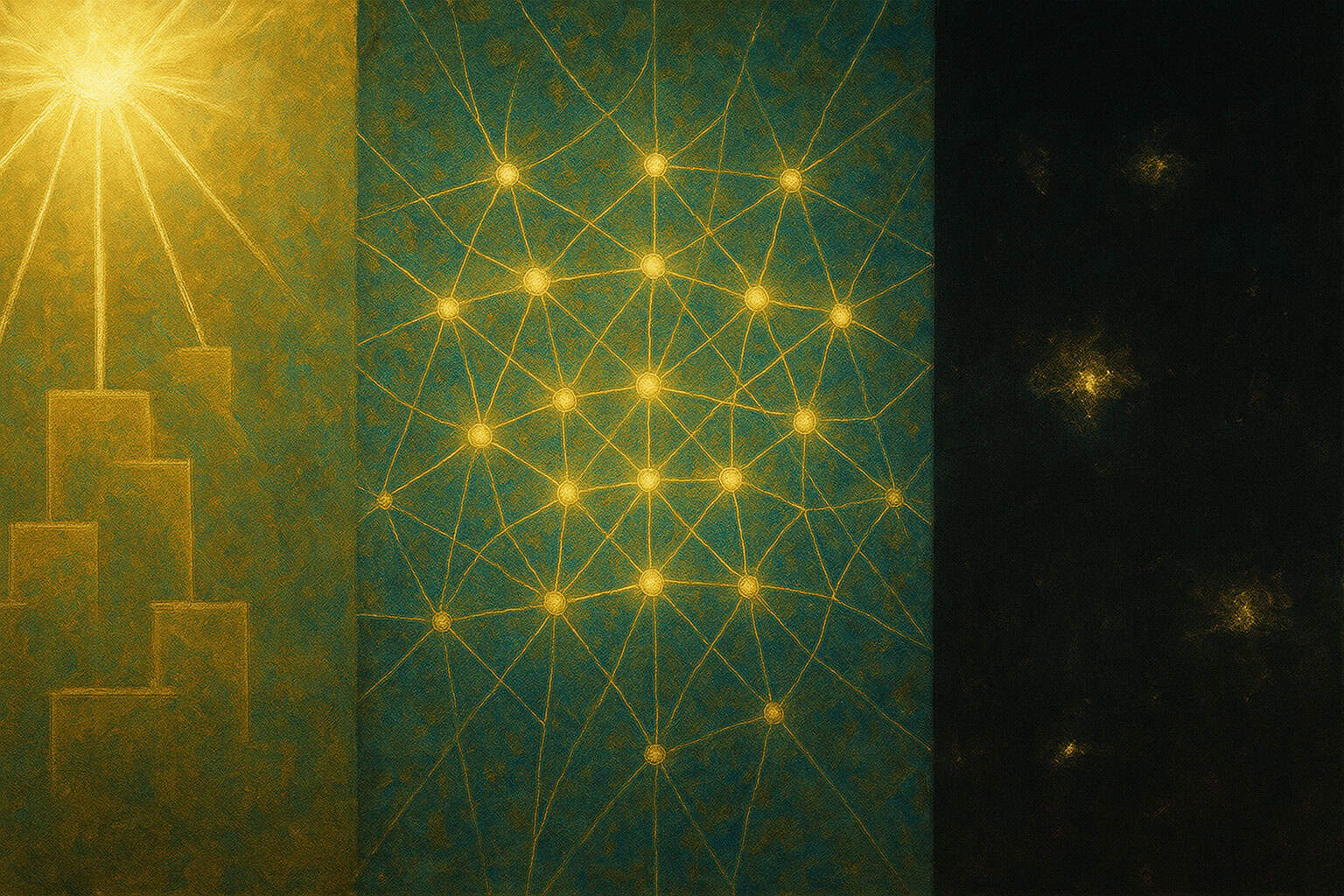
Entstehen in Abhängigkeit: Paṭiccasamuppāda versus Schöpfung und Zufall
Das buddhistische Gesetz der Kausalität als Mittlerer Weg zur Befreiung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die ewige Frage nach dem „Warum“
- Das Gesetz des Bedingten Entstehens: Eine Entschlüsselung des Paṭiccasamuppāda
- Philosophische Gegenpole: Die Widerlegung von Determinismus und Nihilismus
- Die Kette durchbrechen: Die soteriologische Bedeutung des Paṭiccasamuppāda
- Fazit: Die Relevanz einer 2500 Jahre alten Lehre
- Anhang: Primärquellen im Pāli-Kanon
- Referenzen und weiterführende Webseiten/Dokumente
Einleitung: Die ewige Frage nach dem „Warum“
Seit jeher ringt die Menschheit mit den fundamentalen Fragen der Existenz: Warum gibt es die Welt? Warum gibt es Leid? Und welchen Platz nehmen wir in diesem großen Ganzen ein? Zur Zeit des Buddha, vor rund 2500 Jahren in Indien, war die philosophische Landschaft von intensiven Debatten geprägt, in denen sich hauptsächlich drei Antworten auf diese Fragen herausgebildet hatten. Die erste war der theistische Determinismus (Issaranimmāṇahetu), die Lehre, dass alles, was geschieht – jedes Glück und jedes Leid – dem Willen einer allmächtigen Schöpfergottheit wie Brahmā oder Issara unterliegt. Die zweite war das genaue Gegenteil, der kausale Nihilismus (Ahetu-Appaccayā oder Adhiccasamuppanna), der besagte, dass alle Ereignisse rein zufällig, ohne jegliche Ursache oder Bedingung, geschehen. Eine dritte, ebenfalls weit verbreitete Ansicht war der Kamma-Determinismus (Pubbekatahetu), der lehrte, dass jede gegenwärtige Erfahrung das unausweichliche und unveränderliche Resultat von Taten aus vergangenen Leben sei.
Der Buddha erkannte in all diesen Ansichten ein gemeinsames, grundlegendes Problem: Sie führen zu einer Art moralischer Lähmung und Untätigkeit (Akiriyā). Denn wenn alles entweder von einem Gott, vom Zufall oder von unabänderlicher Vergangenheit vorherbestimmt ist, verliert die eigene Anstrengung im Hier und Jetzt an Bedeutung. Warum sollte man sich um heilsames Handeln bemühen, wenn das eigene Schicksal ohnehin in fremden Händen liegt? Als Antwort auf diese Extreme präsentierte der Buddha eine revolutionäre Alternative: die Lehre vom Entstehen in Abhängigkeit (Paṭiccasamuppāda). Dies ist kein weiterer Glaube, sondern das Herzstück seiner Erleuchtungserfahrung – die Entdeckung eines universellen Naturgesetzes, das die Welt als ein dynamisches Netz von gegenseitigen Abhängigkeiten beschreibt. Dieser Artikel legt dar, wie Paṭiccasamuppāda als ein „Mittlerer Weg“ nicht nur die philosophischen Extreme von Schöpfung und Zufall vermeidet, sondern dem Individuum die Verantwortung und damit die Macht zurückgibt, den eigenen Leidenskreislauf zu durchbrechen.
Das Gesetz des Bedingten Entstehens: Eine Entschlüsselung des Paṭiccasamuppāda
Die Lehre vom Entstehen in Abhängigkeit ist so zentral für das Verständnis des Dhamma, der Lehre des Buddha, dass dieser selbst sagte: „Wer das Bedingte Entstehen sieht, sieht den Dhamma. Wer den Dhamma sieht, sieht das Bedingte Entstehen.“ Um diese tiefgründige Lehre zu verstehen, müssen wir zunächst ihre Grundlagen betrachten.
Wortbedeutung und Kernformel
Der Pāli-Begriff Paṭiccasamuppāda setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Paṭicca, was „abhängig von“ oder „gestützt auf“ bedeutet, und Samuppāda, was „gemeinsames Entstehen“ oder „Ursprung“ heißt. Der Name selbst beschreibt also bereits das Kernprinzip: Nichts existiert isoliert, sondern entsteht stets in Abhängigkeit von anderen Bedingungen. Dieses Prinzip wird in seiner allgemeinsten Form durch eine elegante und tiefgründige Formel ausgedrückt:
Imasmiṃ sati, idaṃ hoti; imassuppādā, idaṃ uppajjati.
Imasmiṃ asati, idaṃ na hoti; imassa nirodhā, idaṃ nirujjhati.
„Wenn dieses ist, ist jenes; durch das Entstehen dieses entsteht jenes.“
„Wenn dieses nicht ist, ist jenes nicht; durch das Aufhören dieses hört jenes auf.“
Diese Formel beschreibt die universelle Gesetzmäßigkeit der Bedingtheit, die alle erfahrbaren Phänomene durchdringt. Sie ist weder ein göttliches Gebot noch ein Zufallsprodukt, sondern eine Beschreibung der grundlegenden Funktionsweise der Realität.
Ein unpersönliches Naturgesetz
Der Buddha hat Paṭiccasamuppāda nicht erfunden, sondern entdeckt. In den Lehrreden, insbesondere im Paccaya Sutta (SN 12.20), wird betont, dass dieses Gesetz eine objektive Realität ist, die unabhängig davon besteht, ob ein Buddha in der Welt erscheint, um sie zu lehren. Es wird als Dhammaniyāmatā (die feste Ordnung der Phänomene) und Idappaccayatā (die spezifische Bedingtheit) beschrieben. Diese Darstellung als ein unpersönliches Naturgesetz, vergleichbar mit den Gesetzen der Physik, ist entscheidend. Sie stellt die Lehre des Buddha in direkten Kontrast zum willkürlichen Willen eines Schöpfergottes und dem Chaos des Zufalls. Der Weg zur Befreiung ist demnach kein Kampf gegen die Realität, sondern ein Arbeiten im Einklang mit ihrer wahren Natur.
Die zwölfgliedrige Kette des Leidens (Dvādasa-Nidāna)
Die bekannteste Anwendung dieses allgemeinen Gesetzes ist die zwölfgliedrige Kette der Ursachen und Wirkungen (Dvādasa-Nidāna), die detailliert erklärt, wie das Leiden (Dukkha) entsteht und wie sich Lebewesen im Kreislauf der Wiedergeburten (Saṃsāra) verstricken. Die Kette zeigt, wie jedes Glied das nächste bedingt und so „diese ganze Masse des Leidens“ entsteht. Sie erklärt auch den Mechanismus der Wiedergeburt, ohne auf das Konzept einer ewigen, unveränderlichen Seele (Attā) zurückgreifen zu müssen. Stattdessen wird Wiedergeburt als ein kontinuierlicher Prozessstrom von Ursache und Wirkung dargestellt, der durch Unwissenheit und Begehren angetrieben wird.
Die Kette wird oft über drei Existenzen hinweg interpretiert:
- Vergangene Ursachen: Unwissenheit (1) und karmische Gestaltungen (2) im letzten Leben.
- Gegenwärtige Wirkungen: Das Bewusstsein (3), das in dieses Leben eintritt, und die darauf folgenden psycho-physischen Prozesse (4-7).
- Gegenwärtige Ursachen: Das Begehren (8), Anhaften (9) und der Werdeprozess (10), die im jetzigen Leben neues Kamma schaffen.
- Zukünftige Wirkungen: Die daraus resultierende Geburt (11) und das damit verbundene Altern und Sterben (12) in einem zukünftigen Leben.
Tabelle 1: Die zwölf Glieder des Bedingten Entstehens (Dvādasa-Nidāna)
| Nr. | Pāli-Begriff (IAST) | Deutsche Übersetzung | Kurzbeschreibung der Funktion im Prozess |
|---|---|---|---|
| 1. | Avijjā | Unwissenheit | Grundlegende Unkenntnis der Vier Edlen Wahrheiten; die Wurzel des Leidens. |
| 2. | Saṅkhārā | Gestaltungen/Formationen | Karmisch wirksame Willensregungen (gedanklich, wörtlich, körperlich), die aus Unwissenheit entstehen. |
| 3. | Viññāṇa | Bewusstsein | Das Wiedergeburtsbewusstsein, das in eine neue Existenz eintritt, bedingt durch vergangene Saṅkhārā. |
| 4. | Nāma-Rūpa | Name-und-Form | Die psycho-physische Einheit; der Geist-Körper-Organismus. |
| 5. | Saḷāyatana | Sechs Sinnesgrundlagen | Die sechs Sinnesorgane (inkl. Geist), durch die die Welt erfahren wird. |
| 6. | Phassa | Kontakt/Berührung | Das Zusammentreffen von Sinnesorgan, Objekt und Bewusstsein. |
| 7. | Vedanā | Gefühl/Empfindung | Die unmittelbare Reaktion auf Kontakt (angenehm, unangenehm, neutral). |
| 8. | Taṇhā | Begehren/Durst | Das Verlangen, angenehme Gefühle festzuhalten und unangenehme loszuwerden. |
| 9. | Upādāna | Anhaften/Ergreifen | Die Intensivierung des Begehrens zu einem Festhalten an Objekten, Ansichten und dem Selbst. |
| 10. | Bhava | Werden/Existenzprozess | Der karmische Prozess, der durch Anhaften angetrieben wird und zu einer neuen Existenz führt. |
| 11. | Jāti | Geburt | Die tatsächliche Manifestation in einer neuen Existenz. |
| 12. | Jarā-Maraṇa | Altern und Tod | Die unausweichliche Folge der Geburt, begleitet von Kummer, Jammer, Schmerz etc. |
Philosophische Gegenpole: Die Widerlegung von Determinismus und Nihilismus
Der Buddha formulierte seine Lehre in bewusster Abgrenzung zu den vorherrschenden Philosophien seiner Zeit. Paṭiccasamuppāda ist der „Mittlere Weg“, der die Extreme vermeidet, die sowohl zu metaphysischen Irrtümern als auch zu ethischer Passivität führen.
Kritik am Schöpfungsglauben (Issaranimmāṇahetu)
Die Vorstellung, dass alles von einer höchsten Gottheit erschaffen wird, war eine verbreitete Lehre. Der Buddha widerlegte diese Ansicht im Titthāyatana Sutta (AN 3.61) mit einer einfachen, aber vernichtenden Logik: Wenn ein Gott der alleinige Schöpfer von allem ist, dann ist er auch der Schöpfer von Mord, Diebstahl, Lüge und allem anderen Leid in der Welt. Eine solche Sichtweise verlagert die gesamte moralische Verantwortung vom Individuum auf eine externe Instanz. Sie macht jede Form von ethischer Kultivierung und spiritueller Anstrengung sinnlos, denn das eigene Schicksal wäre vollständig vorherbestimmt. Dies führt zu einem fatalistischen Stillstand (Akiriyā).
Kritik am Zufallsprinzip (Ahetu-Appaccayā)
Die gegenteilige Extremposition, dass alles ohne Ursache und Bedingung rein zufällig geschieht, ist nicht weniger problematisch. Wenn es keine kausalen Zusammenhänge gibt, dann kann eine Handlung keine vorhersagbare Wirkung haben. Warum sollte man dann Gutes tun und Schlechtes meiden, wenn das Ergebnis reiner Willkür unterliegt? Auch diese Lehre untergräbt die Grundlage für Ethik und den spirituellen Pfad. Sie führt, genau wie der Schöpfungsglaube, zu moralischer Apathie und Untätigkeit.
Der Mittlere Weg zwischen Sein und Nichtsein
Die tiefste philosophische Dimension des „Mittleren Weges“ wird im berühmten Kaccānagotta Sutta (SN 12.15) offenbart. Darin fragt der Mönch Kaccāna Gotta den Buddha nach der Definition von „Rechter Ansicht“. Der Buddha antwortet, dass die Welt größtenteils an zwei Extremen festhält: der Ansicht der Existenz (Atthitā) und der Ansicht der Nicht-Existenz (Natthitā).
- Eternalismus (Atthitā): Die Vorstellung, dass es ein ewiges, unveränderliches Selbst oder eine Seele (Attā) gibt, die nach dem Tod weiterbesteht.
- Nihilismus/Annihilationismus (Natthitā): Die Vorstellung, dass mit dem Tod alles endet und Handlungen keine Konsequenzen über das Leben hinaus haben.
Der Buddha erklärt, dass er, indem er diese beiden Extreme meidet, die Lehre „in der Mitte“ lehrt: Paṭiccasamuppāda. Phänomene sind nicht ewig existent, denn sie entstehen bedingt und vergehen wieder. Sie sind aber auch nicht völlig nicht-existent, denn sie entstehen und entfalten Wirkungen. Die Realität ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Diese Lehre durchbricht die Wurzel des Leidens auf zwei Ebenen: Sie entlarvt die Vorstellung eines ewigen Selbst, an das wir klammern (Eternalismus), und sie bestätigt gleichzeitig die moralische Wirksamkeit von Handlungen (Kamma), die der Nihilismus leugnet.
Tabelle 2: Vergleich der Weltanschauungen
| Kriterium | Schöpfungsglaube (Issaranimmāṇahetu) | Zufallsprinzip (Ahetu-Appaccayā) | Bedingtes Entstehen (Paṭiccasamuppāda) |
|---|---|---|---|
| Ursache der Realität | Ein externer, willentlicher Schöpfer (Gott). | Keine Ursache, reiner Zufall. | Ein unpersönliches, universelles Gesetz der Bedingtheit. |
| Rolle des Individuums | Passiver Empfänger des göttlichen Willens. | Passives Opfer des Chaos. | Aktiver Teilnehmer in einem Netz von Ursachen und Wirkungen. |
| Moralische Verantwortung | Auf den Schöpfer verlagert; führt zu Fatalismus. | Nicht existent; führt zu Nihilismus. | Zentral und unmittelbar; jede Handlung hat Konsequenzen. |
| Weg zur Befreiung | Gnade oder Ergebenheit gegenüber dem Schöpfer. | Nicht möglich, da kein sinnvoller Weg existiert. | Durchschauen des Prozesses und Kultivierung von Weisheit, um die Kette zu durchbrechen. |
Die Kette durchbrechen: Die soteriologische Bedeutung des Paṭiccasamuppāda
Die Lehre vom Bedingten Entstehen ist keine rein philosophische Theorie; sie ist eine praktische Methode zur Befreiung vom Leiden (Dukkha). Ihr wahrer Wert liegt in ihrer soteriologischen (erlösungsbezogenen) Anwendung.
Die Umkehrung des Prozesses
Die Kernformel des Paṭiccasamuppāda beschreibt nicht nur die Entstehung des Leidens (Anuloma), sondern auch dessen Aufhebung (Paṭiloma): „Durch das Aufhören dieses hört jenes auf“. Die Kette ist kein unentrinnbares Schicksal, sondern ein Prozess, in den man aktiv eingreifen kann. Die Praxis zielt darauf ab, die Kette an ihren schwächsten Gliedern zu durchbrechen. Die beiden entscheidenden Punkte sind:
- Unwissenheit (Avijjā): Das erste Glied und die Wurzel des gesamten Prozesses. Sie wird durch die Entwicklung von Weisheit (Paññā) und die direkte Einsicht in die Vier Edlen Wahrheiten und das Bedingte Entstehen selbst überwunden.
- Begehren (Taṇhā): Das achte Glied, das direkt aus Gefühl (Vedanā) entsteht. Hier setzt die Praxis der Achtsamkeit (Sati) an. Indem man Gefühle (angenehm, unangenehm, neutral) achtsam wahrnimmt, ohne automatisch mit Begehren oder Ablehnung zu reagieren, wird die Kausalkette unterbrochen. Man beobachtet, wie ein Gefühl entsteht und wieder vergeht, ohne dass es zwangsläufig zu Verlangen und Anhaften führen muss.
Diese Praxis findet im Hier und Jetzt statt. Jedes Mal, wenn durch einen Sinneskontakt (Phassa) ein Gefühl (Vedanā) entsteht und man es schafft, nicht reaktiv mit Begehren (Taṇhā) zu antworten, wird die Kette in diesem Moment durchbrochen. Dies verhindert die Entstehung von Anhaften (Upādāna) und die mentale Proliferation (Papañca), die das Gefühl von „Ich“ und „Mein“ erzeugt. Diese mikrokosmische Befreiung im Moment hat eine makrokosmische Wirkung: Sie entzieht dem Kreislauf des Saṃsāra den Treibstoff und führt letztendlich zur vollständigen Befreiung (Nibbāna). Darüber hinaus gibt es im Upanisa Sutta (SN 12.23) eine „transzendentale“ Version des Bedingten Entstehens, die den Weg zur Befreiung selbst als einen bedingten Prozess beschreibt. Hier führt das Erkennen des Leidens (Dukkha) zu Vertrauen (Saddhā), dieses zu Freude (Pāmojja), Entzücken (Pīti), Sammlung (Samādhi) und schließlich zu Wissen und Sehen (Ñāṇadassana) und Befreiung (Vimutti). Dies zeigt auf wunderbare Weise, dass der Befreiungsweg kein Kampf gegen die Naturgesetze ist, sondern deren weise Anwendung zur Kultivierung heilsamer Zustände.
Fazit: Die Relevanz einer 2500 Jahre alten Lehre
Die Lehre vom Paṭiccasamuppāda ist weit mehr als eine antike philosophische Theorie. Sie ist eine dynamische, prozessorientierte und vernetzte Weltsicht, die eine tiefgreifende Alternative zu den statischen und deterministischen Modellen von Schöpfung und Zufall bietet. Sie beschreibt eine Realität, die nicht aus festen Substanzen besteht, sondern aus einem unaufhörlichen Fluss von miteinander verknüpften Bedingungen. Ihre größte Stärke liegt in ihrer ermächtigenden Botschaft. Leiden ist weder eine göttliche Strafe noch ein unglücklicher Zufall. Es ist ein bedingter Prozess, der aus verständlichen Ursachen entsteht – allen voran aus Unwissenheit und Begehren. Und weil er verständlich ist, kann er auch beeinflusst werden. Indem wir die Mechanismen des Bedingten Entstehens durchschauen, erlangen wir die Fähigkeit, die Kette des Leidens zu durchbrechen und unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. In einer Welt, die immer noch mit Fragen nach freiem Willen, Determinismus und dem Sinn des Lebens ringt, bietet dieses 2500 Jahre alte Prinzip der Interdependenz und der persönlichen Verantwortung eine zeitlos relevante und tief befreiende Perspektive.
Anhang: Primärquellen im Pāli-Kanon
Die Lehre vom Bedingten Entstehen ist ein zentrales Thema im Pāli-Kanon, der Sammlung der frühesten buddhistischen Schriften. Die wichtigste Quelle hierfür ist das Nidāna Saṃyutta, das 12. Buch der „Gruppierten Sammlung“ (Saṃyutta Nikāya), das 93 Lehrreden (Suttas) zu diesem Thema enthält. Für Interessierte, die tiefer in die Originaltexte eintauchen möchten, sind folgende Lehrreden besonders aufschlussreich:
- SN 12.2 Vibhaṅga Sutta (Analyse): Bietet die kanonischen Definitionen für jedes der zwölf Glieder der Kette und ist ein grundlegender Text zum Verständnis der Terminologie.
- SN 12.15 Kaccānagotta Sutta (An Kaccāna Gotta): Die entscheidende Lehrrede, die Paṭiccasamuppāda als den „Mittleren Weg“ zwischen den philosophischen Extremen von ewiger Existenz und Nicht-Existenz positioniert.
- SN 12.20 Paccaya Sutta (Bedingungen): Erklärt den Status des Paṭiccasamuppāda als ein objektives, universelles Naturgesetz, das unabhängig von der Lehre eines Buddha existiert.
- SN 12.65 Nagara Sutta (Die Stadt): Verwendet die berühmte Metapher des Buddha, der seine Entdeckung des Bedingten Entstehens mit dem Wiederfinden einer alten, vergessenen Stadt und ihres Weges vergleicht.
- AN 3.61 Titthāyatana Sutta (Die Grundlagen der Sektierer): Die Lehrrede, in der der Buddha die drei fatalistischen Ansichten (Schöpfung, Kamma-Determinismus, Zufall) direkt widerlegt, indem er aufzeigt, dass sie alle zu moralischer Untätigkeit führen.
Referenzen und weiterführende Webseiten/Dokumente
- Fred von Allmen: Das leere Netz des bedingten Entstehens (PDF) – Einer der besten deutschsprachigen Texte für Praktizierende. Erklärt die komplexe 12-gliedrige Kette nicht nur theoretisch, sondern zeigt, wo im Alltag der „Ausstieg“ möglich ist (beim Kontakt/Gefühl).
- Palikanon Wörterbuch: Paṭiccasamuppāda – Die systematische Definition von Nyanatiloka. Schlüsselt die 12 Glieder (Unwissenheit bis Tod) auf und erklärt die zeitliche Verteilung über drei Leben (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft).
- Mahānidāna Sutta (DN 15) – Die große Lehrrede von den Ursachen – Der primäre Sutta-Text (via SuttaCentral/Palikanon), in dem der Buddha zu Ananda sagt: „Tief, Ananda, ist dieses Bedingte Entstehen.“ Eine fundamentale Quelle für das Studium.
- U Thittila: Paticcasamuppada (Abhidhamma-Perspektive) – Für Fortgeschrittene: Dieser Text beleuchtet die mikroskopischen Details der Kausalität aus der Sicht des Abhidhamma (der höheren Lehre), was das Verständnis der momentanen Bedingtheit vertieft.
Weiter in diesem Bereich mit …
Buddha: Legende und Wirklichkeit
Wer war Siddhartha Gautama, der Buddha? Entdecke die zwei Seiten seiner Geschichte: die inspirierenden Legenden voller Wunder und die nüchterne historische Realität. Erfahre, warum die Unterscheidung zwischen Mythos und Fakten wichtig ist und wie beide Sichtweisen unser Verständnis seiner Lehre bereichern.








